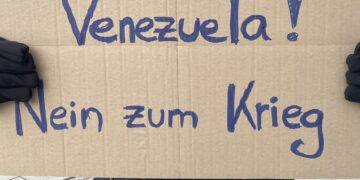Mit viel Geld für Werbung und PR wurde der Lebensmittel-Onlinehändler und ‑Zusteller „Gurkerl.at“ gehypt. Nun stellt sich heraus, dass das Unternehmen vor einer Bruchlandung stehen könnte.
Wien. Der Online-Supermarkt und Lieferdienst „Gurkerl.at“ plant offenbar Massenentlassungen. Von den rund 1.000 Angestellte in Österreich sollen 290 gehen. Dass fast ein Drittel der Belegschaft zur Kündigung angemeldet wird, begründet das Management mit der Vollautomatisierung des Wiener Logistikzentrums, wodurch man weniger Personal brauchen würde. Dem Vernehmen nach dürfte das aber bestenfalls die halbe Wahrheit sein.
Tatsache scheint zu sein, dass der flotte Expansionskurs, den der Eigentümer, die tschechische Rohlik Group, in Österreich v.a. mit Geldverbrennung im Bereich der ausufernden Werbung forcierte, nicht glatt läuft. Unterm Strich ist „Gurkerl.at“ seit der Gründung 2020 noch immer nicht in der Gewinnzone, weswegen der Kapazitätsabbau nicht nur das Personal, sondern auch das Angebot betrifft. Der Betrieb wird also zurückgefahren, um die Produktivität zu erhöhen, d.h. insgesamt endlich Profite zu lukrieren. Es braucht den Kahlschlag, um nicht gänzlich zusperren zu müssen.
Dabei muss man wissen, dass bei „Gurkerl.at“ ohnedies schon ein berüchtigtes Ausbeutungsregime herrscht. Die Arbeitsbedingungen sind miserabel, wie viele Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter berichten, der Druck ist immens, der Umgangston harsch – bei Löhnen, die ebenfalls besser sein könnten – dementsprechend gab und gibt es eine recht „dynamische“ Personalfluktuation. Das bedeutet, dass trotz maximaler Auspressung der Arbeiterschaft das Unternehmen nicht genug Profit abwirft. Man hätte wohl auch weniger Geld ins aggressive Marketing stecken sollen, dessen Versprechungen nicht eingehalten werden können.
Insgesamt wirkt das Ganze ein wenig wie eine neue Online-Inszenierung eines künstlich gehypten „Start-ups“, das wenig Substanz hat – nur dass in diesem Fall ein tschechischer Konzern dahintersteckt, dessen Tochterunternehmen auch in anderen Ländern Probleme haben.
Quelle: Der Standard