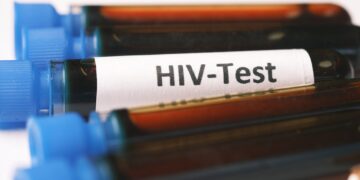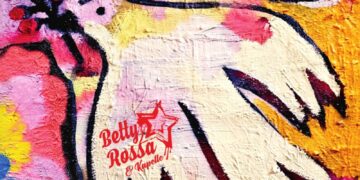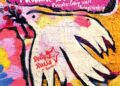Gastbeitrag von Gerhard Oberkofler, geb. 1941, Dr. phil., Universitätsprofessor i. R. für Geschichte an der Universität Innsbruck.
Camilo Torres als ein „Beginner“ der Befreiungstheologie und sein Platz in der Deutschen Demokratischen Republik
Die Freiheit ist ein leerer Wahn,
solange eine Menschenklasse die andere
ungestraft aushungern kann.
Jacques Roux, Priester in Paris (1793)
Hier hat man nur ein Ziel: die Befreiung
des Volkes aus den Klauen der herrschenden
Minderheit und der imperialistischen Ausbeutung.
Camilo Torres, Priester in den Bergen Kolumbiens (1966)
Vorbemerkung
Viele Jahre hat Georgi Plechanow (1856–1918) als Emigrant in der Schweiz gelebt. Er ist Begründer der ersten russischen marxistischen Organisation „Befreiung der Arbeit“. Obschon Plechanow als Menschewik die Oktoberrevolution abgelehnt hat, wurden seine Schriften und Artikel von Wladimir I. Lenin (1870–1924) sehr geschätzt. In seinem Essay „Über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte“ hat Plechanow in Anlehnung an Thomas Carlyle (1795–1881) von „Beginnern (Beginners)“ gesprochen: „Der große Mann ist eben ein Beginner, denn er blickt weiter als die anderen und will stärker als die anderen. Er löst die wissenschaftlichen Aufgaben, die der vorhergegangene Verlauf der geistigen Entwicklung der Gesellschaft auf die Tagesordnung gesetzt hat; er ergreift die Initiative zur Befriedigung dieser Bedürfnisse. Er ist ein Held. Held nicht etwa in dem Sinne etwa, dass er den natürlichen Gang der Dinge aufhalten oder ändern könnte, sondern in dem Sinne, dass seine Tätigkeit der bewusste und freie Ausdruck dieses notwendigen und unbewussten Ganges ist. Darin liegt seine ganze Bedeutung, darin liegt seine ganze Kraft. Das ist aber eine gewaltige Bedeutung, eine ungeheure Kraft.“ Diese Schrift von Plechanow war in der Sowjetunion im Kanon der revolutionären Erziehungsliteratur. Der aus privilegierten bürgerlichen Verhältnissen kommende Kolumbianer Jorge Camilo Torres Restrepo (3. Februar 1929 in Bogotá – 15. Februar 1966 bei El Carmen in der Nähe von Cúcuta) ist ein revolutionärer „Beginner“.
Calixto Torres (1885–1960), Arzt und zeitweise im diplomatischen Dienst Kolumbiens als Konsul im Berlin der 1930er Jahre, war der Vater von Camilo Torres. Die Mutter Isabel Restrepo (1895–1973) hat der vom „heiligen“ Papst Johannes Paul II. (1920–2005) als Befreiungstheologe demonstrativ erniedrigte katholische Priester Ernesto Cardenal (1925–2020) in Kuba kennengelernt. Cardenal war Befreiungstheologe, er war nach dem Sturz von Diktator Anastasio Somoza (1925–1980) 1979 von der Revolutionsregierung 1979 zum Kulturminister von Nicaragua ernannt worden und hat als solcher die DDR besucht. Dort wurde ihm an der Humboldt-Universität am 24. Oktober 1985 in Anerkennung seiner „Verdienste um die Begründung der Theologie der Befreiung“ und seines „der Würde des armen Volkes von Nikaragua und seines Anspruches auf Leben, Gerechtigkeit und Frieden dienenden Schaffens“ sowie seiner „aktiven Unterstützung des gerechten Kampfes des nikaraguanischen Volkes“ das Ehrendoktorat der Philosophie verliehen. Gegenüber der Journalistin des „Neuen Deutschland“ Irmtraud Gutschke (*1950) hat Cardenal festgehalten, dass der „Sieg der Revolution“ das Thema seiner Gedichte ist. „In einem meiner Gedichte“, so Cardenal, „habe ich geschrieben: Kommunismus – das heißt das Reich Gottes auf Erden – was für mich dasselbe ist“.
Camilo Torres hat in der über 2640 hoch gelegene kolumbianischen Millionenmetropole Bogotá nach dem Besuch der Deutschen Schule (ab 1937) und des Liceo Cervantes (Matura 1948) an der Nationalen Universität mit dem rechtswissenschaftlichen Studium begonnen. Er entschied sich nach einem Semester katholischer Priester zu werden. Schon der kleine Camilo hatte eine innige Liebe zu den unterdrückten Armen gehabt und ihnen sein Taschengeld geschenkt. Von Beginn seines Lebens an lernte Camilo Torres von diesen Armen, er lernte in jungen Jahren, was zu tun ist, um das Volk von der Unterdrückung durch eine Minderheit zu befreien. Nach herausragendem Studium wurde Torres 1954 (29. August) zum Priester geweiht. Die persönlichen Besonderheiten und Begabungen von Torres fielen der Hierarchie auf und so vermittelte ihm Kardinal Luis Concha Córdoba (1891–1975) ein Stipendium zur weiteren wissenschaftlichen Ausbildung für Soziologie an der katholischen Universität in Löwen. In seiner Diplomarbeit „Statistische Daten zur sozioökonomischen Realität der Stadt Bogotá“ ist Torres erstmals dem Zusammenhang von Elend und Herrschaft im kapitalistischen System wissenschaftlich begegnet. Während seines 1959 abgeschlossenen Studiums konnte er viele Reisen in europäische Länder machen, unter anderen in die Tschechoslowakei, in die DDR und nach Frankreich, wo er in Paris dem sich für Arme und Obdachlose aktiv einsetzenden, aus der Résistance kommenden katholischen Priester Abbé Pierre (d. i. Henri Antonie Grouès, 1912–2007) aufgesucht hat. Nach einem kurzen Studienaufenthalt in den USA kehrte Torres 1960 nach Bogotá zurück. Kolumbien wurde in diesen Jahren von einer sich am US-Imperialismus anlehnenden „Nationalen Front“ regiert. Von 1958 bis 1962 war Kolumbiens amtierenden Präsident Alberto Lleras Camargo (1906–1990), 1962 bis 1966 Guillermo León Valencia Muñoz (1909- 1971) und von 1966 bis 1970 Carlos Lleras Restrepo (1908–1994).
Der marxistische Historiker Manfred Kossok aus Leipzig und der katholische Priester Alfons Kirchgässner aus Frankfurt a. M. reisen Anfang der 1960er Jahre nach Kolumbien
Der an der Karl- Marx- Universität Leipzig, die 1991 diesen Namen abgelegt hat und sich seither als Alma Mater in Kriegsdeutschland deklariert, bei Walter Markov (1909–1993) ausgebildete Historiker der vergleichenden Revolutionsgeschichte Manfred Kossok (1930–1993) hat während seines Aufenthaltes in Lateinamerika in Bogotá auch mit Camilo Torres gesprochen. Kossok wird sich an den französischen Revolutionspriester Jaques Roux (1752–1794) erinnert haben, der die ärmsten Schichten des Volks vertreten hat. Roux war, wie Friedrich Engels (1820–1895) und Karl Marx (1818–1883) in der „Die heilige Familie“ schreiben, einer der „Hauptrepräsentanten“, welche „kommunistische Idee hervorgetrieben“ haben. Im Vatikan wurde durch Papst Pius VI. (1717–1799) die Auffassung von Revolutionären wie Jacques Roux über die „angeborene Gleichheit und Freiheit unter den Menschen“ als „absurde Freiheitslehre“ abgetan. Walter Markov hat über Jacques Roux mehrere umfangreiche biografische Texte veröffentlicht. Kossok schreibt 1970 in der Wochenschrift „Die Weltbühne“ über „Christus in Lateinamerika“:
„Bogotá im Spätsommer 1962. Um diese Zeit erreicht der als ‚Violencia‘ (Gewalt) bezeichnete bürgerkriegsähnliche Zustand in weiten Teilen Kolumbiens einen Höhepunkt. Seit 1948 starben an der ‚Violencia‘ 300.000, die meisten Opfer waren Bauern. Die Gedanken von Camilo Torres kreisen um die Verantwortung von Kirche und Christentum angesichts der unvorstellbaren Tragödie, die dieser ‚lautlose Krieg‘ zur Folge hat. 1959 gründete er, der die katholische Musteruniversität von Löwen (Belgien) absolvierte, an der Nationaluniversität eine Fakultät für Soziologie, deren Forschungsarbeit auch die sozialen und politischen Wurzeln der ‚Violencia‘ bloßlegte: Großgrundbesitz und eine korrupte Regierung decken jede Gewalttat. Camilo Torres hofft, die Kirche möge ihre moralische Autorität in die Waagschale werfen, um eine Wende herbeizuführen. Dann erkennt er: ‚Gegen die eigene Hierarchie kommen wir nicht an, unser Protest ändert nichts‘. Camilo Torres legt das Priesteramt nieder und schließt sich den im Norden Kolumbiens existierenden Partisanengruppen der ‚Nationalen Befreiungsarmee‘ (E. L. N.) an. Schon in einem ersten Gefecht trifft ihn am 15. Februar 1966 die tödliche Kugel …“.
1967 (26. März) veröffentliche Papst Paul VI die Enzyklika „Populorum progressio“ (26. März 1967). Die gesellschaftlichen Wurzeln der Gewalt werden damit von der Katholischen Kirche zu einem prioritären Thema. In dem von einer faschistischen Militärdiktatur gequälten Brasilien hat Erzbischof Hélder Cámara (1909–1999) seine Stimme für die Opfer erhoben. Papst Paul VI. war beim Eucharistischen Weltkongress in Bogotá (l8.-25. August 1968) anwesend. Die „Wiener Kirchenzeitung“ erhofft sich aus diesem Anlass eine Erneuerung der lateinamerikanischen Kirche: „Der Marxismus hat die Massen Lateinamerikas unruhig gemacht – und die Kirche auch. Sie spürte die an sie gerichtete Frage von Millionen, die nie zu fragen gewohnt waren und begann die gegebene Situation zu untersuchen, die sie bald als unhaltbar erkannte, eine Einsicht, die sie mit vielen teilte, nur nicht mit jenen Gruppen, die von sich aus Konzessionen zu machen hätte, um zu verhindern, dass die notwendigen Änderungen mit Gewalt und Blutvergießen durchgeführt werden“. Eine der Predigten von Papst Paul VI. interpretierte im Einvernehmen mit Kardinal Franz König (1905–2004) die „Wiener Kirchenzeitung“ als Zurückweisung von „Modephilosophien“ und als Aufruf „zu sozialer Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Ablehnung von Gewaltanwendung“. Kardinal König, dessen hierarchisch klerikaler Blick vor allem in Richtung Osten gerichtet war, ist der vom spanischen Kleriker Josemaría Escrivá (1902–1975) gegründeten paramilitärischen antikommunistischen Hetz-Organisation Opus Dei mehr als mit wohlwollender Duldung gegenübergestanden. Kardinal König hat die zentral gelegene Wiener Peterskirche 1970 Opus Dei überantwortet. Johannes Paul II. und Joseph Ratzinger (1927–2022), der sich als Papst (2005–2013) Benedikt XVI. nannte, konnten für ihre Machtpolitik auf die Dienste von Opus Dei rechnen. Ratzinger hat sich von der spanischen Opus Dei-Universität ein Ehrendoktorat verleihen lassen. Unmittelbar nach dem Eucharistischen Weltkongress in Bogotá fand in Medellín, der zweitgrößten Stadt von Kolumbien, die seit 1955 institutionalisierte Lateinamerikanische Bischofskonferenz (26. August – 6. September 1968) statt, die, inspiriert von Erzbischof Cámara und seinen Mitbrüdern, versuchte, auf eine einheitliche Linie zur Befreiung von Imperialismus und Kapitalismus in Lateinamerika zusammenzufinden.
Manfred Kossok war 1968 wieder in Kolumbien und schreibt:
„Bogotá im Spätsommer 1968. Papst Paul VI. trifft zum 39. Eucharistischen Weltkongress ein. Er ist der Papst der ‚Enzyklika über den Fortschritt der Völker‘, deren Kapitel 32 ‚kühne, bahnbrechende Umgestaltungen‘ verlangt. Hat die Saat von Camilo Torres Wurzeln geschlagen, oder ist das Bekenntnis: ‚Es eilt … Dringende Reformen müssen unverzüglich in Angriff genommen werden‘ nur verbaler Radikalismus, publikumswirksam gemacht durch die Aufforderung zur Flucht nach vorn? Die Kirche Lateinamerikas hat sich seit Beginn der sechziger Jahre in vielem verändert. Der Papstbesuch verleiht dem symbolischen Ausdruck. […] Ausgehend von Brasilien und durch den Erzbischof von Recife und Olinda Hélder Cámara, repräsentiert, formiert sich eine radikal reformistische Strömung, die nach echten sozialökonomischen und politischen Umwälzungen strebt. Von ihr gong die Initiative für das im August 1967 verkündete ‚Manifest der Bischöfe der Dritten Welt‘ aus. Erneut soll sich die Kirche auf ihre Mission besinnen, eine Zuflucht der Armen zu sein, selbst um den Preis der Revolution. Aber diese Revolution muss, so meint Hélder Cámara, gewaltlos und friedlich sein und als ‚sozialistische Alternative‘ mit dem Kapitalismus zugleich den ‚atheistischen Kommunismus‘ überwinden. Nur Lateinamerika, ‚der christliche Kontinent der Dritten Welt‘, vermag das ‚Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen und die Gerechtigkeit im Weltmaßstab zu ermutigen‘. Es ist ein Appell an Vernunft und Einsicht der Herrschenden. Wie wenig er vermag, musste der streitbare Erzbischof bereits an der eigenen Person erfahren. Beschränkung der Redefreiheit, Repressalien und Polizeiwillkür, Attentatsversuche, Ermordung engster Mitarbeiter sind die Antwort der brasilianischen Militärdiktatur. Man weiß, dass Paul VI. dem Bischof persönlich gewogen ist; doch was geschieht mit jenen, denen solcher Schirm fehlt? […]“.
Im Februar 1963 hat der katholische Weltpriester Alfons Kirchgässner (1909–1993) aus Frankfurt a. M. mit einer von einem chilenischen Jesuiten geführten, kleinen Gruppe von fünf Ordensmänner und einem Weltpriester Lateinamerika bereist. Er hat sich dabei tagebuchartige, nach seiner Rückkehr gleich veröffentlichte Notizen gemacht. Der Nazigegner Kirchgässner hat 1949 den von der Marianischen Kongregation (MK) als Jugendbuch empfohlenen, in Gruppenstunden von Sodalen besprochenen, gesellschaftspolitisch allerdings die Realität der ultrareaktionären Kirche in Mexiko ausblendenden Roman „Kreuz über Mexiko. Erlebnisse und Taten des Miguel Torquemada“ veröffentlicht. Über Kolumbien schreibt Kirchgässner, dass von den 15 Millionen Einwohnern, wovon 60% Mestizen und 25% Weiße waren, 85% „in primitivsten Verhältnissen“ leben. „Beherrschender Einfluss von 23 großen Familien, 4.500 Grundbesitzer verfügen über 7 Millionen ha“. Am 12. September 1960 hat es einen gemeinsamen „Hirtenbrief“ der Bischöfe zur Landreform gegeben. Kirchgässner weiter: „Der geistliche Direktor von Radio Sutatenza: ‚Revolutionen müssen kommen, damit die Kirche auf ihre wahre Aufgabe gestoßen wird. Es gilt, sich schon jetzt auf die Zeit nach der Revolution vorzubereiten‘. Staatskirchentum: Die Kirche hat viele soziale und karitative Einrichtungen geschaffen – das gilt auch von frommen Privatpersonen -, ist aber noch stark mit den besitzenden Klassen verbunden“. „Ein kirchlicher Würdenträger meinte, die Erfolge der Protestanten beruhten auf amerikanischem Geld, die katholische Kirche hier sei eben arm. In seinem Palast – 1949 in der Revolution niedergebrannt und unverändert wieder aufgebaut – prangte alles von Marmor; der wundervolle Innenhof wurde durch einen Springbrunnen sehr anmutig belebt.“
Camilo Torres wird in Bogotá als Priester Ideenträger und Revolutionär der Volksbefreiung
Torres wurde nach seiner Heimkehr aus Löwen in Bogotá von seinen Vorgesetzten als Universitäts- und Studentenkaplan an der Nationaluniversität eingesetzt. In den nächsten Monaten übernahm er mehrere ihm übertragene kirchliche Aufgaben und gründete initiativ gemeinsam mit dem in den USA ausgebildeten Soziologen Orlando Fals Borda (1925- 2008) an der Nationaluniversität eine Fakultät für Soziologie. Als Vertreter der kolumbianischen Kirche wurde Torres zum Eucharistischen Weltkongress „Pro mundi vita“ in München (31. Juli ‑7. August 1960) delegiert. Dort musste er zur Kenntnis nehmen, wie die vom Apostel Johannes überlieferten Botschaft „Der Friede sei mit euch“ des 30 n. u. Z gekreuzigten Jesus von Nazareth durch die an der Eucharistiezeremonie teilnehmenden NATO-Offiziere mit ihren Militärbischöfen verhöhnt wurde. Torres, der die deutsche Sprache beherrschte, blieb dem Hetzchor des aus Schlesien kommenden, als „Arbeiterpater“ angepriesenen Jesuiten Johannes Leppich SJ (1915–1992) fern. Der deutsche Jesuit Gustav Gundlach SJ (1892–1963) polemisierte in diesen Jahren im Einvernehmen mit Papst Pius XII. (1876–1958) gegen das „Friedensgetue kommunistischer Friedensfreunde“. Die „Eucharistie“ (Danksagung)-Feier mit der Schlussfolgerung „Ite, missa est!“ hatte für Torres einen christlichen Sinn und nicht jenen der Hinführung zum Krieg nach innen und außen.
1962 solidarisierte sich Torres mit streikenden Studenten und wurde trotz seiner Absetzung als Studentenpfarrer durch Kardinalerzbischof Concha von diesem zum Vertreter der Kirche im „Columbianischen Institut für gesellschaftliche Agrarreform“ ernannt. Als einer der Wortführer der unterm 17. März 1965 in Medellín veröffentlichten „Plattform der Volksfrontbewegung“ mit ihren konkreten Zielen gab es für Torres kein Zurück mehr. Hauptziel der sich in Aktionskomitees organisierenden Plattform war die „Vereinigung des kolumbianischen Volkes“ durch eine Bewegung ohne „Cliquenwirtschaft, Demagogie und Personenkult“. Zu deren konkreten Zielen gehörte eine Bodenreform mit der Prämisse: „Das Land soll denen gehören, die es mit eigenen Händen bearbeiten. Die Regierung ernennt Beamte, die den Landarbeitern, welche diese Bedingungen erfüllen, Land übertragen“: „Aller Grund und Boden, welcher für das Gemeinwohl notwendig erscheint, wird ohne Entschädigung enteignet“.
Der Blick von Camilo Torres auf die Frauen in der kolumbianischen Gesellschaft
Isabel Restrepo war als Mutter von Camilo Torres in Kuba von Fidel Castro (1926–2016) mit ehrenvollem Respekt aufgenommen und von ihm persönlich besucht worden. Cardenal erinnert sich an sein Gespräch mit Isabel Restrepo, die ihm sagte: „Ich liebe diese Revolution. In Kuba liebt man meinen Sohn, und Liebe erzeugt Gegenliebe“. Anfang Februar 1968 hat Isabel Restrepo bei einem „Lateinamerikanischen Treffen Camilo Torres“ in Montevideo auf der dortigen Universität wie vier Jahre zuvor Celia de la Serna y Llosa (1906–1965) als Mutter von Che Guevara (1928–1967) alle Mütter aufgerufen, ihre Söhne zum revolutionären Kampf zu erziehen. Isabel Restrepo erinnert an die spanische Revolutionärin Dolores Ibárruri (1895–1989), La Pasionaria, die ihren einzigen, in der Roten Armee gegen die deutschen Völkermörder kämpfenden Sohn Rubén Ruiz in der Schlacht von Stalingrad verloren hat.
Wunderschön ist der „Aufruf an die Frauen“ von Camilo Torres (Bogotá, im Oktober 1965), der als Interpretation der Schluss-Strophen des Dreigroschenfilms von Bertolt Brecht (1898–1956) gelesen werden kann: „Denn die einen sind im Dunkeln / Und die andern sind im Licht. / Und man siehet die im Lichte / Die im Dunkeln sieht man nicht.“ Der Jesuitenpater Martin Maier (*1960) von der Bischöflichen Aktion Adveniat in Essen hat an diese Worte des herausragenden Marxisten erinnert, um die Haltung von Papst Franziskus (*1936) zu den Frauen zu verdeutlichen. Dieser verurteilte scharf den Missbrauch von Frauen durch die katholische Kirche wie besonders in Afrika und sagte am 1. Jänner 2022 mit Hoffnung: „Die Mütter und Frauen blicken nicht auf die Welt, um sie auszubeuten, sondern um ihr Leben zu schenken“. Camilo Torres sieht die Rechtlosigkeit der Frauen „aus dem einfachen Volk“, die Frau des Arbeiters hatte keinen sozialen oder rechtlichen Schutz. Das war in allen kapitalistischen Ländern so. Ja, selbst die Priester predigten in den Kirchen die Unterlegenheit der Frauen, die bei der kirchlichen Eheschließung ihren Männern Gehorsam schwören mussten. Das den kolumbianischen Frauen von der herrschenden Minderheit gegebene Wahlrecht ändere nichts an der Situation, vielmehr könne diese „die Frauen weiterhin als ihr politisches Instrument gebrauchen. Aber die kolumbianische Frau besitzt Werte und Menschenwürde, sie ist nicht einfach Instrument. Die kolumbianische Frau sieht, dass sie nicht nur von den herrschenden Kreisen ausgebeutet wird wie die Mehrheit der Kolumbianer, sondern auch vom Mann. […] Da die Frauen über die Kraft der Intuition verfügen, haben sie schnell durchschaut, wie ihre Männer mit Wahlzetteln betrogen und von Machtkämpfen hinters Licht geführt wurden“. Torres ist überzeugt davon, dass die kolumbianische Frau sich auf die Revolution vorbereitet: „Sie ist immer die eigentliche Stütze des Revolutionärs gewesen, und sie wird es bleiben. Sie muss das Herz der Revolution sein“.
Vom Sehen zum Urteilen und zum Handeln. Camilo Torres geht in die Berge
Aus der kolumbianischen Kirche heraus wurde Torres als „Judas“ denunziert. In seinem offenen Brief vom 22. Juni 1965 schreibt ein Pater Hernando Barrientos, dass Torres, der die Revolution predige, sein Priestergewand ablegen müsse: „Wenn er Laie wäre, könnten wir seine Gedanken analysieren, ohne Abscheu darüber empfinden zu müssen, dass wir einen Judas richten“. Aber wer ist Judas? Nach biblischer Überlieferung war er einer der zwölf Apostel und hat Jesus ausgeliefert. Judas war aber auch, wie Georg Sporschill SJ (*1946) zum Nachdenken anregt, „der Einzige der Jünger, der mit Jesus aus dem Abendmahlssaal hinaus in die Nacht (nach der Bibel ist es die Nacht der Befreiung) gegangen und seinem Herrn schließlich im Tod am nächsten gekommen ist“. Die Erzählung von Judas zwinge dazu, so Sporschill SJ, Vorurteile zu hinterfragen und den Kampf mit dem Bösen aufzunehmen. Die klerikale Kirche in Kolumbien fühlte sich aber nicht von Torres herausgefordert, sie machte es sich einfach und dämonisierte ihn als einen Priester, in den der Satan gefahren sei.
Camilo Torres war als Priester der katholischen Kirche an seine Grenzen gestoßen. Die gesellschaftliche und menschliche Misere in Kolumbien war mit Predigten nicht zu ändern. Für Torres bedeutete die Theologie konkrete gesellschaftliche Praxis. Caritas war ihm zu wenig, weil sie die Ursachen der Notwendigkeit solcher Caritas nicht beseitige. Am 20. März 1965 wurde Torres aus dem kirchlichen Dienst entlassen, Kardinalerzbischof Concha lehnte die Volksfront-Erklärung als ketzerisch ab und forderte am 18. Juni 1965 die Katholiken auf, dem in Laienstand versetzten Torres nicht nachzufolgen. Torres blieb aber, wie er selbst sagte, „Priester“: „Ich glaube, aus Nächstenliebe habe ich mich der Revolution verschworen. Ich habe es aufgegeben, die Messe zu lesen, um in der Lage zu sein, den Nächsten zu lieben auf dem irdischen Feld der Wirtschaft und der sozialen Spannungen. Wenn mein Nächster nichts mehr gegen mich hat, wenn die Revolution durchgekämpft ist, dann will ich wieder die Messe lesen, falls Gott es so haben will. […]“.
Der österreichische Botschafter in Bogotá positioniert sich im Einvernehmen mit dem österreichischen Außenministerium gegen die Befreiung des kolumbianischen Volkes
Wie schätzte der in Bogotá residierende Botschafter der neutralen Republik Österreich Dr. Hans Josef Mathé die Situation in Kolumbien zu Anfang des Jahres 1965 ein? Hans Josef Mathé (*1927), geboren in Wien, hat nach der Matura am erzkatholischen Wiener Schottengymnasium mit dem Studium an der Wiener Hochschule für Musik begonnen und hat nach einem Aufenthalt am Sussex College das rechts- und staatswissenschaftlichen Studium an der Wiener Universität mit dem Doktorat abgeschlossen. 1956 wurde er in den österreichischen auswärtigen Dienst aufgenommen, war von 1958 bis 1966 Österreichischer Botschaft in Bogotá und vertrat Österreich in der Folge immer wieder in Lateinamerika, in Lima oder in Buenos Aires. 1972 bis 1974 war er Österreichs Vertreter in Tel Aviv, 1979 bis 1982 in Athen, dann wieder in Buenos Aires. Am 8. Jänner 1965 schreibt Mathé an den damaligen Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten Bruno Kreisky (1911–1990) über die Ergebnisse der von ihm feststehenden Infiltration durch Fidel Castro (1926–2016) Kolumbiens:
„Bogotá, am 8. Jänner 1965
Erstes Auftreten einer
kommunistischen ‚Befreiungsarmee‘
in Kolumbien
Herr Bundesminister!
Bereits seit einiger Zeit hörte man hier Gerüchte, dass in Kolumbien eine kommunistische Befreiungsarmee (‚Ejercito de Liberación Nacional‘) nach dem Muster Venezuelas gegründet wurde. Gestern hat nun diese neugegründete Rebellenarmee zum ersten Mal von sich reden gemacht. Eine Gruppe von 120 uniformierten und mit M‑2 Karabinern sowie Madson-Maschinengewehren bewaffnete Rebellen überfielen die im kolumbianischen Departement Santander gelegene Ortschaft Simacota, die ungefähr 230 km von der Hauptstadt Bogotá entfernt ist. Alle Rebellen trugen Armbinden mit der Aufschrift ELN (Ejercito de Liberación Nacional). Nachdem der Gendarmerieposten, bestehend aus drei Gendarmen, die sofort erschossen wurden, besetzt wurde, hielt der Rebellenführer eine Ansprache, wobei die Absetzung der augenblicklichen Regierung gefordert wurde, die lediglich ein Spielzeug der imperialistischen Nordamerikaner wäre. Es folgten übliche gegen das kapitalistische System gerichtete Schmähreden und abschliessend die Aufforderung an die Bevölkerung, bei der Errichtung einer Volksdemokratie in Kolumbien mitzuhelfen. Vor Abzug der Rebellen wurde die Ortschaft noch von diesen vollkommend ausgeplündert. Die gesamte Aktion dauerte etwa zwei Stunden. Als Regierungseinheiten erschienen, war an der Situation nicht mehr viel zu retten. Es konnte nur die Nachhut der ‚Befreiungsarmee‘ angegriffen werden wobei es auf beiden Seiten Tote und Schwerverletzte gab. Flugblätter, die verteilt wurden, kündigten an, dass gegenständliche Aktion der Beginn zahlreicher geplanter Überraschungsakte sei. In den hiesigen Bevölkerungskreisen nimmt man an, dass speziell in der Hauptstadt Bogotá mit Bombenanschlägen nach Muster der venezolanischen FALN gerechnet werden muss. Heute eingelangten Nachrichten zufolge wurden weitere ca. 200 uniformierte Rebellen, ebenfalls im Departement Santander, von der Landbevölkerung gesichtet. Regierungstruppen, die ohnehin bereits gegen die Bandenrepubliken ‚Marquetalia‘ und ‘El Pato‘ kämpfen, werden nun auch in die neue Gefahrzone entsendet werden.
Die Annahme, dass Castro-Leute eine subversive Tätigkeit in Kolumbien zu entfalten begonnen haben, hat sich als erwiesen bestätigt. Man glaubt, dass die Ausbildung der Rebellenführer in Venezuela erfolgte, wo sie ja auf eine jahrelange Praxis zurückblicken können.
Genehmigen Sie Herr Bundesminister, den Ausdruck meiner vollkommenen Ergebenheit.
Mathé m. p.“
Unterm 22. Jänner 1965 beschreibt der österreichische Diplomat Mathé in zwei separaten Briefen (Zahl 2‑POL 65 und Zahl 3‑POL/65) an Außenminister Kreisky die kolumbianischen Verhältnisse mit der ihm eigenen Arroganz des bürgerlichen Europas. Referiert wird nebstbei, wie der US-Imperialismus als europäischer Geschäftspartner mit seinen „In God wie trust“ (Dollar) – Missionen vom Land Kolumbien Besitz ergreift.
„Bogotá, am 22. Jänner 1965
Angespannte Lage in Kolumbien.
Herr Bundesminister!
Nachdem am 1. Januar dieses Jahres in Kolumbien eine Konsumentensteuer für einen Grossteil der Verbrauchsgüter eingeführt wurde, stiegen die Preise unverhältnismässig hoch. Um ihre Unzufriedenheit gegenüber dieser neuen Regelung kundzutun, beschlossen die Gewerkschaften für den 25. Januar dieses J.s den Generalstreik auszurufen. Bemerkenswert hierbei ist, dass die Dauer des Streiks nicht limitiert wurde. In der Aussendung heisst es, ‚auf unbestimmte Zeit‘, wobei die extremistischen Gruppen noch hinzufügten ‚bis zum Sturz der Regierung‘. Während der vergangenen Tage haben Kommunisten Flugblätter verteilt, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, bei der Errichtung einer Volksdemokratie mitzuhelfen. Man befürchtet allgemein, dass die extremistischen Gruppen aus der Situation Nutzen ziehen könnten, um tatsächlich die Regierung zu stürzen. Der Generalstreik könnte der Tropfen sein, der das Glas zum Überlaufen bringt.
Unter der Bevölkerung herrscht schon seit Langem eine stets wachsende Unzufriedenheit gegenüber der Regierung. Selbst die Beamtenschaft spricht sich bereits offen gegen Staatspräsident Valencia aus. Wie mir vor einigen Tagen ein leitender Beamter des hiesigen Aussenministeriums erklärte, stellen die amerikanischen Missionen in Kolumbien eine Lawine dar, die nicht zum Stehen gebracht werden kann. Die Zahl der Missionsmitglieder steigt von Tag zu Tag, wobei die US-Regierung Kolumbien dazu verhalten hat, ein Abkommen zu unterzeichnen, wonach sämtlichen Mitglieder die diplomatischen Privilegien zur Gänze gewährt werden. Im Folgenden werden die grössten der hier etablierten Missionen angeführt: Militärmission, Luftwaffenmission, Marienmission, Technische Mission, Wirtschaftsmission, Mission Rockefeller, Mission Care Friedenskorps, Landwirtschaftsmission, geodäsische Mission, Finanzmission, Mission für Entwicklungshilfe, etc. Staatspräsident Valencia hat vor Kurzem ein neues Abkommen unterzeichnet, welches nun auch den Vertragsangestellten dieser Missionen diplomatische Vorrechte garantiert. Demzufolge befinden sich nun tausende US-Staatsbürger in Kolumbien, denen diplomatische Immunität gewährt wird. Ausser den Ministerien gibt es hier kaum mehr eine offizielle Stelle, in der keine Nordamerikaner Dienst versehen. Es ist klar, dass diese Art technischer Hilfe von den Kolumbianern als nordamerikanische Bevormundung empfunden wird und dadurch heutzutage viele nichtkommunistische Elemente anti-nordamerikanisch eingestellt sind.
Die kolumbianischen Generäle und unter deren Leitung die gesamte Armee, warten nur auf einen günstigen Augenblick, um die Macht an sich zu reissen. Ihnen gegenüber stehen die kommunistischen Einheiten und Rebellen, die auf den Sturz der Regierung hinarbeiten.
Angesichts dieser ernsten Situation hat nun gestern der kolumbianische Staatspräsident in einer Rundfunkrede an das Volk einen Appell gerichtet und verzweifelt um deren Solidarität zur Regierung gebeten. Nachstehend werden einige Auszüge dieser Rede wiedergegeben.
Präsident Valencia schilderte einleitend die innenpolitische Situation in Kolumbien als sehr delikat, kritisch und kompliziert. Die von der Regierung genehmigten Lohnerhöhungen zögen grosse Preiserhöhungen nach sich, die wiederum eine neue Lohn-Preis-Politik zur Folge hätten. Die Einführung der Konsumentensteuer war daher unabwendbar. Unerwarteterweise hat aber diese Konsumentensteuer die gegenwärtige Regierung in eine sehr ernste Lage gebracht. Die Regierung studiert augenblicklich eine Lösung dieses Problems. Aus diesem Grunde werden alle im Lande verfügbaren Kräfte gebeten, gegen die anwachsende Spekulation zu kämpfen. Die Bevölkerung wird ersucht, in dieser schicksalsschweren Stunde der Regierung Beistand zu leisen. Trotzdem erscheinen die Forderungen der Gewerkschaften, im Besonderen die Forderungen der linksgerichteten, als unannehmbar. Es wurden die Minister für Justiz, Handel, Finanzen, Arbeit und Bergbau beauftragt, sofortigen Kontakt mit den zuständigen Gewerkschaftsführern aufzunehmen. Sollten hierbei die verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte der Gewerkschaften überschritten werden, so würde das Land einer der blutigsten und gewalttätigsten Revolutionen entgegengehen. Die Gewerkschaftsführer würden bald erfahren, dass sie durch aussenstehende, linksextremistische Elemente verdrängt werden, welche ausschliesslich Mord, Brand und Plünderung am 25. Januar zum Ziel haben. Offensichtlich haben sich die im Lande agitierenden Banden nun auch in den Städten festgesetzt. In den verteilten Flugblättern der Extremisten wird offen zur Vernichtung aller nordamerikanischen Dienststellen in Kolumbien, zur Besetzung der Post, des Telefon- und Telegraphenamtes aller Radiostationen sowie zum tätlichen Widerstand gegen Regierungstruppen aufgefordert. Der Kriegsminister versprach jedoch, die Armee gegen die Streikenden in Einsatz zu bringen. Abschliessend führte der Staatspräsident aus: ‚Eher will ich mich opfern, als das Land in Unehre zu bringen und zu kapitulieren. Lasst uns in dieser schwierigen und bitteren Stunde Kolumbien retten. Ich rufe das kolumbianische Volk zur Schlacht des Friedens auf!‘.
Hier akkreditierte südamerikanische Botschafter bezeichneten die Lage als alarmierend, während erfahrene europäische Botschafter zwar einen Regierungssturz nicht ausschliessen, jedoch keine Revolution befürchten. Jedenfalls kann gesagt werden, dass die augenblickliche Regierung aus dem geplanten Aufstand bestenfalls noch mit einem blauen Auge davonkommen kann, was ihr zur Warnung dienen dürfte, ihren politischen Konzepten in Zukunft einen anderen Kurs zu widmen.
Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den Ausdruck meiner vollkommenen Ergebenheit.
Mathé m. p.
„Bogotá, am 22. Jänner 1965
Bestrebungen des Ostblocks
zur Aufnahme diplomatischer
Beziehungen mit Kolumbien.
Herr Bundesminister!
Wie bekannt, bestehen seit 1949 keine diplomatischen Vertretungsbehörden des Ostblocks in Kolumbien. Von Konsularämtern unterhält lediglich die Tschechoslowakei ein Berufs-Generalkonsulat in Bogotá. In letzter Zeit haben jedoch verschiedene Ostblock-Missionen in Kolumbien versucht, einen Kontakt mit der kolumbianischen Regierung aufzunehmen. Als Vermittlers dieser Bestrebungen bemüht sich das CSSR-Generalkonsulat die kolumbianische aussenpolitische Kommission dazu zu bewegen, der Eröffnung einer tschechischen Botschaft in Bogotá zuzustimmen. Kürzlich befand sich hier auf der Durchreise einer sowjetischen Handelsmission, die auffallend viel Kontakt zu den hiesigen Gewerkschaftsführern aufnahm und mittels dieser die Errichtung einer russischen Botschaft zu erreichen suchte. Am aktivsten kann man jedoch die deutschen Ostzonenleute in Kolumbien bezeichnen. Nach mühseligen Interventionen gelang es ihnen, vor ca. anderthalb Jahren hier eine ostdeutsche Handelsdelegation zu etablieren, deren Erfolg anlässlich der letzten internationalen Messe von Bogotá zur Abberufung des Botschafters der Deutschen Bundesrepublik von Kolumbien zur Folge hatte. Nach dem Gelingen dieses ersten Schrittes hat nun diese ostzonale Handelsdelegation bei zahlreich von dieser veranstalteten Empfängen und Abendessen eine Unterschriftensammlung durchgeführt und, wie mir gestern vom Präsidenten der Repräsentantenkammer versichert wurde, bereits über die Hälfte der Unterschriften der kolumbianischen Repräsentanten zugunsten eines Antrags, konsularische Beziehungen zum Pankow-Regime aufzunehmen, erlangen können. Wie mir ein Funktionär des hiesigen Aussenministeriums erklärte, beginnen nun die Ostzonenleute, dieselbe Praxis mit den Mitgliedern des Senats auszuüben. Dass die kolumbianische Regierung einer Kongressvorlage, die von der Mehrheit der Mitglieder beider Kammern unterstützt wird, wahrscheinlich nachgeben muss, steht ausser Zweifel. Schliesslich hat der aussichtsreichste zukünftige Präsidentschaftskandidat Kolumbiens, Dr. Carlos Lleras Restrepo, in einem Interview erklärt, dass er nach einer eventuellen Wahl seiner Person sofort diplomatische Beziehungen mit den Ostblockstaaten aufnehmen würde.
Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den Ausdruck meiner vollkommenen Ergebenheit.
Mathé m. p.
Camilo Torres ruft Christen und Kommunisten auf, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Als Kämpfer der Nationalen Befreiungsarmee fällt er am 15. Februar 1966
Die revolutionäre Situation in Kolumbien spitzte sich im Frühjahr 1965 zu. Im März 1965 war Harold Eder (1903–1965), ein früherer Minister der Militärjunta des Generals Gustavo Rojas Pinilla (1900–1975) und als Zuckerfabrikant einer der Reichen des Landes, von Aufständischen entführt und getötet worden. Am 5. Mai 1965 (Zl. 8‑Pol/65) schreibt Botschafter Mathé mit dem Betreff „Panikstimmung in Kolumbien“ nach Wien:
„Während der vergangenen Wochen erhielten alle begüterten Kolumbianer von der kommunistischen ‚Befreiungsarmee‘ eine Zuschrift, in welcher sie aufgefordert werden, eine bestimmte Summe zugunsten der Rebellenbewegung zu stiften, ansonsten, im Weigerungsfalle, mit der Verschleppung zu rechnen wäre. […] Erstaunlich ist, dass die Regierung bisher keinen dieser Führer der sogenannten Befreiungsarmee ergreifen konnte. In Kolumbien hat eine Panikstimmung eingesetzt. Hunderte Personen, darunter auch viele Ausländer, verlassen täglich das Land aus Angst vor den angedrohten Repressalien der Kommunisten. […] Wie mir der Leiter der politischen Abteilung des hiesigen Außenministeriums erklärte, befindet sich die Regierung seit 3 Tagen in Geheimsitzungen. Es wird hierbei erwogen, ob an den Rat der amerikanischen Staaten (OAS) oder an die Vereinten Nationen appelliert werden soll. Nachdem Kuba erwiesenermaßen an der augenblicklichen Lage die Schuld trägt, wurden sogar Stimmen laut, Kuba, ohne Rücksicht auf Konsequenzen, den Krieg zu erklären. Der hiesige amerikanische Botschafter versicherte, dass die Vereinigten Staaten im Ernstfall Truppen schicken würden. Das sofortige Eingreifen der Nordamerikaner in Santo Domingo soll den augenblicklichen Krisenherden auf dem amerikanischen Kontinent als moralische Stütze dienen“.
Camilo Torres war kein „diplomatischer“ Beobachter, sondern Theologe der revolutionären Praxis. Sein „Aufruf an die Christen“ vom 3. August 1965 ist kompromisslos: „Die politischen, religiösen und sozialen Erschütterungen der letzten Zeit haben ohne Zweifel viel Verwirrung unter den kolumbianischen Christen gestiftet. Es ist notwendig, dass wir Christen in diesem entscheidenden Augenblick unserer Geschichte festhalten an den Grundwahrheiten unserer Religion. Das entscheidende Element am katholischen Glauben ist die Liebe zum Nächsten. ‚Wer den Nächsten liebt, der erfüllt das Gesetz‘ (Röm 13, 8). Damit diese Liebe wahr und echt sei, muss sie wirksam werden. Wenn Wohltätigkeit, Almosen, wenige Schulen für Kinder aller Schichten, ein paar Wohlfahrtsprogramme, kurz all das, was man ‚Mildtätigkeit‘ nennt, nicht ausreicht, den meisten Hungernden zu essen zu geben, die meisten Nackten zu kleiden, die meisten Unwissenden zu unterrichten, dann müssen wir wirksamere Maßnahmen einleiten, um das Wohl der Mehrheit sicherzustellen. […] Deshalb ist es unumgänglich, der privilegierten Minderheit die Macht zu entreißen und sie den vielen Armen zu übertragen. […] Nach der Revolution werden wir Christen sagen können, dass wir ein System errichtet haben, in dem die Liebe zum Nächsten oberster Grundsatz ist. Der Kampf wird lang sein, lasst in uns heute schon beginnen…“.
Ein Monat nach seinem „Aufruf an die Christen“, der für Teile der 1968er studentischen Jugendbewegung als ein Schüsseltext rezipiert wurde, appelliert Torres an die bis dahin von der katholischen Kirche weltweit als satanische Klassenkämpfer gemeinsam mit der kapitalistischen Herrschaft verfolgten Kommunisten für das gemeinsame Zusammengehen. Er konnte sich dabei auf die inmitten des Kalten Krieges hoffende und utopische Enzyklika „Pacem in terris“ (11. April 1963) von Papst Johannes XXIII. (1881–1963) berufen, einem Papst, der als Christ versucht hat, die klerikale Kirche aus ihrem unheilbringenden Bündnis mit den reichen Eliten zu befreien. Torres schreibt (2. September 1965): „Ich habe gesagt, dass ich Revolutionär bin, und ich bin dies als Kolumbianer, als Soziologe, als Christ und als Priester. Ich glaube, dass die Kommunistische Partei echte revolutionäre Elemente in sich birgt, und deshalb kann ich nicht Anti-Kommunist sein, weder als Kolumbianer noch als Soziologe, weder als Christ noch als Priester. […] Ich habe nicht die Absicht, unter den Kommunisten, meinen Brüdern, Anhänger zu werben und auf sie einzuwirken, das Dogma und den Kult der katholischen Kirche anzunehmen. Worauf es mir ankommt, ist, dass alle Menschen ihrem Gewissen folgen, ehrlich die Wahrheit suchen und in wirksamer Weise den Nächsten lieben. Die Kommunisten dürften sehr genau wissen, dass ich nicht daran denke, jemals in ihre Partei einzutreten, dass ich niemals Kommunist werde, weder als Kolumbianer noch als Soziologe, weder als Christ noch als Priester. Dennoch bin ich entschlossen, um gemeinsamer Ziele willen an ihrer Seite zu kämpfen: gegen die herrschende Minderheit und gegen den Einfluss der Vereinigten Staaten für die Machtergreifung durch das Volk“.
Am 18. Oktober 1965 reiht sich Torres als aktiver Kämpfer in die Reihen der Nationalen Befreiungsarmee ein. „Aus den Bergen“ wendet sich Torres im Jänner 1966 in seinem letzten Aufruf an die Kolumbianer:
„Kolumbianer, seit vielen Jahren warten die Armen in diesem Land auf das Zeichen zum entscheidenden Kampf gegen die herrschende Minderheit. Wenn der Masse das Wasser bis zum Hals stieg, hat es die herrschende Klasse immer wieder verstanden, die Leute zu betrügen, sie von ihrem Elend abzulenken und sie mit neuen Sprüchen zu vertrösten, die immer auf dasselbe hinauslaufen: Leiden für die breite Masse und Wohlergehen für die privilegierte Klasse. […] Jetzt glaubt das Volk kein Wort mehr. Es glaubt nicht mehr an die Wirksamkeit von Wahlen. Es weiß, dass die gesetzlichen Mittel, demokratische Zustände herbeizuführen, erschöpft sind. Es bleibt mithin nur noch die Gewalt. Die Leute sind verzweifelt und daher entschlossen, ihre Leben hinzugeben, damit die nächste Generation der Kolumbianer vor einem Sklavendasein bewahrt wird. […] Der Kampf des Volkes muss sich zu einem nationalen Befreiungskrieg ausweiten. Der Weg zum Sieg wird lange sein, deshalb sind wir schon aufgebrochen. […] Nicht einen einzigen Schritt zurück … Freiheit oder Tod“.
Camilo Torres wurde mit seiner Entscheidung, sich bewaffnet an der Befreiung des von einer Minderheit erbarmungslos unterdrückten und ausgebeuteten Volk zu beteiligen, zu einem Märtyrer der „Befreiungstheologie“. Diese wurde als Sammelbegriff mit den an den Menschenrechten zur Befreiung von jeder Form der Ausbeutung ausgerichteten Schriften des die humanistische Praxis des Dominikaners Bartolomé de Las Casas (1484–1566) aufgreifenden peruanischen Dominikaners Gustavo Gutiérrez (1928–2024) verbreitet. Wegen ihrer gelebten „Option für die Armen“ wurden in El Salvador am 24. März 1980 Óscar Romero (*1917) und am 16. November 1989 die Jesuiten Ignacio Ellacuría SJ (*1930), Ignacio Martín-Baró SJ (*1942), Segundo Montes Mozo SJ (*1933), Amando López Quintana SJ (*1936), Joan Ramón Moreno Pardo SJ (*1933) und Joaquín López y López SJ (*1918) sowie die beiden anwesenden Frauen Elba Julius Ramos (*1947) und Celina Marisela Ramos (*1974) im Einvernehmen mit dem US-Imperialismus erschossen. Der durch seine Abwesenheit überlebende Confrater Jon Sobrino SJ (*1938) hat immer wieder an das aktive Denken dieser und anderer Befreiungstheologen erinnert und wurde deshalb vom deutschen Vatikaninquisitor Joseph Ratzinger im Interesse des Reichtums klerikal sekkiert.
Der österreichische Botschafter in Bogotá berichtet über die Situation in Kolumbien und den Tod des „abtrünnigen“ Priesters Camilo Torres zu Anfang des Jahres 1966.
Seinen ersten politischen Bericht aus Bogotá an Außenminister Bruno Kreisky im Jahre 1966 schreibt der österreichische Botschafter Mathé am 24. Februar 1966. Unverhohlen ergreift dieser österreichische Botschafter Partei für die herrschenden Kräfte. Camilo Torres wird mit unverhohlenem Hass als „einer der geistigen Führer der hiesigen kolumbianischen Agitation“ herausgestellt und fortschrittliche Kräfte, welche die kapitalistischen Herrschaftsstrukturen in Lateinamerika hinterfragen, kriminalisiert.
„Afro-asiatisch-lateinamerikanische
Volks-Solidaritäts Konferenz (Tricontinental
Conference) in La Habana
Januar 1966 von kolumbianischer Warte
aus gesehen.
Herr Bundesminister!
Wie der kolumbianische Expräsident Alberto Lleras Camargo erklärte, befindet sich Lateinamerika augenblicklich mit Cuba praktisch im Kriegszustand. Die cubanische Regierung unterstützt die auf dem südamerikanischen Kontinent agitierenden Terroristen und Guerilla-Gruppen, was im vergangenen Jahr nachgewiesen werden konnte. Obwohl die hiesige Presse, abgesehen von den Routinemeldungen der United Press ansonsten die Solidaritätskonferenz ignorierte und sich auch jeglichen Kommentars enthielt, erklärten mir befreundete kolumbianische Parlamentarier, dass die Habana-Konferenz die 1945 in Bandung gegründete und anfänglich neutrale afro-asiatische Organisation für ihre Zwecke ausnützte, indem sie dieser Organisation den amerikanischen Kontinent anschliessen möchte und darüber hinaus die gesamte Organisation für die Verbreitung der kommunistischen Agitationstätigkeit in Lateinamerika einspannen will. Nach kolumbianischer Auffassung war das Hauptziel dieser Zusammenkunft, neues Leben in die lateinamerikanische Subventionstätigkeit hineinzubringen und vorerst die in diesem Kontinent bestehenden kommunistischen Geheimorganisationen in Kontakt mit den kommunistischen Parteien anderer Erdteile zu bringen. So fungierte als Vizepräsident der Tagung der Chef der sogenannten venezolanischen Befreiungsfront ‚FALN‘. Diese ‚Frente de Liberación Nacional‘, die sich ursprünglich nur auf das venezolanische Territorium erstreckte, hat seit geraumer Zeit (wie ich auch diesbezüglich seinerzeit berichtete) ihre Tätigkeit auch in Kolumbien entfaltet, sodass die Kolumbianer mit Besorgnis die De-Facto-Anerkennung dieser gefürchteten Banditen- und Terrororganisationen seitens des kommunistischen Lagers zur Kenntnis nahmen Wie der ‚Chef‘ der Befreiungsfront hierbei erklärte, beabsichtigt er eine Neuorganisation seiner Terrorgruppe.
Seit Beendigung der Konferenz ist auch eine verstärkte Bandentätigkeit in Kolumbien zu verzeichnen. Hierbei wurde vor einigen Tagen einer der geistigen Führer der hiesigen kommunistischen Agitation, Camilo Torres, ein junger abtrünniger Pfarrer, von Seiten seiner eigenen Anhänger geopfert. Während einer von den Bandoleros inzitierten Schlacht gegen Regierungstruppen zogen sich plötzlich die Guerilleros zurück und hinterliessen am Schlachtfeld Camilo Torres, begleitet von vier seiner Gefolgsleute, zurück. Er wurde hierauf sofort von den Soldaten erschossen. Gerüchte wollen wissen dass dies auf die Beschlüsse der ‚Conferencia Tricontinental‘ zurückgeht, wo man mit der Anschauung des Expriesters Torres nicht übereinstimmte. Der für Kolumbien in Cuba gefasste Plan sieht in seiner ersten Etappe vor, die nichtkommunistischen Bandoleros, die hier zu Tauenden ihr Unwesen treiben, unter gemeinsamer kommunistischer Leitung zu bringen.
Da in Habana unter anderem beschlossen wurde, die subversiven Agitationen in Guatemala, der Dominikanischen Republik, Venezuela, Peru und Kolumbien, mittels eines grossangelegten Finanzierungsplanes zu unterstützen, wofür auch ein Spezial-Subkomitee gebildet wurde, liegt nun die kommunistische Führung für die genannten Staaten in ‑Cuba. Die Ankündigung, dass jede revolutionäre Bewegung mit der bedingungslose Hilfe durch Cuba rechnen könne, sowie die Ausweitung dieser Ankündigung seitens der Sowjetunion, dass dies ganz speziell für die vorher genannten Länder gelte, hat eine heftige Reaktion unter den betroffenen Staaten ausgelöst, welche an die Organisation amerikanischer Staaten (OEA) appellierten, geeignete kollektive Mittel gegen die beabsichtigten Interventionen Cubas anzuwenden und die Haltung der Sowjetunion im gegenständlichen Fall unter Anwendung der diesbezüglichen Klausel des Vertrages von Rio de Janeiro (Interventionsverbot) zu verurteilen. Bezüglich Cuba wurden bereits durch die ‚Carta de Bogotá‘ und die abgeschlossenen gegenseitigen Hilfsaktionen sämtliche friedliche Mittel zur Abwehr unternommen: Abbruch der Beziehungen, Ausstoss aus der OEA, wirtschaftlicher Boykott, Ächtung des Systems usw., sodass nur die Anwendung offener Gewalt übrig bleibt, was jedoch vermieden werden soll.
Die anlässlich der Konferenz in Punta del Este im Jahre 1962 ins Leben gerufene interamerikanische Konsultativversammlung erwägt augenblicklich geeignete Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor möglichen Konsequenzen aus der Konferenz von Habana zu treffen.
Unerwartet scharf reagierte Kolumbien auf die Teilnahme der VAR [Vereinigte Arabische Republik] in Habana. Wie der kolumbianische Staatspräsident Valencia erklärte, bilden sowohl die Teilnahme der Vertreter Nassers als auch insbesondere die Solidarität, die diese zu den gefassten Resolutionen bekundeten, und vor allem die überbrachten Grussbotschaft einen Bruch des interamerikanischen Prinzips der Nichteinmischung. Die vorgebrachten Beschwichtigungen des hiesigen Geschäftsträgers der VAR, in denen auf den rein privaten Charakter der ägyptischen Delegierten hingewiesen wurde, hat Kolumbien nicht akzeptiert, sondern hierzu bemerkt, dass erstens die Grussbotschaft persönlich von Nasser abgefasst worden war und gleichzeitig in dieser der Wunsch zum Ausdruck gebracht wird, die nächste Konferenz 1968 in Kairo abzuhalten, zweitens, dass die ägyptischen Delegationsmitglieder zum Grossteil staatliche Funktionäre waren, und drittens, dass der Generalsekretär und vorbereitende Beauftragte der Habana-Konferenz ein Ägypter war. Staatspräsident Valencia ersuchte den kolumbianischen aussenpolitischen Ausschuss, die Möglichkeit eines Abbruches der Beziehungen Kolumbiens zur VAR zu prüfen. Wenn auch in hiesigen diplomatischen Kreisen diese Möglichkeit als sehr unwahrscheinlich betrachtet wird, haben sich dennoch zumindest die bisher sehr herzlichen Beziehungen Kolumbiens zur VAR merklich abgekühlt.
Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den Ausdruck meiner vollkommenen Ergebenheit
Mathé m. p.“
Der Nachfolger von Botschafter Mathé in Bogotá war der Diplomat Herbert Grubmayr (*1929), dessen Ein- und Ausblicke sich in nichts von jenen seines Vorgängers unterscheiden. In seinem Bericht vom 3. September 1971 (Zl. 10-Pol/71) über den Staatsbesuch des freigewählten sozialistischen Präsidenten Chiles Salvador Allende (1908–1973) in Kolumbien (28. August bis 1. September 1971) kommt der Absolvent der Wiener Universität und Karrierediplomat Grubmayr auf die „linksextreme Priestergruppe der Golconda“ zu sprechen, „welche die Tradition des Exgeistlichen und Exguerilleros Camilo Torres weiterführt“. Salvador Allende wurde am 11. September 1973 im Einvernehmen mit den USA von General Augusto Pinochet (1915–2006) gestürzt, in der Folge wurden 30.000 Menschen getötet, 100.000 Menschen wurden inhaftiert und etwa 1 Million Einwohner flüchteten in die Emigration.
Für die Jugend der Deutschen Demokratischen Republik wird das Buch von Germán Guzman über Persönlichkeit und Entscheidung von Camilo Torres verbreitet (1969)
Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) war die Deutsche Demokratische Republik (DDR) an Kolumbien nicht als einem unter der Regie der USA auszubeutendes Neokolonialland interessiert. Die DDR hoffte vielmehr auf die Kraft des kolumbianischen Volkes, sich aus den Fesseln ihrer Herrschaftseliten zu befreien. Zu dieser Hoffnung beigetragen hat das nicht nivellierende, mitlebende Schaffen des aus seinem kolumbianischen Exil als fast Fünfzigjähriger in die DDR übersiedelten Literaten und Nachdichters spanischer und lateinamerikanischer Autoren Erich Arendt (1903–1984). Über das „Tropenland Kolumbien“ hat Arendt mit eigenen Fotos 1954 einen Bildband herausgegeben. Sein 1956 publiziertes Büchlein „Tolú. Gedichte aus Kolumbien“ war in der DDR weit verbreitet. Über den gescheiterten Bogotáner Volksaufstand im April 1948 schreibt er, wie das Volk durch den „schamlosen Verrat seiner liberalen Führer“ wieder ausgeliefert war „an die alten Mächte: an die Besitzgier und Grausamkeit der Privilegierten, an das Machtgelüst einer Kirche, die seit den Tagen der Conquista das Totentuch der Furcht und des Aberglaubens über das Leben spann“. Jaime Angulo Bossa (1924–2012) gab als Mitglied einer ersten Parlamentarierdelegation aus Kolumbien in der DDR dem „Neuen Deutschland“ am 24. Mai 1959 ein Interview, in dem er hervorhob, dass man auch in Kolumbien nicht mehr von „Deutschland“ schlechthin spreche, „sondern von zwei deutschen Staaten, von denen einer den Militarismus für immer beseitigt und eine friedliche Ordnung errichtet hat, in der die großen Talente des deutschen Volkes nicht mehr für einen Angriffskrieg missbraucht werden, sondern im Dienste des Humanismus stehen“.
Den kolumbianischen Priester Germán Guzman Campos (1912–1988) verband eine tief empfundene Hochachtung mit Camilo Torres, mit dem er in Bogotá 1961 bis 1965 wissenschaftlich zusammengearbeitet hat, zumal er sich mit der Ausbreitung der Gewalttätigkeit in Kolumbien befasste. Anfang Oktober 1966 war Guzman in Berlin beim VI. Kongress der Internationalen Organisation der Journalisten (IOJ) und gab dem Zentralorgan der Christlich-Demokratischen Union (CDU) Deutschlands „Neue Zeit“ ein Interview: „Ich möchte ganz klar sagen, dass das Bild eines sozialistischen Landes, das man uns in Kolumbien zeichnet, ein Zerrbild ist. Die umfassende Freiheit des Volkes und die große Herzlichkeit des Empfanges haben mich sofort beeindruckt. Jetzt erst konnte ich mir ein Bild machen, wie ein neu errichteter Staat aussieht, der in seinem Aufbauwerk den Menschen als Grundlage betrachtet und folglich eine sehr authentische Staatsordnung schafft. Ich sehe, dass hier verschiedene Parteien existieren, aber sie sind alle vereint in dem Ziel, ihr Land aufzubauen“. Über die Begrüßungsrede von Walter Ulbricht (1893–1973) zur Eröffnung des Kongresses am 12. Oktober 1966 sagte Guzman wörtlich: „Seine Worte interpretieren die Denkweise eines Volkes, das die Verständigung mit der übrigen Welt sucht, um Zeugnis abzulegen von einer Freiheit, die keine Lüge ist, von einem Wunsch nach Frieden, der ebenfalls echt ist“. Guzman veröffentlichte 1967 in Bogotá unter dem Titel „Camilo, El Cura Guerillero – Presenci y Destino“ eine mit Blick auf die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen in Kolumbien authentische Biographie, in der Camilo Torres selbst ausführlich mit Auszügen aus Reden und Artikel, mit seinen Aufrufen zu Aktionen der Einheitsfront und Entwürfen für Deklarationen zu Wort kommt.
Im Februar 1968 war Guzman nochmals in der DDR und erklärte in einem „Neue Zeit“-Interview, dass die DDR mit ihrer Gesellschaftsordnung vorbildhaft für das auch in Kolumbien zu „erstrebende Ziel aller Ausgebeuteten und Unterdrückten ist“. Ausdrücklich begrüßte der Priester German Guzman den Besuch der beiden hochrangigen Volkskammermitglieder der DDR Johannes Dieckmann (1893–1969) und Heinrich Toplitz (1914–1998) in Kolumbien und die Gründung des DDR-Instituts „Kolumbianisch-Deutsche Allianz (DDR)“ in Bogotá. Dieses erfreue sich dort bei Intellektuellen großer Beliebtheit, „gerade angesichts der vom westdeutschen Goethe-Institut betriebenen heftigen, antisozialistischen Propaganda, insbesondere gegen die DDR“.
In der DDR waren besonders die Christdemokraten mit ihrem ab 1966 (bis 1989) amtierenden Vorsitzende Gerald Götting (1923–2015) an der in deutsche Sprache übersetzten Publikation der von Guzman verfassten Biographie von Torres interessiert. Götting wollte der Jugend der Union in der DDR von Beginn an einen christlich sozialistischen Blick nach vorne vermitteln. „Der Christ sagt Ja zum Sozialismus“ hat Götting in seinem im Berliner Union Verlag 1960 herausgegeben Buch begründet. Derselbe Verlag beauftragte für die von Guzman geschriebene Biographie als Gutachter den in der DDR bekannten evangelisch-methodistischen Prediger Carl Ordnung (1927–2012). Dieser, Sekretär des DDR-Regionalausschusses der Christlichen Friedenskonferenz (CFK) hat viel zur Aufklärung beigetragen, was Friedenserziehung bedeutet und vermag, und dass Krieg und Frieden nicht einfach das Ergebnis von Friedenserziehung ist. Die Erziehung zum Frieden muss im Zusammenhang mit wirkungsorientierter Friedenspolitik stehen und könne kein Ersatz für den Friedenskampf sein. Das Nachwort zur deutschen Ausgabe der Torres-Biographie von Guzman hat Otto Hartmut Fuchs (1919–1987), Widerstandskämpfer und jahrelang Vorsitzender Berliner Konferenz europäischer Katholiken, geschrieben.
Das Verlagsgutachten von Carl Ordnung datiert vom 30. September 1968. Der Kontext zur Zielsetzung der DDR wird begründet:
„Die Länder Lateinamerikas sind während der letzten Jahre in wachsendem Maße ins Blickfeld der Bevölkerung unseres Staates getreten. Das hat seinen Grund vor allem im Ausbau unserer Handelsbeziehungen zu diesen Staaten. Im Zusammenhang damit kommt es auch zu einer Vertiefung kultureller und politischer Kontakte. Die Besuchsreise, die eine Volkskammerdelegation unter Leitung des Stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrates und Vorsitzenden der CDU Gerald Götting im Juli dieses Jahres nach Kolumbien, Ecuador und Chile führte, ist ein Beweis dafür.
In der christlichen Bevölkerung der DDR erhält dieses Interesse für Lateinamerika einen besonderen Akzent: es gründet sich vornehmlich auf Nachrichten von der bewussten Teilnahme christlicher Werktätiger und katholischer Priester am nationalen Befreiungskampf der lateinamerikanischen Völker gegen die Vorherrschaft des USA-Imperialismus. Da die Informationen über das Engagement progressiver Katholiken in diesem revolutionären Kampf bisher unzureichend waren, versuchten gewisse, im Dienste antikommunistischer Propaganda stehende ökumenische Kreise mit Hilfe einer falschen Interpretation der lateinamerikanischen Situation christlicher Bürger in unserer Republik in ihrer gesellschaftlichen Grundorientierung negativ zu beeinflussen. Sie stellen beispielsweise die Behauptung auf, dass es einen prinzipiellen Unterschied zwischen der Grundrichtung der gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR und in Lateinamerika gebe. In jenem Kontinent gehe es um eine echte Revolution, wie sie die DDR angeblich nie erlebt habe. Auf diese Weise gelang es, gerade unter den politisch noch schwankenden Theologen, die unter dem Eindruck des mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution begonnenen weltumspannenden revolutionären Wandlungsprozesses auf dem Wege zu einer immer bewussteren Identifikation mit unserem Arbeiter- und Bauernstaat waren, Verwirrung zu stiften. Man trifft heute unter jungen Christen und Theologen nicht wenige, die sich für die Notwendigkeit einer Revolution in Lateinamerika aussprechen, während sie Vorbehalte im Blick auf ein bewusstes Engagement bei der Fortführung unseres revolutionären Entwicklungsprozesses hin zum entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus äußern.
Aus allen diesen Gründen ist die Publikation authentischen Materials über die christliche Beteiligung an der revolutionären Entwicklung in Lateinamerika ein dringendes Gebot – gerade in einer Situation, in der der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus immer härtere Formen annimmt.
Der kolumbianische katholische Priester Camilo Torres stellt eine gewisse Schlüsselfigur in der lateinamerikanischen revolutionären Bewegung und den damit verbundenen ideologischen Auseinandersetzungen unter Christen dar. An seiner Biographie läßt sich deutlich machen, dass die gesellschaftliche Entwicklung in Lateinamerika ein Teil des welthistorischen Entwicklungsprozesses ist, der die Menschheit vom Kapitalismus zum Sozialismus führt. Den jungen Theologen drängte es zur Beschäftigung mit Fragen der Gesellschaftswissenschaft. Das Studium etwa der Probleme einer Agrarreform in Kolumbien veranlasste ihn, sich politisch zu engagieren. Er versuchte, die Einheitsfront aller progressiven Kräfte zu organisieren. Aus einer gewissen Enttäuschung darüber, dass sich der Erfolg seiner Bemühungen nur sehr langsam zeigte, ging er zu einer kämpferischen Partisanengruppe. Er fiel in einem Gefecht dieser Gruppe mit Regierungstruppen am 15. Februar 1966.
[…]
Das wichtigste Charakteristikum des vorliegenden Manuskripts ist seine Authenzität. Dokumentarisch ist es in dreifacher Hinsicht:
a.) Der Autor, der katholische Theologe Prof. Guzman, beschreibt Camilo Torres nicht aus der distanzierten Haltung eines Zuschauers heraus. Er ist ein Kampfgefährte von Torres, der nach dessen Tod einen Teil seines Werkes fortsetzte: er redigierte heute die von Torres begründete Zeitung ‚Einheitsfront‘ (Frente Unido). Prof. Guzman weilte zweimal zu längeren Aufenthalten in der DDR. Vor drei Jahren nahm er am internationalen Journalistenkongress teil. Im Januar 1968 besuchte er auf Einladung einiger gesellschaftlicher Organisationen unsere Republik. In einem Interview mit der ‚Neuen Zeit‘ (7. 2. 68) würdigt er besonders die Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte in der DDR beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. ‚Gerade darin‘, so sagt er, ‚sehe ich die Quelle Ihrer großartigen Erfolge, den überzeugendsten Beweis für die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung, die auch in Kolumbien das erstrebenswerte Ziel aller Ausgebeuteten und Unterdrückten ist‘.
b.) Der dokumentarische Charakter des Manuskriptes zeigt sich vor allem aber darin, dass es auf weite Strecken hin Torres selbst zu Worte kommen lässt. Der Autor hat Gespräche mit Torres aufgezeichnet. Er bringt Auszüge aus Aufsätzen und Reden, in denen Torres über die religiösen und politischen Beweggründe seiner Entscheidungen Auskunft gibt. Er fügt politische Deklarationen von Torres ein, die durch die Klarheit der Sprache und die Überzeugungskraft der Argumente bestechen.
c.) Guzman schreibt keine Biographie im herkömmlichen Sinne. Er lässt das Bild von Torres vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verhältnisse seines Landes entstehen. Dabei lässt er häufig Zeitgenossen, Freunde und Gegner, aus Zeitschriftenaufsätzen, Briefen und anderen Dokumenten ausführlich zu Wort kommen. Auf diese Weise gelingt es ihm die ganze Vielsichtigkeit sowohl von Camilo Torres als auch der kolumbianischen Gesellschaft einzufangen.
Authentizität bedeutet für Guzman niemals Objektivismus. In dem Manuskript werden nahezu alle gesellschaftlichen Grundfragen unserer Epoche behandelt. Die Antworten, die der Autor unter Hinweis auf Torres gibt, sind parteilich: gegen den USA-Imperialismus für eine revolutionäre Umwälzung im Sinne des Sozialismus. Eine zentrale Stellung nimmt die Betonung der Einheit aller progressiven Kräfte und in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Christen und Marxisten ein. Das Manuskript macht überzeugend deutlich, dass diese Einheit die Grundvoraussetzung für den Sieg der revolutionären Volksbewegung ist. Guzman unterstreicht die Kritik, die Torres an anarchistischen Tendenzen unter den Linken übt. Er betont, dass es keine Einheitsfront der progressiven Kräfte ohne die Kommunisten geben könne Er zitiert Torres, der gesagt hat, dass das entscheidende Wort im Blick auf die Revolution ‚niemand anders als die Arbeiter und Bauern sprechen können‘.
Der Autor stellt aber den Entwicklungsgang von Camilo Torres durchaus nicht unkritisch dar. Er distanziert sich beispielsweise von Torres‘ Überschätzung der sog. ‚Nichtorganisierten‘. Er fragt kritisch, ob der Entschluss des Priesters, zu den Guerillas in die Berge zu gehen, nicht übereilt gewesen sei. Selbst dort, wo die Aussagen des Manuskriptes einer letzten – an der modernden Gesellschaftswissenschaft geschulten – Klarheit ermangelt, weisen sie in eine Richtung, in der diese historischen und gesellschaftlichen Einsichten gefunden werden können.
Camilo Torres ging seinen Weg bewusst als Christ und Theologe. Guzman gelingt es, die Beweggründe sichtbar zu machen, die den Theologen zu einem bewussten Engagement im Kampf für nationale Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit geführt haben. Der Autor weist nach, dass ein wesentlicher Grund für die fortschrittliche politische Entwicklung des katholischen Priesters in den Aussagen der Enzyklika ‚Pacem in terris‘ von Papst Johannes XXIII. zu suchen ist. Dass das Leben von Camilo Torres gleichsam eine lebendige Interpretation dieser Enzyklika darstellt, wird für viele christliche Bürger unseres Staates Ansporn und Ermutigung sein. Vor allem die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Marxisten leitete Torres aus dieser Enzyklika ab
Eine Publikation des vorliegenden Manuskriptes kann nur dringend empfohlen werden, weil es a) Hilfe in unserem Kampf gegen die klerikale Variante der imperialistischen Ideologie bietet (Die Gegenüberstellung von Aussagen Camilo Torres‘ mit Texten reaktionärer Geistlicher in manchen Teilen des Manuskriptes ist deshalb so eindrucksvoll, weil sie die Schwäche der klerikalen-reaktionären Position und die Stärke und Überzeugungskraft der Haltung von Torres offenbart). b) Dazu angetan ist, politische Vorbehalte bei noch unentschiedenen Christen zu überwinden. c) Allen bewusst und verantwortlich am Aufbau unserer Gesellschaft mitarbeitenden Christen neue Argumente für ihren Einsatz gibt.“
Das Zweitgutachten gab unterm 24. November 1968 der wissenschaftliche Mitarbeiter und spätere Abteilungsleiter im DDR-Staatssekretariat für Kirchenfragen Horst Hartwig ab.
„German Guzman Campos ist ein Freund des ermordeten Priesters Torres. Als katholischer Publizist, der selbst für die sozialen und politischen Ziele seines Freundes engagiert ist, legt C. eine Fülle authentischer Materialien vor die weit über den biographischen Rahmen hinaus einen Einblick in die sozialen Probleme und Kämpfe Kolumbiens und des lateinamerikanischen Subkontinents vermitteln.
Die in dem vorliegenden Band dargebotenen Fakten allein sind sicher auch für den Nichtkatholiken, für jeden an der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Lateinamerikas interessierten Leser von Wert. Hier werden Probleme der Bündnispolitik dargelegt, nicht aus marxistischer Sicht, aber vom Standpunkt eines um die Einheit aller progressiven Kräfte ehrlich kämpfenden, sich mit den ausgebeuteten Volksmassen verbunden fühlenden progressiven Intellektuellen.
Torres und seine Anhänger wandten sich ausdrücklich gegen jeden Antikommunismus. T. nahm im Interesse der Einigung aller progressiven Kräfte auch Verbindung zu marxistischen Gruppen auf. Ausgeprägt sind die antiimperialistischen Akzente, die sich vor allem gegen die Ausbeutung durch die USA-Monopole und die dadurch bedingte politische Abhängigkeit richten.
T. war ein Anhänger der Revolution. Sein 1965 erfolgter Übertritt zu den Partisanengruppen in den Bergen hat ihm den Ruf eines zu revolutionärem Romantizismus neigenden Volkshelden eingetragen. T. aber wandte sich wiederholt und entschieden gegen revolutionäres Abenteuertum. Er anerkannte die besondere historische Rolle der Arbeiterklasse in der Revolution und versuchte eine politische Plattform für die Aktionseinheit aller revolutionärer Kräfte zu schaffen. Er erstrebte einen politischen Apparat für die Volksbewegung. Als Priesger und Professor für Soziologie versuchte er christliche Nächstenliebe auf der Ebene zu verwirklichen, die sich ihm als Wissenschaftler auf Grund des Studiums sozialer Fakten anbot. T. erkannte, dass christliche Nächstenliebe nicht zu verwirklichen sei, ohne die sozialen Bedingungen grundlegend zu ändern und ferner die Haltung der herrschenden Minorität den sozialen Fortschritt unmöglich mache, folglich nur durch eine revolutionäre Umwälzung eine Änderung herbeizuführen sei.
Die Machtergreifung durch das Volk mit Hilfe der Revolution war sein erklärtes Ziel. Gleichzeitig aber sah er auch, dass diese Machtergreifung letzten Endes nicht ohne Gewalt vor sich gehen kann. Dabei war er kein Anbeter der Gewalt, sondern vertrat die Auffassung, dass die Revolution friedlich sein könne, wenn die Minderheit ihr keinen gewaltsamen Widerstand entgegensetze.
In einer ‚Botschaft an die Christen‘ betonte er die Pflicht der Christen zur Revolution. Seine Volksverbundenheit und seine christlich-humanistischen Ideale führten ihn als Revolutionär und intellektuell ehrlichen Theoretiker in die Nähe des Marxismus, so dass er ständig von seinen Gegnern als verkappter Kommunist angegriffen und verdächtigt wurde. T. aber hat sich immer als Katholik gefühlt. Sein Mangel als revolutionärer Führer bestand gerade darin, dass er die marxistische Revolutionstheorie nicht beherrschte und anwenden konnte, dass er entscheidende Fehler beging, weil er sich in kritischen Situationen nicht auf eine wissenschaftliche Konzeption stützte, sondern spontan handelte und damit der von ihm selbst initiierten und geförderten Massenbewegung Schaden zufügte. So ist es möglich, dass auch revolutionäre Abenteurer, die Torres bekämpfte und ablehnte, vor denen er wiederholt warnte, ihn für sich beanspruchen.
Es ist ein Verdienst der vorliegenden Schrift, die revolutionäre Gestalt von T. in ihrer Größe und in ihren Grenzen umfassend zu zeigen, damit ein Stück der revolutionären Volksbewegung Kolumbiens, des antiimperialistischen Kampfes mit seinen Schwächen, aber auch mit dem Prozess des kontinuierlichen, durch Widersprüche und Verwicklungen geprägten Heranreifens theoretischer Klarheit und Organisiertheit der progressiven Klassenkräfte.
Es ist sicher notwendig, den Hinweis von O[tto] H[artmut] Fuchs zu beachten, dass die hier vorgetragenen Theorien T.s für den Leser in der DDR zum Teil mit kritischer Distanz zu betrachten sind. Vom Standpunkt eines Lesers, der mit dem Aufbau des Sozialismus in einem hochindustrialisierten Land beschäftigt ist, das im Laufe von 20 Jahren zwei Revolutionen ohne unmittelbare Gewaltanwendung unter der Führung einer marxistisch-leninistischen Partei auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Theorie durchführte, ergibt sich sicher eine grundlegend andere Wertung der sozialen Theorien Camilo Torres‘ als vom Standpunkt des kolumbianischen Lesers, für den Guzman Campos eigentlich auch das Material zusammenstellte und interpretierte. Was für den kolumbianischen Leser neue und höchst aktuelle Erkenntnisse über Zusammenhänge der gesellschaftlichen Entwicklung und der sozialen Revolution sein mögen, wird sicher dem Leser aus der DDR als relativ unkonkrete Reflexion und ungenügende theoretische Durchdringung der realen Probleme erscheinen, wobei häufige Wiederholungen der gleichen Fragen und Auffassungen, wie sie sich aus der Art der Darstellung des Lebensweges von T. ergeben, aus der Fülle des dargebotenen Materials, das Freund und Feind in der jeweiligen Situation zu Worte kommen lässt, Interesse mehr durch die Art der Formulierung und den Bezug auf die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit T. s erregen als durch die Tiefe der Reflexion.
G. beschreibt den gesamten Werdegang T.s, d. h. er beginnt damit aufzuzeigen, aus welchen Motiven T. Priester wurde. Im Vordergrund steht dabei das Motiv der Nächstenliebe. Die Logik des Fortschreitens und der Entfaltung dieses Motivs bis zum revolutionären Kampf ist sicher für jeden modernen Christen ein lohnender Gegenstand der Auseinandersetzung und des Nachdenkens. G. lässt dabei die Vielgestaltigkeit der auf T. einwirkenden Faktoren Reflex werden. Das betrifft auch die innerkirchliche Situation, wo T. unter seinen Amtsbrüdern zum Teil Verständnis findet, zum Teil auf harte Ablehnung stößt, von seiner Kirchenleitung wegen politischer Betätigung als Priester suspendiert wird und dann als Laie sich ganz dem revolutionären Kampf widmet.
G. kritisiert die Haltung der Kirchenleitung nicht nur gegenüber T., sondern gegenüber der sozialen Wirklichkeit in Kolumbien, die er mit fundierten Fakten darstellt. Massiv kritisiert er die Einmischung und Ausbeutung seines Landes durch die USA. Die Industrie, die Armee, die Polizei, das Erziehungswesen, die Ministerien, einige Universitäten würden indirekt oder direkt vom USA-Imperialismus kontrolliert. 1965 habe die USA für jeden Dollar Investition 15 Dollar Amortisation oder Zinsen vereinnahmt.
Den Einfluss der Kubanischen Revolution auf die Entwicklung in Lateinamerika wertet G. positiv. Die USA würden ohne kubanische Revolution die reaktionärsten Kräfte unterstützen, statt wenigstens auf Reformen zu drängen. Das System der ‘freien Wirtschaft‘ betrachtet G. skeptisch. Es sei keinesfalls das Allheilmittel für die zurückgebliebenen Länder. Er ist der Auffassung, dass in unterentwickelten Ländern eine Änderung der sozialen Struktur nicht ohne Druck durch das Volk möglich ist.
T. sieht in der Revolution den einzigen Ausweg. Die Hierarchie Kolumbiens verweigerte jede Teilnahme an einer positiven Lösung. T. stellte fest, in Abgrenzung gegenüber dem Programm der ‚Allianz für den Fortschritt‘, dass Revolution nicht Reform, sondern die Veränderung der Machtverhältnisse im Sinne des geschichtlichen Fortschrittes sei. Revolution müsse mit Bedacht ausgelöst und vorher geplant sein. Sie erfasse die grundlegenden Strukturen auf politischem, juristischem, sozialem und ökonomischem Gebiet und breche mit der bestehenden Ordnung. Aus der unerträglichen Lage des Volkes ergebe sich der unerschütterliche Wille zur Revolution. Eine gewaltsame Revolution sei wahrscheinlich. Auf Gewalt könne nur mit Gewalt geantwortet werden. T. sucht zu begründen, dass der Christ Revolutionär sein müsse, weil er gegen jede ungerechte soziale Bedrückung eintrete.
Mit Leidenschaft wendet er sich gegen ‚Theaterrevolutionäre‘, die das Volk nur betrügen, gegen Kaffeehaus- und Schreibstubenrevolutionäre, gegen revolutionäre Schreihälse und opportunistische, leichtsinnig, bürokratische, snobistische und bohémhafte Revolutionäre. Die Wurzeln der Revolution seien die Indios, die Mestizen, die Arbeiter und Bauern. Er forderte die Zusammenarbeit von Werktätigen und revolutionären Intellektuellen.
Seit Mitte der 50er Jahre kämpfte T. um die Vereinigung revolutionärer Kräfte. Er fertigt eine Studie auf der Grundlage von Konferenzmaterialien an, die den Weg zur Veränderung der sozialen Verhältnisse in Kolumbien aufzeigen soll. Damit ist eine vorläufige Plattform für die Sammlung progressiver Gruppen gegeben. T. strebt eine Volkseinheitsfront an. Er fordert den Aufbau eines politischen Apparates für die Volksbewegung. Entschädigungslose Enteignung zur Durchführung einer Bodenreform steht auf seinem Programm, die Verstaatlichung des Außenhandels, progressive Steuern und Wohnraumbewirtschaftung, die Verstaatlichung der Banken, Verkehrsmittel, des Rundfunks und Fernwehens und sämtlicher Bodenschätze etc.. Nach der Veröffentlichung dieses Dokumentes begannen heftige Angriffe gegen T. Er wurde von der Hochschule für öffentliche Verwaltung, wo er als Dozent gearbeitet hatte, entlassen und von der Hierarchie in den Laienstand versetzt.
T. geht seinen weg unbeirrt weiter und gründet eine Zeitung, ‚Frente Unido‘, die helfen soll als theoretisches Organ die Einheit der revolutionären Kräfte zu festigen. Es gelingt aber nicht, eine einheitliche Konzeption in der Redaktion durchzusetzen. Antikommunisten tragen zur Spaltung bei und untergraben die Einheitsbewegung. Mit diesem Problem wird T. nicht fertig. Im Kampf der verschiedenen Gruppen und Organisationen gegeneinander sucht er den Ausweg in der Mobilisierung der Nichtorganisierten. Das war eine Utopie, ein Kurzschluss, hervorgerufen durch mangelnde theoretische Kenntnisse über Möglichkeiten und Entwicklung revolutionärer Organisationen, einer daher rührenden Enttäuschung und Ungeduld, die ihn dann auch in die Berge gehen ließ.
Dieser Entschluss wird als übereilt gekennzeichnet. Extremisten könnten T. deswegen zu ihrer Symbolgestalt machen. Andererseits zeigt G. hier auch die qualitativen Unterschiede der Guerilla-Gruppen auf und wertet sie keineswegs alle als absolut negativ. Er hebt hervor, dass die Guerilla-Gruppen unter den Erdölarbeitern, besonders aber unter den armen Bauern und Landarbeitern die Fähigkeit sich zu organisieren und Führer zu ermitteln, die Disziplin und den Kollektivgeist, Kämpfertum und Keime des Klassenbewusstseins entwickelten, dass sie das Bewusstsein vermittelten, Mensch zu sein und die Geschichte des Landes mitzubestimmen.
T. ging zu den Guerillas, um die Revolution zu beschleunigen. Die Arbeit in den Städten ging ihm zu langsam voran. Als theoretischer Kopf hätte er aber gerade hier weitreichende Aufgaben zur Vorbereitung der Revolution gefunden Der Einfluss T. s auf die Volksmassen war groß. Das geht allein schon daraus hervor, dass die Reaktion ihm verlockende Angebote machte, als Botschafter, als Stipendiat der Rockefeller Foundation u. w. ins Ausland zu gehen. Als T. darauf nicht einging, wurde systematisch seine Festnahme oder Ermordung vorbereitet.
In seinen letzten Aufrufen zum revolutionären Krieg formulierte er, dass der Kampf des Volkes langwierig sein werde, dass die Angehörigen der Einheitsfront die Vorhut der Initiative und Aktion bilden müssen und mahnte zu Geduld und Vertrauen in den Sieg der Volkskräfte.
Nur die K[ommunistische] P[artei] und die Nationale Befreiungsarmee nahmen als Organisation offen Stellung zum Tode T.s. Das Politbüro der KP Kolumbiens bezeichnete T. als einen hervorragenden nationalen Führer und Kämpfer des Volkes.
Insgesamt ist die vorliegende Biographie geeignet, kirchlichen Kreisen in der DDR positive Denkanstöße zu vermitteln, um die Stellung des Christen zur Revolution und zum Sozialismus zu klären.
Wenn hier wiederholt vom Dialog die Rede ist, so nicht in dem Sinn, wie der Begriff von den Verfechtern der psychologischen Kriegsführung gebraucht wird. Es wird eindeutig vom Dialog über die Art und Weise der sozialökonomischen Veränderungen gesprochen, also im Sinn eines Dialogs zur Festigung der Aktionseinheit.
Das Zitieren von Lombardo Radice dürfte im Gesamtkontext hier nicht weiter ins Gewicht fallen.
Gegen die Veröffentlichung des beigefügten Bildmaterials bestehen keine Bedenken.
Es ist zu erwarten, dass die zu empfehlende Herausgabe dieser Biographie eine rege Diskussion auslösen wird. Darauf sollte man vorbereitet sein. Sie wird sicher einen breiten Leserkreis, besonders unter der studentischen Jugend finden“.
Das Buch von Germán Guzmann über Camilo Torres ist in der DDR gut verbreitet worden. Dazu beigetragen hat ein am 20. Dezember 1971 durch den Sender „Stimme der DDR“ zur Uraufführung gebrachtes, anspruchsvolle Hörspiel „Passio Camilo. Stationen der revolutionären Entwicklung des Paters Camilo Torres Restrepo“ von Hans-Jörg Dost (*1941). Aussagen von Torres werden unverfälscht wieder gegeben. Dost hat in den 1960er Jahren in Leipzig Theologie studiert und war als evangelischer Pfarrer in der DDR, zuletzt in Erfurt, tätig. Nach der Annexion der DDR durch die BRD übersiedelte Hans-Jörg Dost als Hörspielautor nach Österreich.
Bildquelle: Julian David Muñoz Ortega, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons