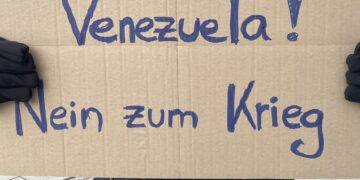Mit „Schloss Gripsholm. Eine Sommergeschichte“ verbuchte Kurt Tucholsky ein Jahr vor der Machtergreifung der deutschen Faschisten unter Hitlers Führung einen Publikumserfolg, der es auch in unserer Zeit verdient hat, besprochen zu werden. Erfolgreich wurde dieser „Sommerroman“ wegen seiner Aufmachung als zutiefst witzige, stellenweise melancholische Liebes- und Reiseerzählung.
Den Stoff für diese Erzählung lieferte ein ausgedehnter Urlaub, den Tucholsky mit seiner Freundin, der Journalistin Lisa Matthias schwedische Kleinstadt Fälltorpet am Mälarensee verbrachte. Das erzählende Ich, Peter, der liebevoll Fritzchen oder „Daddy“ von seiner Freundin Lydia genannt wird, wobei er diese wiederum neckisch Prinzessin oder „Alte“ ruft, verbringen ihren Urlaub im Städtchen Mariefred im Kavaliersflügel des kaminroten, massiven Schlosses Gripsholm. Gebrochen wird die Sommeridylle von einem kleinen „Kinderheimabenteuer“ mit Happy End: das Pärchen rettet ein verschüchtertes, emotional missbrauchtes Kind vor der herrschsüchtig-neurotischen Direktorin desselben Heimes, der deutschen Direktorin Frau Adriani. Ganz und gar nicht der Antifaschist und Antimilitarist Kurt Tucholsky der als Schriftsteller der „Weltbühne“ in knappen, tiefschürfenden Texten zu Empörung und Gegenwehr aufrief.
Verkannte Bedeutung
Der Roman überzeugt bis heute und lässt einen doch verwundert zurück. Zu den bedeutendsten Werken Tucholskys zählend, ist er hübsch verpackt, mit einer hohen Musikalität der Sprache und viel Plattdeutsch. Was Tucholsky dem Leser bietet, ist nicht eine Aneinanderreihung von all den Klischees, die literarisch über Liebeleien im Sommer produziert wurden, sondern eine für die Zeit höchst provokante Prosa, die sowohl die bürgerliche Verklärung der Liebe als auch die wachsende Negation jeglicher Leidenschaft als „Gräuelpropaganda“ durch die deutschen NS-Faschisten kraft ihrer satirischen Sogwirkung verdammte. Dies ist aber nur indirekt aus der Geschichte und im Nachgang ableitbar, „Gripsholm“ ist in erster Linie kein Plädoyer für die „freie Liebe“. Sicherlich bestach diese Erzählung vielmehr als ein literarisches Angebot, durchzuatmen, in Tucholskys Sommeridylle abzutauchen und die zerfallende Weimarer Republik auszublenden. So schreibt Ernst Rowohlt in einem fiktiven Briefwechsel zu Anfang des Romans an Tucholsky: „Die Leute wollen neben der Politik und dem Aktuellen etwas haben, was sie ihrer Freundin schenken können“ (S.9). Man könnte heute wie damals dieses Buch als genau das lesen, mit viel Vergnügen, und würde Tucholsky in die Falle gehen.
Liebe ist nicht stark genug
Diskret in den erzählerischen Stoff verwoben ist die ernüchternde Erkenntnis, dass alles Idyll auf Erden aufgefressen wird von der Faktizität des kapitalistischen Lebens; „Wir hatten geglaubt, der Zeit entrinnen zu können. Man kann das nicht, sie kommt nach…Man denkt oft, die Liebe sei stärker als die Zeit. Aber immer ist die Zeit stärker als die Liebe.“ Wer diese Zeilen liest, kann nicht umhin, das Mahnende in dieser Prosa festzustellen, auch wenn diese nicht in ernster Manier wie für deutsche Literatur üblich, vertieft wird. Anstatt die letzten Tage ihres Urlaubs in Mariefreds Wiesen, Seen und Wäldern auszukosten, sehen sich die Protagonisten gezwungen, zu handeln, um das terrorisierte Kind aus dem Kinderheim Läggesta zu befreien – eine unterhaltsame, jedoch nicht überwältigende Abenteuergeschichte folgt. Gleichzeitig auch eine Absage an jeden romantischen Eskapismus.
Eros und Thanatos
Nicht das Schicksal des Kindes, sondern die Direktorin Adriani ist im Mittelpunkt. Sie repräsentiert ganz augenfällig den deutschen Faschismus, fast wie ein kleines Psychogramm desselben – sie ist die Führerin über eine Kinderkolonne und alle Angestellten, sie sorgt für Zucht und Ordnung mit „kalter Wut“ (S.75), Führerin Adriani „lebte doppelt, wenn sie in solcher Erregung war“ (S.74). Beinahe unwichtig erscheint der Zusatz, dass sie dennoch verheiratet ist, mit einem Nichtsnutz, der Briefmarken klebt, schwächlich und krank. Tucholskys Ich-Erzähler stellt am Höhepunkt der Kinderheimstory, in einer Konfrontation mit Adriani fest, dass diese Frau nie wirklich befriedigt wurde. Es ist keine hohle Beleidigung der Frau Adriani, den „Teufelsbraten“ wie sie heimlich genannt wird, sondern eine Freudsche Feststellung. Tucholsky war ein aufmerksamer Leser Freuds und exemplifiziert in dieser Geschichte, wie eine starke Hemmung von Sinnlichkeit in einen umso stärkeren Todestrieb umschlägt. Und so verallgemeinert Tucholsky diese Feststellung in Bezug auf die Adriani in einem deutlich mahnenden Ton: „Sie kam sich sehr einmalig vor, die Frau Adriani. Und hatte doch viele Geschwister.“
Überhaupt hat Tucholsky mehrere Denkbilder konstruiert, die psychoanalytisch fassbar sind. So wird aus den Gedanken des Ich-Erzählers an wenigen Stellen klar, wie er seine geliebte „Prinzessin“ in Wahrheit mit einer Mutterfigur gleichsetzt, um deren Aufmerksam- und Sorgsamkeit es, das Kind Peter, streiten muss. Dies sei nur am Rande bemerkt, aber letztlich ist es völlig unwichtig, wieviel Bedeutung man diesen Anspielungen oder der Freud’schen Psychoanalyse beimisst. Hier hat Tucholsky eine unaufgeregte, stark autobiographisch anmutende Geschichte verfasst, die politisch zu lesen ist. Aus Tucholsky spricht vielleicht nicht Vorahnung, doch aber mitleidende Wut über die vielen Menschen, die im Faschismus das Vehikel gefunden haben, um über andere zu herrschen – doch nun in einer Ausprägung, die selbst bürgerliche Kaltschnäuzigkeit in etwas unberechenbares, destruktiveres transformiert. Er tut dies ohne originelle Motive und mit deutscher Ernsthaftigkeit. Vielleicht wurde „Schloss Gripsholm“ deshalb von der Leserschaft und so manchem bürgerlichen Literaturkritiker zu Tucholskys Zeit so trefflich verkannt.
Kurt Tucholsky (1931|2020). Schloss Gripsholm. Eine Sommergeschichte. Ditzingen: Reclam Verlag.