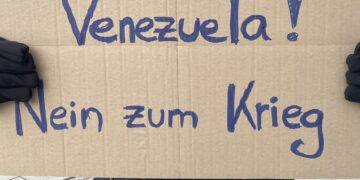Gastautor: Peter Goller, geb. 1961, Univ.-Doz. Dr. und Archivar an der Universität Innsbruck
Unser Gastautor Peter Goller widmet sich in einer fünfteiligen Artikelserie der Arbeiterliteratur. Im Mittelpunkt steht dabei das Leben und Wirken von Adam Scharrer und Hans Marchwitza. Peter Goller hat sich bereits in früheren Beiträgen für die Zeitung der Arbeit mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befasst.
Adam Scharrer (1889–1948) wurde im mittelfränkischen Dorf Klein-Schwarzenlohe als Sohn eines armen Gemeindehirten geboren: „In Bayern sind die Menschen fromm und grob; tun ihre Pflicht Gott und der Welt gegenüber, wie dies dort so der Brauch seit Generationen. Sie geben ihre ersparten Eier den Kapuzinermönchen und essen selbst trocken Brot, wenn die Sonne fast senkrecht steht. Mütter steigen mit schwangeren Leib auf die Hopfenleiter, und bei schwerer Arbeit von Sonnenauf- bis –untergang bleibt wenig Kraft und Zeit für pädagogische Wissenschaft und Praxis. Ein Pfiff – muss genügen.“
Scharrer erlernte das Schlosserhandwerk: „Von meinem fünften bis zu meinem zwölften Lebensjahre verbrachte ich die meiste Zeit auf dem Anger. Kühe und Gänse waren meine Gesellschaft.“
Nach eigener Aussage sind als „seine weiteren Universitäten nach Hüteanger und Lehrzeit die Landstraßen, die Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und die Obdachlosenasyle, die Schützengräben und Munitionsfabriken zu nennen“. Der junge Scharrer bewegt sich lange in der Welt der „lumpenproletarisch“ Deklassierten, in der Welt eines sich selbst helfenden, anarcho-individualistischen Rebellentums. Er solidarisiert sich in individueller Auflehnung mehr mit den obdachlosen Landstreichern „der Walze“ als mit den Proletariern an der Drehbank. Auf Monate des Vagabundierens folgen wieder Wochen der Lohnarbeit in Handwerksbetrieben und knapp vor 1914 in den großen Werften in Hamburg und Bremen, wo Scharrer erstmals an Streikkämpfen teilnimmt.
Enttäuscht darüber, dass große Teile der SPD und der Gewerkschaften 1914 „mit fliegenden Fahnen in das Lager des Imperialismus“ übergelaufen waren, schloss sich Scharrer dem Spartakusbund an. Er nahm im Jänner 1918 am großen politischen Massenstreik der Rüstungsarbeiter teil. Nach Spaltung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) trat Scharrer Ende 1919 als Gründungsmitglied zur „linksradikalen“, jede Arbeit in parlamentarischen oder gewerkschaftlichen Einrichtungen ablehnenden Kommunistischen Arbeiterpartei (KAP) über.
Erst mit 40 Jahren schreibt der lange arbeitslose Scharrer den 1930 erscheinenden proletarischen Antikriegsroman „Vaterlandslose Gesellen“. In selbigem Jahr erscheint die verschlüsselte Autobiographie „Aus der Art geschlagen“ als „Landstraßenbuch“, als „Reisebericht eines Arbeiters“: „Zeit dazu fand ich genügend, weil ich in das Heer der Überflüssigen eingereiht wurde.“
1931 folgt mit dem „Großen Betrug“ die „Geschichte einer proletarischen Familie“ in den Inflationsjahren 1919 bis 1923. Nach der nazistischen „Machtergreifung“ konnte Scharrers Bauernroman „Maulwürfe“ 1933 im tschechoslowakischen Asyl, im Malik-Verlag in Prag erscheinen. Nach der Befreiung vom Faschismus wurde „Aus der Art geschlagen“ unter dem Titel „In jungen Jahren“ als „Erlebnisroman eines Arbeiters“ 1946 im Berliner Aufbau-Verlag neu veröffentlicht.[1]
Hans Marchwitza (1890–1965), der Vater Bergmann aus einer kleinbäuerlichen Häuslerfamilie, die Mutter Erzschlepperin, kam 1910 aus dem oberschlesischen Scharley bei Beuthen als Bergarbeiter an die Ruhr: „Meine Kindheit und Jugend war Kohlenstaub und Ruß! Ausblick auf Eisentürme und Schächte mit riesigen Rädern im Förderschwung. Arbeit und Entsagung aller, auch der geringsten Kinderwünsche. Hunger.“ Auch geistig wurden die jungen Bergarbeiter – Hans Marchwitza fährt mit 14 Jahren in die Grube ein – niedergehalten: „Unser Lesestoff waren die billigen und abenteuerlichen Hundert-Hefte-Räuberromane, Verherrlichung von Detektiven und Indianerhäuptlingen.“
An der Ruhr wird Marchwitza sozialistisch geprägt und nach dem großen Streik der Ruhrbergarbeiter 1912 erstmals entlassen. Erst noch Kriegsfreiwilliger findet Marchwitza im dritten Kriegsjahr Kontakt zum proletarischen Internationalismus: „Ins Drahtverhau flogen viele Blätter – bedruckte Blätter. Wir griffen gierig danach, und ich las: Proletarier, aller Länder vereinigt euch! Bevor ich aber alles durchlesen konnte, kam unser Leutnant aus seinem Unterstand herausgestürzt und entriss uns die Blätter mit einer solchen Hast und Angst, dass wir erst recht neugierig wurden.“
Bei Kriegsende der linksozialistischen USPD beigetreten kämpfte er im Frühjahr 1920 als Roter Ruhrsoldat gegen die Kapp-Putschisten, gegen den Terror von Freikorps und Reichswehreinheiten. Seit 1920 Mitglied der KPD kam er Mitte der zwanziger Jahre – „1924 fristlos entlassen, im Streik um die Siebenstundenschicht“ und auf „schwarze Listen“ gesetzt – zur Arbeiterkorrespondentenbewegung, einer kommunistischen Literaturbewegung. Als Mitglied des „Bundes Proletarisch Revolutionärer Schriftsteller“ und als Mitarbeiter der „Linkskurve“ veröffentlichte Marchwitza 1930 die Reportage „Sturm auf Essen“, eine Geschichte der Ruhrkämpfe von 1920. Er eröffnete damit die Reihe der „Roten-Eine-Mark-Romane“. 1933 aus Deutschland geflüchtet kämpfte Marchwitza im Tschapajew-Bataillon auf Seite der Internationalen Brigaden.
Der erste Teil der „Kumiak“-Trilogie, die Chronik einer Taglöhner- und Bergarbeiterfamilie, konnte 1934 im Exil erscheinen. Zwei Jahrzehnte später konnte Marchwitza 1952 in der DDR die Fortsetzung „Die Heimkehr der Kumiaks“ abschließen. 1947 hat Marchwitza seine – wie bei Scharrer verschlüsselten – Erinnerungen „Meine Jugend“ veröffentlicht.[2]
Zur Tradition sozialistischer Arbeiter-Erinnerungen seit den 1880er Jahren
Die (halb) autobiographischen Erinnerungen von Adam Scharrer und Hans Marchwitza stehen in der Linie der Arbeiter- und Arbeiterinnenliteratur seit dem späten 19. Jahrhundert. In den 1880er Jahren bedauerten Marx und Engels etwa, dass Johann Philipp Becker (1809–1886), revolutionärer Freischaroffizier von 1849 und Mitorganisator der Ersten Internationale, die „abgerissenen Blätter aus [s]einem Leben“ nicht mehr zu Erinnerungen ausbauen konnte. Wenige Wochen vor Beckers Tod hat Friedrich Engels am 9. Oktober 1886 an Eduard Bernstein geschrieben, die deutsche Sozialdemokratie möge Becker materiell unterstützen: „Der alte Becker war hier, und wir haben viel über die Notwendigkeit gesprochen, dass er seine Erinnerungen und Erlebnisse aufschreibt. (…) Die Memoiren selbst wären ein höchst wertvoller Verlagsartikel der Volksbuchhandlung, eine neue Quelle für die Vorgeschichte (die revolutionäre Bewegung von 1827–60) und die Geschichte von den 50er Jahren bis jetzt unsrer Partei, ein Dokument, das kein wirklicher Geschichtsscheiber übersehn dürfte.“[3]
Mit dem Fall des Sozialistenverbots setzt nach 1890 vermehrte Produktion von Arbeiterliteratur ein. Arbeiter wie Carl Fischer, Moritz Bromme, Wenzel Holek, Joseph Belli, Julius Bruhns, Alwin Ger(isch) oder unter vielen anderen mehr Franz Rehbein, sowie Schriftsteller/-innen wie Lu Märten oder Otto Krille veröffentlichen im Vierteljahrhundert bis zum Imperialistischen Weltkrieg 1914 Erinnerungen, autobiographische Erzählungen, Arbeiterromane.[4]
Es war ausgerechnet der erst in nationalsozialen Vereinen aktive, 1900 der Sozialdemokratie beitretende evangelische Pastor Paul Göhre, ein dem revisionistischen Flügel der SPD angehörender Gegner der materialistischen Weltanschauung, der ab 1903 als Herausgeber der Erinnerungen von Fischer, Bromme, Holek und Rehbein proletarischer Literatur zum Durchbruch verhelfen sollte. Göhre griff nicht nur redaktionell ein. Er hat wohl auch inhaltlich „leise Verbesserungen“ in nichtsozialistischem Sinn vorgenommen.
Carl Fischers „Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters“ wurden 1903 eine „literarische Sensation“, ein großer Verlagserfolg. Carl Fischer (1841–1906), weder politisch noch gewerkschaftlich organisiert, schrieb seine Erinnerungen spät als verarmter sechzigjähriger Halbinvalide. Er zeichnet das Leben eines Taglöhners, Erdarbeiters, Kalklöschers, fast fünfzehn Jahre als Steinformer im drückenden Akkord in einem Stahlwerk in Osnabrück schuftend. In alttestamentarischer Bibelsprache protestiert Fischer gegen Verhältnisse, in denen die in Erdlöchern hausenden Arbeiter trotz aller Anstrengungen kein menschenwürdiges Leben führen können. Bei aller emotionalen Ablehnung von Bürgertum und Junkertum bleibt Fischer aber ein weitgehend auf sich allein gestellter Prolet, auch wenn er sein individuelles Aufbegehren gelegentlich in einen klassensolidarischen Zusammenhang stellt.
Moritz Bromme (1873–1926), der als Sohn eines in den Jahren des Sozialistenverbots in der Arbeiterbewegung aktiven Bahnwärters geboren war, stellt nicht nur einen ärmlichen Alltag und die tägliche Arbeitsqual als Kellner, Knopfmacher, Pantoffelmacher, Ziegeleiarbeiter oder Metallarbeiter, sondern auch seine Agitationsarbeit für die nach 1890 wieder legale Arbeiterpartei dar. Vater Bromme ist Kassierer in einer sozialdemokratischen „Hamburger Tischler-Krankenkasse“. Der junge Bromme liest die „Thüringer Waldpost“, ein sozialistisches Tarnblatt.
Im Mittelpunkt seiner 1905 veröffentlichten „Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters“ steht ein optimistischer Bildungsidealismus, gerade weil Bromme als guter Schüler wegen der Armut seiner Eltern keine höhere Schule besuchen konnte. Er liest Ferdinand Lassalle, August Bebels „Die Frau und der Sozialismus“. Marx und Engels werden nicht erwähnt, umso mehr die Anschaffung der „billigen“ und trotzdem den Arbeiterhaushalt stark belastenden „Klassikerausgaben der deutschen Verlagsanstalt: Goethe, Schiller, Heine, Uhland, Lessing, Lenau, Shakespeare“: „Zu Grabbes 100jährigem Geburtstage kaufte ich mir auch dessen Werke. Vorher hatte ich nie etwas von diesem unglücklichen Dichter gehört, der durch seine Misserfolge dem Trunke in die Arme getrieben und dadurch dem Tode ausgeliefert wurde. Warum haben mir meine Lehrer nichts von ihm erzählt? Die ‚Hermannschlacht‘ und der ‚Napoleon’ sind doch wirklich grandiose Schöpfungen“. Es folgen Ausgaben von Shelley oder Byron, von Kleists „Prinz von Homburg“, Victor Hugos „Elende“, Ausgaben von Gorki, von Tolstois „Krieg und Frieden“ und vieles andere mehr: „Unsereiner fand wenigstens Trost bei einem Buche, damit träumte man sich aus dem engen Dasein in eine höhere Welt hinein; aber hier war nur grenzenloses Elend, Not, Unwissenheit und Stumpfsinn.“
Franz Rehbein (1867–1909), Sohn eines armen Schneiders und einer im Taglohn arbeitenden Wäscherin, am Ende seines Lebens invalide als Lokalredakteur für den „Vorwärts“ tätig, wird mit kaum zehn Jahren als Dienstjunge in ein Proletenleben gestoßen. Als Hüterjunge auf einem Gutshof, als Knecht und Taglöhner erlebt er auf hinterpommerschen Gütern die feudal patriarchalische Herrschaft über das Gesinde. Rehbein eröffnet sein 1911 zwei Jahre nach seinem Tod veröffentlichtes „Leben eines Landarbeiters“ dementsprechend: „Hinterpommern! Puttkamerun!! – - Schon bei dem bloßen Gedanken an diese etwas verrufene Ecke unseres lieben deutschen Vaterlandes wird’s einem so merkwürdig ‚östlich‘ zumute. Es ist, als wenn heute noch ein Hauch des Mittelalters über die pommerschen Flachfelder weht. Ein Adelssitz am andern, Rittergut an Rittergut; Stammschlösser und Taglöhnerkaten, Herrenmenschen und Heloten.“ Um abschließend zu resümieren: „Übermäßig lange Arbeitszeit, völlig unzureichende Entlohnung, elende Wohnungszustände, vielfach schlechte Kost und noch schlechtere Behandlung, und demzufolge auch ein nicht fortzuleugnender geistiger Tiefstand in der großen Masse des ländlichen Proletariats. Als lähmende Rechtsfesseln umschließen das Ganze: hundertjährige Gesindeordnungen, einseitig im Interesse der Großlandwirte abgefasste Kontrakte und veraltete Koalitionsbeschränkungen.“
Im schleswig-holsteinischen Land erlebt Rehbein die Verwandlung des halbhörigen Knechts in den agrarischen Lohnarbeiter infolge der Einführung der Dampfdreschmaschine, „das System der Lohndrescherei im Umherziehen“ von Hof zu Hof. Nach oft 15stündiger Arbeit an einem solchen „Schinderkasten“ „ist die Nase vom Einatmen der Staubmassen förmlich verstopft, und beim Ausspeien kommen ganze Klumpen schwärzlichen Schleimes vom Halse heraus“. Ein solches Ungetüm reißt Rehbein 1896 einen Arm ab.
Über einen roten Schuster findet der zwanzig Jahre alte Rehbein 1886 zum Sozialismus. Der Schuster zeigt ihm ein illegales Exemplar des „Sozialdemokrat“: „Ganz geheimnisvoll sagte er mir, dass dieses Blatt in Deutschland eigentlich verboten sei, doch ein Verwandter von ihm habe es ihm im Paket aus Hamburg zugeschickt, er habe schon sogar einen ganzen Haufen davon. Ich selbst hatte ja kaum eine Ahnung davon, dass damals das Sozialistengesetz existierte und diese Blätter nach Deutschland eingeschmuggelt wurden. (…) Und wie warm das Blatt für die Arbeiter schrieb.“
Später im Holsteinischen gibt ihm ein Lehrer Lassalles „Reden und Schriften“: „Bald darauf borgte mir ein Taglöhner – wohlgemerkt: ein Taglöhner – aus Norddeich, wegen seiner sozialdemokratischen Gesinnung allgemein der ‚Rote Hannes‘ genannt, das Buch ‚Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft‘ [von Friedrich Engels] und Bebels ‚Frau‘. (…) Das las sich in der Tat anders, wie schöngeistige Schnurren, Grafenromane oder Räubergeschichten. Was gingen mich jetzt noch all die seichten Literaturschmarren an, in denen die Arbeiter nur stets wie das fünfte Rad am Wagen behandelt wurden.“
Joseph Belli (1849–1927), Sohn eines badischen Kleinbauern, kommt nach Wanderjahren als Schuhmachergeselle Ende der 1860er Jahre vom katholisch „bigotten“ Gesellenverein zur Sozialdemokratie. Als Schuhmacher am Bodensee ansässig organisierte er seit 1879 im Auftrag des „Roten Feldpostmeisters“ Julius Motteler den illegalen Transport verbotener sozialistischer Literatur von der Schweiz nach Deutschland mit. Als Angestellter im Dietz-Verlag veröffentlichte Belli 1912 „die rote Feldpost unterm Sozialistengesetz. Mit einer Einleitung: Erinnerung aus meinen Kinder‑, Lehr- und Wanderjahren“: „Ich empfing die Pakete [mit dem „Sozialdemokraten“], und einige Genossen halfen mir, die Schriften unter Kleidern verborgen über die Grenze zu nehmen. Den größeren Teil schmuggelte meine Frau im Kinderwagen. Da waren Kissen, Matratze und Bettchen angefüllt. Die Grenzbeamten achteten anfangs nicht darauf, schon weil sie bei solchen Durchsuchungen ihre Nase ängstlich schonten.“
Otto Krille (1878–1954) wuchs in dörflicher Armut als Sohn einer verwitweten Guts- und Fabrikarbeiterin in der Umgebung von Riesa an der Elbe auf. Der Mutter blieb „nichts übrig als die Gutsarbeit, die schwere und schlecht entlohnte. Zur Wohnung erhielten wir das Armenhaus, mit einer Stube zu ebener Erde und einem nach der Stiege offenen Bodenraum. Es stand ein Stück abseits vom Dorf, gleichsam um damit anzudeuten, dass die Insassen nicht gesellschaftlich gleichberechtigt mit den übrigen Dorfbewohnern waren.“ 1914 schildert Krille in einer autobiographischen Erzählung „Unter dem Joch“, wie die Mutter um ihr zustehende Gemeindeunterstützungen kämpft, was ihr den Ruf einer „Sozialdemokratin“ einträgt: „‚Sie sind ja der reinste Sozialdemokrat.‘ Natürlich kannte die Mutter diese Menschengattung gar nicht.“
Der junge Krille bildet sich abseits der miserablen Volksschule über Zufallsfunde weiter: „Einmal kam mir ein kleines Heft mit gelbem, zerrissenem Umschlag zu Gesicht. Darauf stand ‚Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand‘. Es war ein Heft der Reclamschen Universalbibliothek, das ich mit Interesse durchlas, meine erste Bekanntschaft mit der deutschen Literatur. Später fiel mir noch ein größeres Buch mit Biographien ‚berühmter Männer‘ in die Hände. Da erfuhr ich zuerst etwas von Schiller und dass er ein großer Dichter gewesen. Ich erinnere mich auch an eine Abhandlung über Christian Friedrich Daniel Schubart und Theodor Körner. (…) Die Flucht Schillers aus der Karlsschule und Körners Teilnahme am Lützowschen Freikorps entfesselten meine Begeisterung und Phantasie.“ Mit etwa vierzehn Jahren zieht Krille „in Schillers ideales Reich ein“. Er liest schwärmerisch den „Don Carlos“ und die „Räuber“.
Über einen älteren Bruder kommt Otto Krille zur Sozialdemokratie. Von ihm erhält er den „Wahren Jakob“, den „Süddeutschen Postillon“ und andere Parteiliteratur. Krille liest die „Sächsische Arbeiterzeitung“. Gelegentlich erhält Krille ein Exemplar der „Neuen Zeit“, dem Theorieorgan der Sozialdemokratie. Der junge Krille ist beeindruckt von Gerhart Hauptmanns Sozialdrama „Weber“.
Als Weber in einer Dresdner Strohhutfabrik erschöpft die Monotonie an der Spulmaschine den jungen Krille in jeder Hinsicht: „Die Arbeiter und Arbeiterinnen waren nur zu einem kleinen Teil organisiert. Meine Begierde, von Sozialismus und Sozialdemokratie etwas zu erfahren, wurde dort nicht befriedigt. (…) Erschreckend deutlich stand bald das Schicksal einer ganzen Klasse vor mir. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr um Jahr immer dieses einförmige Leben ohne Kurven; wie die Fäden auf meiner Maschine, so spulten sich die Tausende von Leben ab, jahrhundertelang.“ Bei der „ewigen Fabrikschufterei geht man so bald kaputt“. Das „Akkordsystem“ macht die Arbeiter zu Konkurrenten: „Die Hutarbeiter waren schlecht organisiert, das heißt, es war ein großer Teil ‚wild‘. Ein verloren gegangener Streik hatte stark desorganisierend gewirkt.“[5]
Besonders wirksam waren die zwischen 1910 und 1914 erscheinenden Erinnerungen von August Bebel „Aus meinem Leben“. Auch wenn Bebel als Sohn eines gedrückten Unteroffiziers eine Kindheit in rheinisch-preußischen Kasematten und ein Schicksal als wandernder Drechslergeselle darlegt, steht die politische Entwicklung im Mittelpunkt, seine Begegnung mit den Lassalle’schen Arbeitervereinen in den 1860er Jahren, die Begegnung mit Wilhelm Liebknecht.
Im ersten knapp vor dem Parteitag von Eisenach 1869 endenden Band beschreibt Bebel den Weg zum Sozialismus, vor allem den Weg zu Karl Marx als einen Umweg über Ferdinand Lassalle. Erst relativ spät hat Bebel kleinere Schriften von Marx und Engels gelesen: „Ich bin vielmehr, wie fast alle, die damals Sozialisten wurden, über Lassalle zu Marx gekommen. Lassalles Schriften waren in unseren Händen, noch ehe wir eine Schrift von Marx und Engels kannten. (…) Das Kommunistische Manifest und die anderen Schriften von Marx und Engels wurden aber der Partei erst gegen Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre bekannt. Die erste Schrift, die mir von Marx in die Hände kam und die ich mit Genuss las, war seine Inauguraladresse für die Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation. Diese Schrift lernte ich Anfang 1865 kennen. Ende 1866 trat ich der Internationale bei.“
Für den zweiten Band, von den Jahren vom Hochverratsprozess 1871 über den Gothaer Vereinigungsparteitag bis hin zum Sozialistenverbot 1878 reichend, benützt Bebel die Korrespondenz mit den „Klassikern“, wie er im September 1911 im Vorwort festhält: „Außerdem gelangten, da ich als Miterbe des Friedrich Engelsschen literarischen Nachlasses testamentarisch eingesetzt worden war, die meisten meiner Briefe wieder in meinen Besitz, die ich im Laufe mehrerer Jahrzehnte mit Friedrich Engels und Karl Marx gewechselt hatte. Den Hauptinhalt dieser Briefe, die wesentlich in die Zeit des Sozialistengesetzes fielen, werde ich im dritten Bande benutzen.“ Unter einem kündigt Bebel auch noch den dritten unvollendet mit dem Jahr 1883 endenden Band an: „Dieser letztere, wird, vorausgesetzt, dass mir überhaupt das Leben und die nötigen Kräfte verbleiben, erst nach längerer Zeit erscheinen. Die Vorarbeiten befinden sich noch in den Anfängen. Möglicherweise muss ich diesen dritten Band in zwei Teile zerlegen. Sein Inhalt wird die zwölf Jahre Sozialistengesetz, die ‚Heroenzeit‘ der Partei, wie diese Periode genannt wird, umfassen.“[6]
Ab der Jahrhundertwende 1900 erscheinen in Österreich zahlreiche sozialistische Erinnerungen in monographischer Form, in skizzenhafter Essayform, manche der Form des bürgerlichen Erziehungsromans nahekommend, andere im strengen „proletarischen Realismus“ gehalten, das individuelle Arbeitsleben mehr oder weniger geschickt mit der allgemeinen sozialistischen Bewegung verbindend, manche sich an die politische Geschichte haltend, manche gestaltend im Sinn einer fiktionalen Erzähllogik.[7]
In der seit dem Hainfelder Parteitag ab 1889 zahlreichen sozialdemokratischen Presse werden unzählige Feuilleton-Skizzen, Berichte, Reportagen, Milieuschilderungen veröffentlicht.[8]
Max Winters alltagsgeschichtliche Reportagen zur Arbeitswelt um 1900 verbanden den Sozialbericht mit statistischen Erhebungen etwa zum Preis‑, Lohnniveau, zu betrieblichen Größenverhältnissen oder zu elenden Wohnverhältnissen. Max Winter (1870–1937) hat als Redakteur der Wiener „Arbeiterzeitung“ Vereinschroniken, Konsumvereinsprotokolle, Essensverzeichnisse, Zeitverwendungsbogen, Katasterblätter oder Haushaltungsregister erhoben. Winter skizziert im Jahrzehnt nach 1900 das Leben „Alpine-Sklaven“, der „Wiener Heimarbeiterinnen“ (1905), der Waldarbeiter unter dem Ausbeutungsregime des Schwarzenbergschen „Blutsaugers“ im Böhmerwald, über Eisen- und Bergarbeiter.[9]
Josef („Seff“) Schiller (1846–1897), „radikaler“ Mitorganisator des Neudörfler Parteitags 1874, beschreibt 1890 in bis in das Jahr 1876 reichenden „Blättern und Blüten aus dem Kranze meiner Erinnerungen“ den Weg aus dem „alltäglichen dumpfen Dahinjammern“, aus Aberglauben und Vorurteilen in einen sozialistischen Arbeiterbildungsverein. Er erinnert an den böhmischen Arbeiterorganisator Josef Krosch, der den jungen Genossen die Schriften von Lassalle nahebringt, an sein eigenes Schicksal als gelernter Weber, als Chemielohnarbeiter, als Anstreicher, als fahrender Händler, als Kohlenschlepper: „Durch dieses öffentliche [sozialistische] Auftreten wurde man selbstverständlich bald aufmerksam auf mich und die Hetzjagd ums tägliche Brot begann. Die Fabrikanten und Arbeitgeber mochten nichts mehr wissen von mir.“ In „Bildern aus der Gefangenschaft“ beschreibt Schiller seine Haftzeit 1882/83, wie Hochrufe in Erinnerung an die Pariser Kommune mit verschärftem Arrest geahndet wurden.
Wenzel Holek (1864–1935), Wanderarbeiter in Ziegeleien, Zucker‑, Glasfabriken, beschreibt 1909 den „Lebensgang eines deutsch-tschechischen Handarbeiters“, wie er als Sohn von Analphabeten auch selbst das Lesen und Schreiben kaum erlernt hatte: „Die Sprachlehre, Biegungen, waren mir fremd, ganz unbekannt geworden, deshalb auch das Rechtschreiben. Mir war es nun schon ganz gleich, wenn ich das ‚y‘ dorthin setzte, wo das ‚i‘ gehörte.“ Schonungslos naturalistisch zeichnet Holek die Erdarbeiter, die „Abraumaken“, die „Karrenleute“ im Duxer Kohlentagebau, erinnernd an düstere degradierte Sklavengestalten in Zolas „Germinal“, an erledigte, trunksüchtige Proleten in Maxim Gorkis Erzählungen. Mit „Befreiung“ überschreibt Holek den Weg zur Sozialdemokratie Mitte der 1880er Jahre. Über ein illegales Flugblatt hört er erstmals vom Arbeiterrecht. Holek erzählt, wie der Duxer Bergarbeiterstreik und der Brünner Weberstreik 1885 seine Sympathie für den Sozialismus geweckt haben. Ein Schumacher und ein Maurer verschaffen Holek in Aussig Zugang zur tschechischen sozialistischen Zeitung „Duch Casu (Geist der Zeit)“. Sie warnen ihn, allein die Zusendung der Zeitung könnte zu Hausdurchsuchung und Polizeiverhör führen: „Allmählich wurde ich nun auch bei den übrigen Anhängern, erprobten Genossen und Sozialisten, eingeführt.“
Robert Köhler, 1841 in Böhmen geboren, nach einer Lehre als Blattbinder jahrelang mit dem Bettelsack auf der Walz durch Westböhmen, Sachsen, Bayern oder Tirol Arbeit in einer Wiener Webkammfabrik, dann bis zu seiner Verwundung bei Königgrätz 1866 zahlreiche Soldatenmisshandlungen miterlebend, gelangt in den 1870er Jahren als Agitator zur sozialistischen Bewegung in der Umgebung von Prag. Köhler notiert in seinen „Erinnerungen aus dem Leben eines Proletariers“ (1913 in Reichenberg erschienen): „1873 wurde ich gemaßregelt, ich musste fort, der böse Störenfried bekam nirgends Arbeit und so ging ich nach Deutschland. Dort hatte ich mir etwas erworben. Doch ich war in der Partei tätig, war ab und zu in Versammlungen gewesen, wurde unter dem Sozialistengesetz acht Wochen eingesperrt und dann ausgewiesen. (…) Zu Hause kam ich vom Regen unter die Traufe. Mit dem Kainsmal des Ausgewiesenen gekennzeichnet, hieß es Arbeit suchen. Doch nichts konnte mich abhalten, immer wieder einzutreten. Hausdurchsuchungen und Einvernahmen waren an der Tagesordnung. (…) Das Wort Sozialdemokrat war gleichbedeutend mit Räuberhauptmann.“
Ferdinand Hanusch (1866–1923), der spätere erste Sozialminister der österreichischen Republik, stellt die oft apathisch deklassierte Verelendung von Proletariern in den Mittelpunkt seiner nach 1900 veröffentlichten Prosatexte über „Erinnerungen eines Walzbruders“, „über ernste und heitere Episoden aus dem Leben unserer Agitatoren“, über die „Namenlosen. Geschichten aus dem Leben der Arbeiter und Armen“.
Von einem freireligiös idealistischen Ideal, vom Bemühen, die Arbeiter an eine humanistisch bürgerliche Kultur heranzuführen, ausgehend stellt Alfons Petzold (1882–1923) den kaum klassenbewussten, leidenden, um ein wenig Zufriedenheit ringenden Proletarier in Bettgeherspelunken, in stickigen, lärmenden Fabrikhallen dar. Petzolds Sympathie gilt den subproletarischen Schichten, Obdachlosen, Vagabunden, Dirnen. In seiner Selbstbiographie „Das rauhe Leben“ beschreibt Petzoldt seine von Krankheit, Not und fehlender Schulbildung überschattete Kindheit, seine marginalisierte Existenz am Taglöhnerstrich als Laufbursche, Fensterputzer. Gegen den Willen des Vaters, der Bücher als „dämliche Schwarten“ abtut, las der junge Petzold Schiller, Heine, Uhland, Brentano oder Tieck. Obwohl er 1901 in die Sozialistische Arbeiterjugend eintritt, wird aus Alfons Petzold nie ein kämpferischer Arbeiter.[10]
Nicht nur die Lebenswelt, sondern auch die politischen Kämpfe, die parteiinternen Rivalitäten zwischen „Gemäßigten“ und „Radikalen“ im Vorfeld des Hainfelder „Einigungsparteitages“ (1888/89) werden in den Mittelpunkt der Arbeiterliteratur gestellt. Andreas Scheu (1844–1927) beschreibt im hohen Alter 1923 nicht nur seine Lehrzeit als Vergolder in den Jahren um 1860, sondern auch den Weg in die sozialdemokratischen Arbeiterbildungsvereine ab 1867, seine Teilnahme an den Wiener Massendemonstrationen für das Streikrecht 1869, seine Verurteilung zu fünf Jahren Haft im Hochverratsprozess 1870, seine Rolle in den Fraktionskämpfen im Vorfeld des Neudörfler Parteitages 1874 und seine Auswanderung nach England. Schon 1912 hatte sein Bruder Heinrich die Frühgeschichte des österreichischen Sozialismus im Vorfeld des „Hochverratsprozesses“ von 1870 dargelegt.[11]
Vom Standpunkt der Viktor Adler zugeschriebenen Parteieinigung von 1889 berichteten Anton Weiguny und Josef Hannich. Josef Hannich (1843–1934), ursprünglich Weber, dann Reichenberger und Brünner Arbeiterzeitungsredakteur, später sozialdemokratischer Abgeordneter, gestaltet seinen Rückblick als allgemeine sozialistische Bewegungsgeschichte in den nordböhmischen Industriegebieten. Hannich, beteiligt an ersten Lohnkämpfen der Tuchweber, Weggefährte von sozialistischen Pionieren des Reichenberger Bezirks wie dem 1870 in Prager Untersuchungshaft umgekommenen Josef Krosch, orientiert seine Memoiren gegen die „Radikalen“, die er nur unter dem Titel einer erfolglosen „Anarchisterei“ sehen will: „Dass das allgemeine und gleiche Wahlrecht, sowie der Arbeiterschutz bei den Anarchisten keinen Schuss Pulver wert waren, mag heute vielen unglaublich erscheinen, damals aber war es so.“[12]
Ähnlich, wenn auch mehr vom Standpunkt der individuellen Lebenswelt schildert Anton Weiguny (1851–1914), der „Bebel von Linz“, wie er Mitte der 1860er Jahre als Schneidergeselle erstmals von Lassalle gehört, die Differenzen zwischen „Selbsthilflern“ und „Staatshilflern“ gesehen, wie er 1869 in Linz Johann Most gehört hat, wie er 1870 den ersten Linzer Schneiderstreik mitorganisiert hat. Weiguny beschreibt auf der Linie des „Hainfelder Programms“ stehend, wie er noch in den 1890er Jahren „einige Scharmützel mit frei herumlaufenden Sozialrevolutionären“ aus dem Umfeld der „beiden bekannten Anarchisten Schneider Rißmann und Bäcker Krcal“, aus dem Umfeld von Josef Peukert oder Johann Most zu bestehen gehabt hat.[13]
Gustav Haberman (1864–1932), seit 1907 sozialdemokratischer Reichsratsabgeordneter, nach 1918 Minister in der tschechoslowakischen Regierung, vermittelt in seinen Erinnerungen zwischen dem Erbe der beiden Parteiflügel: „’Schreib’s auf!’ sagten sie mir. Sie würden mir einen Stenographen besorgen, der das gesprochene Wort einfängt. (…) Bis ich in Pension geh’, schreib’ ich meine Erinnerungen irgendwo in der Hütte eines verfallenen tschechischen Dorfes. Früher nicht.“ Schlussendlich gelang es jedoch, Haberman zur Abfassung seiner an die „bizarr romantische Phantasie Mark Twains“ anstreifenden Erinnerungen zu bewegen: „Die mörderischen Kerkerwände, das Exil, Obdachlosigkeit, Hunger und Arbeit bis zur Erschöpfung – all dies hat diesen Mann nicht kleinbekommen (…).“[14]
Der Arbeiterradikale Johann Most (1846–1906) veröffentlicht 1903 in New York seine „Memoiren. Erlebtes, Erforschtes und Erdachtes“. Sie nehmen auch Bezug auf sein Wirken in der österreichischen Arbeiterbewegung, vor allem auf seine Rolle als Angeklagter im Hochverratsprozess 1870.
Mit Josef Peukert (1855–1910) war in den 1880er Jahren ein weiterer Sozialrevolutionär aus der österreichischen Arbeiterbewegung verdrängt worden. Gustav Landauer gibt Peukerts „Erinnerungen eines Revolutionärs“ heraus, nicht zuletzt um den ins Abseits gedrängten (österreichischen) Arbeiterradikalismus zu rehabilitieren. Für Landauer macht gerade ein gewisser „Proletarierdilettantismus“ den Wert von Peukerts Buch aus: „Dieses Memoirenbuch, das in so mannigfacher Hinsicht lehrreich ist, ist auch aufschließend über einen gewissen, oft rührenden, manchmal ärgerlichen Proletarierdilettantismus, durch den der Schiffbruch mancher begeisterten Bewegung, viele Verworrenheit und arges gegenseitiges Unrecht erklärt wird. Ein Dilettantismus des Schreibens, Agitierens, Organisierens viel weniger noch als vor allem ein Dilettantismus des Lebens, der sie einander in ihrer Verschiedenheit nicht verstehen und dulden lässt.“[15]
Zwanzig Jahre zuvor hatte der radikal syndikalistische Bäckergeselle August Krcal (1862–1894) der parlamentarisch reformistischen Linie der Adler’schern Sozialdemokratie widersprochen. Krcal schrieb Anfang der 1890er Jahre die Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung – „kaum älter als ein Viertel Jahrhundert“ – als eine des verräterischen Kompromisses, wofür er die am Wahlrecht, am Stimmzettel hängende „wissenschaftliche Sozialdemokratie“ angeführt vom Typus August Bebel, Karl Liebknecht und vor allem von Viktor Adler verantwortlich macht: Diese „sind längst reif, von den herrschenden Staatsautoritäten für ihre wunderbaren Staatsdogmen dekoriert zu werden“.[16]
Mit der Gründung des austromarxistischen Theorieorgans „Der Kampf“ konnten ab 1907 in regelmäßiger Folge proletarische Erinnerungen, teils von Arbeitern, teils von sozialistischen Parteiintellektuellen veröffentlicht werden. In den sieben vor 1914 erscheinenden Jahrgängen des „Kampf“ sind gut ein Dutzend derartige historische Beiträge veröffentlicht worden, wobei neben Autoren aus dem Wiener Raum vor allem vom sozialistischen „Reichenberger Gift“, vom „Neisse-Manchester“ geprägte, in militärisch niedergeschlagenen Streikkämpfen geschulte, in der „Prager Universität“, dem Prager Gefangenenhaus, radikalisierte Sozialdemokraten arbeiterhistorische Berichte vorstellten.[17]
Adelheid Popp (1869–1939) legte 1909 anonym die „Jugend einer Arbeiterin“ vor. Innerhalb eines Jahres erfolgten drei weitere Auflagen. Auf Wunsch von August Bebel veröffentlichte Popp das Buch unter ihrem Namen. Bebel verfasste auch ein Vorwort. Adelheid Popp beschreibt das Elend einer proletarischen Kindheit, ihre Betteltouren, eine analphabetische Mutter, die wenig von einem Schulbesuch hält, dann den Weg zur Sozialdemokratie, zum Kampf für die Rechte der Arbeiterinnen, die Agitation für den Zehnstundentag, die Bewegung für den 1. Mai 1890, die Lektüre der Schriften von Engels, Lassalle, Liebknecht.
Seit 1912 lag auch ein von Adelheid Popp aus Anlass „20 Jahre österreichische Arbeiterinnenbewegung“ herausgegebenes Erinnerungsbändchen mit Beiträgen von Arbeiterinnen und auch von Sozialistinnen mit bildungsbürgerlichem Hintergrund: „Wir sind aber gewohnt, die Entstehung der Arbeiterinnenbewegung mit der Herausgabe der ‚Arbeiterinnen-Zeitung’ zu verbinden, was ja auch richtig ist, da erst durch die ‚Arbeiterinnen-Zeitung’ die Bewegung in die Provinz getragen wurde. Zuerst war es nur eine Wiener Bewegung. Die ‚Arbeiterinnen-Zeitung’ erschien aber zum erstenmal im Jänner 1892, also vor 20 Jahren.“
Nicht nur die proletarische Leidensgeschichte, sondern auch die kämpfende sozialistische Entwicklung von Frauen unter schwierigen Bedingungen wird dargelegt. In diesem Sinn eröffnet Anna Altmann die Reihe der autobiographischen Artikel. Von Popp wird Altmann in der Einleitung als die Pionierin der österreichischen Sozialistinnen gewürdigt: „Damals (um 1890 – Anm.) gab es in Wien noch keine Rednerin. Die Genossin Anna Altmann, eine in Nordböhmen schon bekannte Kämpferin, wurde nach Wien berufen, um hier über den Zweck des Arbeiterinnen-Bildungsvereines zu referieren.“
Nicht nur das Arbeiterinnen-Elend, sondern auch deren Kampf wird geschildert, so die Mühen der sozialistischen Wanderagitatorinnen in den 1890er Jahren, etwa von Sophie Jobst und von Anna Boschek, so der erste Textilarbeiterinnenstreik 1893, den Amalie Seidl mitorganisierte, so der erste Weg der späteren „Kriegslinken“ Gabriele Proft in eine sozialdemokratische Parteiversammlung mit dem Redner Franz Schuhmeier 1896.
Auch das Zögern, die eigene Geschichte darzustellen, leuchtet durch, etwa bei der das Elend in den Wienerberger Ziegelwerken miterlebenden Weißnäherin Amalie Pölzer: „Es ist ein sehr zweifelhaftes Vergnügen, über sich selbst etwas zu schreiben. Nicht dass ich etwas zu verbergen hätte oder dass ich mich schämen würde, einzugestehen, wie indifferent ich war und dass es längere Zeit dauerte, bis ich den Sozialismus verstand. Fehlten mir doch alle Vorbedingungen, die mich befähigt hätten, die sozialistischen Lehren rasch aufzunehmen. Als ich noch die 3. Bürgerschulklasse besuchte, machte ich mir schon einen Plan, was ich anfangen würde nach Vollendung des vierzehnten Lebensjahres. Mein Ideal war, Köchin zu werden.“[18]
[1] Vgl. Walter Fähnders und Martin Rector: Linksradikalismus und Literatur. Untersuchungen zur Geschichte der sozialistischen Literatur in der Weimarer Republik. Band 2, Reinbek 1974, 243–263.
[2] Vgl. Alfred Klein: Die Arbeiterklasse im Frühwerk Hans Marchwitzas, in derselbe: Im Auftrag der Klasse. Weg und Leistung der deutschen Arbeiterschriftsteller, Berlin-Weimar 1972, 544–610 und 774–800.
[3] Karl Marx – Friedrich Engels: Werke (MEW) 36, Berlin 1979, 544–547.
[4] Vollständige Liste der Autoren und Autorinnen in Wolfgang Emmerich (Hrg.): Proletarische Lebensläufe. Autobiographische Dokumente zur Entstehung der zweiten Kultur in Deutschland. Band 1. Anfänge bis 1914, Reinbek 1974, 384–392. [Vgl. auch Band 2. 1914 bis 1945, Reinbek 1975]. Vgl. auch Gerald Stieg – Bernd Witte: Abriss einer Geschichte der deutschen Arbeiterliteratur, Stuttgart 1973, 58–64.
[5] Otto Krille: Unter dem Joch. Geschichte einer Jugend (1914), herausgegeben und eingeleitet von Ursula Münchow, Berlin 1975, 4, 7, 11f., 92f.
[6] Vgl. Ursula Münchow: Frühe deutsche Arbeiterautobiographien, Berlin 1973, 18–41.
[7] In Auszügen veröffentlicht in Stefan Riesenfellner (Hrg.): Arbeiterleben. Autobiographien zur Alltags- und Sozialgeschichte Österreichs 1867–1914, Graz 1989.
[8] Vgl. Textsammlungen von Friedrich G. Kürbisch, wie „Wir lebten nie wie Kinder. Ein Lesebuch (Bonn 1983)“ oder „Der Arbeitsmann, er stirbt, verdirbt, wann steht er auf? Sozialreportagen 1880 bis 1918 (Bonn 1982).
[9] Vgl. Stefan Riesenfellner (Hrg.): Arbeitswelt um 1900. Texte zur Alltagsgeschichte von Max Winter, Wien 1988.
[10] Zur literaturgeschichtlichen Einschätzung von Josef Schiller, Andreas Scheu, Ferdinand Hanusch, Alfons Petzold und Adelheid Popp vgl. Wolfgang Quatember: Erzählprosa im Umfeld der österreichischen Arbeiterbewegung. Von der Arbeiterlebenserinnerung zum tendenziösen Unterhaltungsroman (1867–1914). (=Materialien zur Arbeiterbewegung 51), Wien 1988. Vgl. Alfons Petzold: Ich mit müden Füßen. Textsammlung, hrg. von Ludwig Roman Fleischer, Wien 2002.
[11] Vgl. Andreas Scheu: Umsturzkeime. Erlebnisse eines Kämpfers, 3 Bände, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1923 und Heinrich Scheu: Erinnerungen. Ein Beitrag zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung, Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1912.
[12] Vgl. Josef Hannich: Erinnerungen. Ein Beitrag zu der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung, Verlag „Nordböhmische Volksstimme“, Warnsdorf 1910.
[13] Vgl. Anton Weiguny: Erinnerungen eines Alten aus den Anfängen der oberösterreichischen Arbeiterbewegung, Linz 1911.
[14] Vgl. Gustav Haberman: Aus meinem Leben. Erinnerungen, Prag 1919.
[15] Vgl. Josef Peukert: Erinnerungen eines Revolutionärs. Aus der revolutionären Arbeiterbewegung, hrg. und eingeleitet von Gustav Landauer, Verlag des sozialistischen Bundes, Berlin 1913.
Vgl. zur Dominanz sozialdemokratischer Geschichtsinterpretation Anna Staudacher: Sozialrevolutionäre und Anarchisten. Die andere Arbeiterbewegung vor Hainfeld. Die Radikale Arbeiter-Partei Österreichs (1880–1884), Wien 1988, 1f. und Karl Heinz Roth: Die „andere“ Arbeiterbewegung und die Entwicklung der kapitalistischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart, zweite Auflage, München 1976.
[16] Vgl. August Krcal: Zur Geschichte der Arbeiter-Bewegung Oesterreichs 1867–1894. Eine kritische Darlegung [1893/94 – nach Krcals Tod wiederholt ergänzt herausgegeben], Verlag Monte Verita, Wien 1985.
[17] Vgl. u.a.m. L.A.Bretschneider: Vor Hainfeld, in: Der Kampf 1 (1907/08), 211–216; Jakob Reumann: Propaganda der Tat, in: Der Kampf 2 (1908/09), 277–282; Jakob Reumann: Unser erster Mai, in: Der Kampf 2 (1908/09), 349–353; Eduard Rieger: Nordböhmische Reminiszenzen, in: Der Kampf 2 (1908/09), 158–164; Anton Schäfer: Aus der Geschichte der nordböhmischen Arbeiterbewegung, in: Der Kampf 3 (1909/10), 84–87; Robert Preussler: Erinnerungen aus der Arbeiterbewegung, in: Der Kampf 3 (1909/10), 469–475; Franz Uhlik (Graupen): Rückblicke. Einem alten Genossen Nacherzähltes und Selbsterlebtes, in: Der Kampf 5 (1911/12), 30–37 oder Adolf Reitzner (Bodenbach): Wie es einst war, in: Der Kampf 5 (1911/12), 176–182.
[18] Vgl. Gedenkbuch. 20 Jahre österreichische Arbeiterinnenbewegung, im Auftrag des Frauenreichskomitees herausgegeben von Adelheid Popp, Kommissionsverlag der Wiener Volksbuchhandlung „Vorwärts“ (Wien V), Wien 1912 mit Beiträgen von Adelheid Popp, Anna Altmann, Emma Adler, Aurelia Roth, Rosalie Schnitzinger, Amalie Seidl, Marie Beutelmeyer, Lotte Pohl, Sofie Jobst, Anna Boschek, Amalie Pölzer, Anna Maier, Betti Huber, Anna Perthen, Marie Koch, Therese Schlesinger, Marie Sponer, Emmy Freundlich und Gabriele Proft.