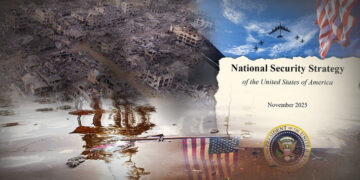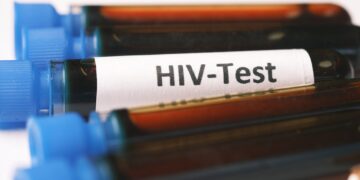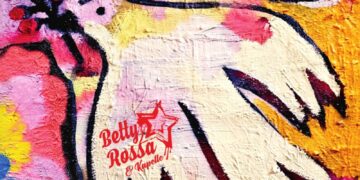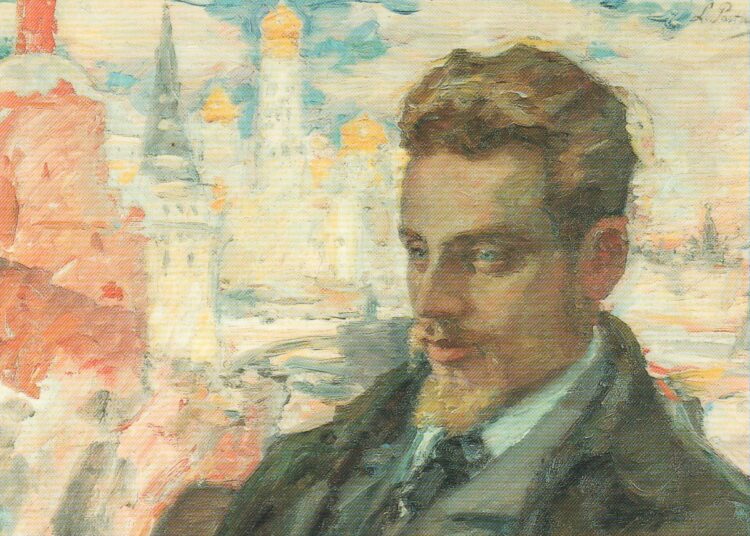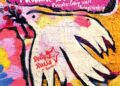Die „Sesamstraße“ war einst ein Leuchtturm im öffentlichen Rundfunk, heute kämpft sie ums Überleben im Zeitalter des „Plattformkapitalismus“.
New York. Seit über fünf Jahrzehnten vermittelt die „Sesamstraße“ Kindern auf der ganzen Welt grundlegende Fähigkeiten – Zählen, Lesen, aber auch Mitgefühl, Solidarität, Antirassismus und Toleranz. Wenngleich auch vielfach systemstabilisierende Werte und westliche Perspektiven. Nichtsdestotrotz, in den 1970er Jahren wurden bewusst in ärmeren, meist afroamerikanischen Vierteln ausgestrahlt, wurde sie zu einem Symbol für die demokratische Idee, Bildung allen zugänglich zu machen – unabhängig von Einkommen oder Herkunft, so zumindest das gut klingende Ziel.
Unter der Regierung Trump wurden die Mittel für den öffentlichen Rundfunk drastisch gekürzt – darunter auch für PBS, den Sender, der die „Sesamstraße“ seit 1969 ausstrahlte. Schon zuvor hatte sich abgezeichnet, wohin die Reise geht: Weg von frei zugänglicher Unterhaltung zumindest zum Denken anregen sollte, hin zu Pay-TV und Streamingdiensten. „Wer, wie, was, / wieso, weshalb, warum, / wer nicht fragt, bleibt dumm.“ kostet also, die Produktion neuer Staffeln wurde bereits vor Jahren an einen Bezahlsender ausgelagert, PBS zeigte nur noch Wiederholungen.
Nun folgt der nächste Schritt in der schleichenden Privatisierung: Ein neuer Vertrag mit Netflix soll die Zukunft der Sendung sichern – zumindest finanziell. Die neuen Folgen werden zeitgleich bei Netflix und PBS veröffentlicht. Doch was als Kompromiss erscheint, ist in Wirklichkeit ein deutliches Zeichen für den Triumph des Plattformkapitals. Während Millionen Kinder weltweit Zugang zum Internet und Streamingdiensten verweigert bleibt – aus Armut oder aus struktureller Benachteiligung –, wandert eine Art Bildungsprojekt hinter eine Bezahlschranke.
Dass es gerade die „Sesamstraße“ trifft, ist besonders bitter. Denn sie steht seit jeher für Inklusion, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit – allesamt Werte, die dem neoliberalen Umbau des Bildungswesens fundamental widersprechen. Figuren wie die obdachlose Lily oder der autistische Samir haben Themen wie Armut und Diskriminierung kindgerecht, aber unmissverständlich in den Mainstream gebracht. Und das in einer Gesellschaft, die Kinderarmut systematisch verschweigt und strukturellen Rassismus leugnet. Einmal mehr wird die Warenförmigkeit von Kultur unter Gegenwartskapitalistischen Verhältnissen deutlich. Der Potentiell emanzipierende und zum Denken anregende Charakter von Kultur gerät so weiter in den Hintergrund.
Quelle: Deutschlandfunk Kultur