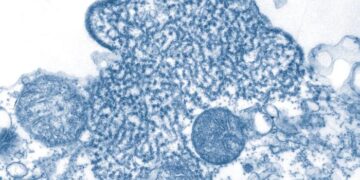Die Internationale Soziologische Gesellschaft (ISA) hat Ende Juni 2025 einen folgenreichen Beschluss gefasst: Die kollektive Mitgliedschaft der Israelischen Soziologischen Gesellschaft (ISS) wurde ausgesetzt. Die Begründung ist eindeutig: Die ISS habe sich in ihren offiziellen Erklärungen nicht klar und unmissverständlich von dem anhaltenden Genozid an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza distanziert.
Madrid/Tel Aviv. Es ist ein bemerkenswerter und mutiger Schritt in einer Zeit, in der viele akademische Institutionen schweigen, wegtauchen oder offen kollaborieren, während ein Massaker historischen Ausmaßes stattfindet – mit voller militärischer, wirtschaftlicher und ideologischer Rückendeckung des Westens.
Dass ausgerechnet die Österreichische Gesellschaft für Soziologie (ÖGS) und die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) diesen Schritt der ISA öffentlich verurteilen, lässt tief blicken. Sie stellen sich damit nicht nur gegen einen dringenden moralischen Imperativ, sondern machen sich objektiv zum Teil jener Kräfte, die seit Monaten versuchen, jede Form von Palästina-Solidarität als antisemitisch, gefährlich oder unwissenschaftlich zu diskreditieren.
Was ist ein Genozid – wenn nicht das?
Seit Oktober 2023 hat die israelische Armee über 40.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet, darunter Zehntausende Kinder. Krankenhäuser, Universitäten, Bäckereien, Flüchtlingslager und UN-Schulen wurden gezielt bombardiert. Millionen Menschen wurden zur Flucht gezwungen. Die WHO spricht von einem „Totalkollaps der Gesundheitsversorgung“, die UN erklärt in Gaza eine Hungernot der höchsten Stufe, die durch systematisch verhinderte Hilfe herbeigeführt werden.
Internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International sowie UN-Expertinnen und UN-Experten bezeichnen das, was in Gaza geschieht, eindeutig als Genozid. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag bestätigte in mehreren Entscheidungen, dass es plausible Beweise für einen Völkermord durch Israel gibt – und wies das Land an, Maßnahmen zu dessen Verhinderung zu ergreifen.
Wer angesichts dieser Lage nicht das Wort „Genozid“ in den Mund nimmt, relativiert das Verbrechen. Wer – wie die ISS – die Verantwortung auf beide Seiten verschiebt, Geiselnahmen mit Völkermord gleichsetzt oder bloß „Hoffnung auf Frieden“ bekundet, betreibt Täter-Opfer-Umkehr. Und wer – wie ÖGS und DGS – diesen unentschiedenen Zwischenruf dann auch noch gegen die ISA verteidigt, steht auf dem Boden politischer Feigheit.
Akademische Repression: Kritik verboten, Solidarität kriminalisiert
Seit Beginn der israelischen Angriffe auf Gaza im Oktober 2023 erleben wir einen massiven Rückbau akademischer Freiheiten im deutschsprachigen Raum – und darüber hinaus.
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verlieren ihre Stellen, weil sie sich mit Gaza solidarisieren.
- Veranstaltungen mit palästinensischen Stimmen werden abgesagt oder von Polizei begleitet.
- Forschungsförderung wird gestrichen, sobald der Begriff „Apartheid“ oder „Besatzung“ fällt.
- Israelische Akademikerinnen und Akademiker, die die Regierung Netanjahu kritisieren, werden diffamiert.
- Studierende werden exmatrikuliert, weil sie sich an Protesten beteiligen.
Dies alles geschieht im Namen eines Antisemitismusbegriffs, der antipalästinensische Gewalt nicht als rassistisch erkennt – und deshalb nicht als problematisch empfindet. Ein Antisemitismusbegriff, der politische Kritik an der israelischen Regierung mit Vernichtungsphantasien gleichsetzt, um jede Debatte zu unterbinden. Ein Antisemitismusbegriff, der sich als Schutzschild für staatliche Gewalt missbrauchen lässt – und dabei Antisemitismus nicht bekämpft, sondern instrumentalisiert. Schlimmer noch, diejenigen, die vermeintlich den Antisemitismus bekämpfen, stärken den Antisemitismus in dem sie Jüdinnen und Juden in Geiselhaft nehmen für die israelischen Verbrechen in Gaza und verschleiern, dass es viele Jüdinnen und Juden gibt, die diese Politik ablehnen.
Die hegemoniale Rolle der sogenannten Antideutschen
Diese ideologische Grundstruktur wird seit Jahren maßgeblich durch eine einflussreiche Strömung geprägt, die sich selbst als „antideutsch“ versteht. Entstanden in der deutschen Linken nach der Wiedervereinigung, hat sich diese Szene inzwischen tief in akademische Institutionen, Medienhäuser, Kulturförderstellen und NGOs eingeschrieben.
Was ursprünglich eine kritische Auseinandersetzung mit Nationalismus und Antisemitismus sein sollte, ist in vielen Fällen zu einer militanten, hypermoralischen Verklärung des israelischen Staates verkommen. Palästinensische Perspektiven gelten dieser Strömung grundsätzlich als verdächtig, antiimperialistische Kritik wird mit Antisemitismus gleichgesetzt, und die Shoah wird immer wieder herangezogen, um aktuelle israelische Kriegsverbrechen zu legitimieren – oder mindestens unbenennbar zu machen.
Die Folge ist ein repressives Klima, in dem sich viele Akademikerinnen und Akademiker nicht mehr trauen, die Realität in Gaza öffentlich anzusprechen. Besonders betroffen: Forschende mit palästinensischem Hintergrund – deren Existenz in Deutschland und Österreich oft schon als Provokation gewertet wird.
Die DGS und ÖGS: Wissenschaftlicher Anstand oder koloniale Arroganz?
In ihrer Stellungnahme spricht die ÖGS von „unangemessener Politisierung“ der ISA und verteidigt die ISS als wertvolle Partnerin im internationalen Austausch. Auch die DGS warnt vor einem „Ausschluss politisch Andersdenkender“. Die ÖGS geht sogar noch einen Schritt weiter als die DGS und beendet ihre kollektive Mitgliedschaft in der ISA.
Beide Gesellschaften verkennen dabei auf frappierende Weise, dass das Nicht-Benennen des Genozids selbst eine politische Positionierung ist. Und sie ignorieren, dass sich die ISA keineswegs pauschal gegen israelische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellt, sondern konkret auf die Komplizenschaft der ISS mit einem andauernden Verbrechen reagiert.
Diese Haltung ist ein moralischer bankrott. Sie schreibt westliche Deutungshoheit fort, ignoriert die Stimmen palästinensischer Intellektueller – und schützt die eigene Reputation um den Preis der Wahrheit.
Eine notwendige Zäsur – und ein Prüfstein für die kritische Wissenschaft
Der ISA-Beschluss markiert einen wichtigen Bruch. Zum ersten Mal seit langem stellt sich eine große wissenschaftliche Institution offen gegen den imperialen Konsens, der Israel als unantastbare Bastion stilisiert – unabhängig von der Realität vor Ort.
Es ist ein Signal an alle, die glauben, dass Wissenschaft ohne Haltung möglich sei – oder dass diese Haltung immer der westlichen Machtlogik folgen müsse. Die Soziologie ist, wie alle Wissenschaften, nie neutral. Sie steht entweder auf der Seite der Unterdrückten – oder auf der Seite der Macht.
Palästina als Prüfstein akademischer Integrität
Was derzeit in Gaza geschieht, ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern ein Prüfstein für unsere ethische und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Insbesondere in einer Disziplin wie der Soziologie, die eine kritische Gesellschaftsanalyse vornehmen sollte. Die Entscheidung der ISA ist ein erster Schritt, diese Verantwortung ernst zu nehmen. Die Reaktion von ÖGS und DGS hingegen offenbart ein erschreckendes Maß an Ignoranz und Feigheit.
Statt sich über den Ausschluss der ISS zu empören, sollten sich deutschsprachige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragen, wie es so weit kommen konnte, dass ein Genozid vor aller Augen stattfindet – und sie schweigen, relativieren oder decken.
Solidarität mit Palästina ist keine Meinungsäußerung, sondern eine wissenschaftliche, ethische und menschliche Pflicht. Und wer diese Solidarität diffamiert, wird früher oder später auf der falschen Seite der Geschichte stehen.
Quelle: ISA/ÖGS/DGS/Global Dialogue/jW/KP