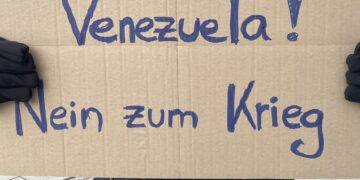Von der Atlantikküste bis zu jener des Indischen Ozeans soll ein durchgehendes Begrünungsprojekt die Ausbreitung der Sahara in die Sahelzone unterbinden.
Paris/Dakar/Ouagadougou. „Vom Kap nach Kairo“ wollte Cecil Rhodes Ende des 19. Jahrhunderts eine Eisenbahnlinie bauen lassen, die Afrikas Südspitze mit Ägypten ganz im Nordosten verbindet – und die damit freilich auch infrastrukturell den britischen Kolonialinteressen dienen sollte. Die Zugverbindung weist bis heute erhebliche Lücken auf. „Von Dakar nach Dschibuti“, lautet die Losung eines (auch nicht mehr ganz neuen) Projekts, das allerdings in der West-Ost-Richtung verlaufen soll. Dabei geht es jedoch nicht um Verkehrsmittel, sondern um Pflanzen: Ein anzulegender, durchgehender Grüngürtel soll ein Bollwerk darstellen, um die weitere Ausbreitung der Sahara nach Süden und somit die Verwüstung der Sahelzone zu unterbinden. Bäume, Büsche und Kulturpflanzen auf einer Länge von 8.000 Kilometern mögen dies bewerkstelligen, so ein bereits 20 Jahre alter Plan, der nun auf dem Pariser Klimagipfel wieder zum Thema wurde.
Die eigentliche Grundidee gibt es noch länger: Thomas Sankara, der revolutionär-sozialistische Präsident von Burkina Faso 1983–1987, hatte in seinem Heimatland bereits solche Maßnahmen initiiert. Durch gezielte Aufforstung mit einheimischen Pflanzen sollte damals die Desertifikation aufgehalten oder sogar rückgängig gemacht werden – dieses Programm (und eine Reihe anderer fortschrittlicher Umwälzungen) war mit Sankaras Ermordung im Zuge eines mutmaßlich von Frankreichs Präsident Mitterand mitunterstützten konterrevolutionären Staatsstreiches freilich hinfällig. Nun, rund 35 Jahre später, hat mit Macron ein anderer im Élysée-Palast amtierender Präsident zugesagt, recht hohe Finanzhilfen für die Errichtung der „grünen Mauer“ bereitzustellen, ebenso übrigens die Schutzwall-erprobte deutsche Kanzlerin Merkel. Ganz selbstlos ist das natürlich nicht, denn selbstverständlich geht es um Einflusssphären, und außerdem würden andernfalls womöglich die Chinesen mit Geldgeschenken einspringen – die kennen sich ja auch aus mit großen Mauern sowie mit internationalen Freundschaftsbanden.
Das ambitionierte Projekt der „Grande muraille verte“ soll also wieder Fahrt aufnehmen. Von den vorgesehenen 100 Millionen Hektar Grünland wurden in den vergangenen zehn Jahren nur vier Millionen geschaffen. Das hängt freilich einerseits damit zusammen, dass gleich elf Anrainerstaaten betroffen sind: Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tschad, Sudan, Äthiopien, Eritrea und Dschibuti. Diese verfolgen im Konkreten mitunter unterschiedliche Ansätze bei der Begrünung, andererseits sind manche davon – wie der Liste zu entnehmen ist – nicht gerade beste Freunde, wobei sich ja die gesamte Region nicht unbedingt konfliktfrei darstellt. Kurz gesagt: Die Regierungen haben mitunter andere Probleme als das Bäumepflanzen – und die Bevölkerung erst recht, denn sie kämpft vielerorts gegen Lebensmittel- und Wasserknappheit, gegen Armut und Hunger. Da erscheint es freilich naheliegender, Feldfrüchte anzubauen anstelle eines Akazienwäldchens. Auch insgesamt ist das Projekt der „großen grünen Mauer“ nicht unumstritten, zumal einige Wissenschafter davon ausgehen, dass sich die Sahelzone nach den Dürre- und Trockenperioden seit den 1980er Jahren nun ohnedies wieder erholt und begrünt. Dem stehen wiederum Bevölkerungswachstum und Überbeanspruchung der Böden entgegen, was sehr wohl zu Erosion und Wüstenbildung beiträgt.
Man sieht also, dass das Problem schon ein weiteres ist – und nicht so einfach, wie man sich das in Paris und Berlin vielleicht vorstellen will. Die Zwangsbeglückung der Menschen in der Sahelzone mit Klima- und Umweltschutzprojekten mag letztlich einen nachhaltigen Zweck verfolgen – vor Ort und global –, doch zunächst wäre es notwendig, einmal das unmittelbare Überleben der Bevölkerung zu sichern. Und hier dreht man sich im Kreis: Es sind nicht zuletzt der europäische Imperialismus und seine Rohstoff- und Profitgier, die eine maximale Ausbeutung des afrikanischen Kontinents verlangen und die Zerstörung von lokalen Produktionsbedingungen bedingen. Es sind ökonomische und politische Machtinteressen der Europäer und Nordamerikaner, die in der weiteren Region Kriege, Bürgerkriege und Terrorismus implizieren, natürlich auch Waffen- und Menschenhandel, am Ende Vertreibung und Flucht, was wiederum am Grund oder auf Inseln des Mittelmeeres endet. Insofern zeigt sich, dass es um Zusammengänge geht, die unweigerlich mit dem Kapitalismus und Imperialismus zu tun haben – sie liefern die tieferen Ursachen der sozialen, politischen und ökologischen Miseren in Afrika, nicht deren Lösung. Daher müssen auch Umweltmaßnahmen letztlich in ein antiimperialistisches und sozialistisches Konzept eingebunden werden, wie es bei Thomas Sankara der Fall war.
Quelle: Der Standard