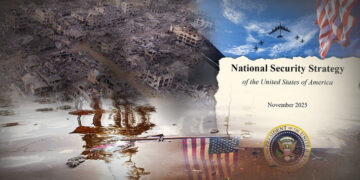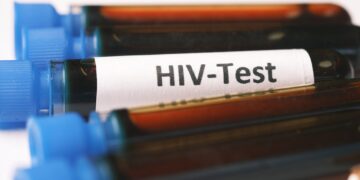2024 erschütterten zahlreiche tödliche Arbeitsunfälle Italien – oft bei Großprojekten, mit öffentlichen Auftraggebern, Subunternehmen und unzureichendem Arbeitsschutz. 27 Menschen starben – erstickt, verbrannt, zerquetscht –, viele davon jung, schlecht bezahlt und ohne Ausbildung. Der gemeinsame Nenner: Verantwortungslosigkeit, mangelnde Kontrollen und ein System, das Sicherheit dem Profit opfert.
Rom. 27 Tote, 27 Arbeiter, die nie wieder nach Hause zurückkehrten. Leben, die unter der Erde endeten – wie die fünf Arbeiter in den Abwasserkanälen von Casteldaccia und die sieben Techniker des Wasserkraftwerks von Enel Green Power in Bargi, ausgelöscht durch eine Explosion und verbrannt wie die beiden Mitarbeiter von Toyota Material Handling in Bologna oder die fünf Männer von Eni in Calenzano.
Frauen und Männer, die durch Ausbeutung getötet wurden, der sie sich aus Hunger gebeugt hatten – wie Aurora und Sara Esposito, Zwillingsschwestern, und Samuel Tafciu, der Jüngste von allen, gerade 18 geworden: Sie starben bei einer Explosion in einer illegalen Feuerwerksfabrik in Ercolano, in der sie für 250 Euro pro Woche arbeiteten. Zwei alleinerziehende Mütter und ein frischgebackener Vater, die unter prekären Bedingungen ums Überleben kämpften – getötet an einem Arbeitsplatz ohne Regeln.
Fehlende Sicherheit als gemeinsamer Nenner
Die ersten Todesopfer des Jahres – es war der 16. Februar – waren vier Bauarbeiter und ein Fahrer auf der Baustelle der Supermarktkette Esselunga in Florenz. Ein Dschungel aus Aufträgen, in dem jemand 61 Firmen gezählt hatte, die theoretisch Zutritt zur Baustelle hatten. „Diese Geschehnisse müssen in ihrer Gesamtheit verstanden werden, die Analyse muss bei den Gemeinsamkeiten beginnen“, sagt Bruno Giordano, Richter am Kassationsgericht und ehemaliger Direktor der Nationalen Arbeitsinspektion, einer der führenden Sicherheitsexperten Italiens.
Neben der Esselunga-Baustelle stehen auch Enel Green Power, Casteldaccia und Eni im Zentrum: „Sie haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Auftraggeber sind stets starke Akteure, bei denen es schwer vorstellbar ist, dass an Sicherheitsinvestitionen gespart wird“, betont Giordano. „In drei Fällen handelt es sich sogar um staatliche oder staatlich kontrollierte Unternehmen – eine Debatte über Sicherheitskosten ist dort eigentlich ausgeschlossen.“ Und doch landen wir immer wieder beim Thema Aufträge und Subaufträge. „Man müsste an dieser Stelle untersuchen, wie das konkrete Arbeitsverhältnis der Opfer aussah. Ich spreche nicht von den Verträgen zwischen Auftraggebern, Auftragnehmern und Subunternehmen, sondern vom tatsächlichen Arbeitsverhältnis der einzelnen Betroffenen.“
Ein besonders prägnantes Beispiel ist die Esselunga-Baustelle: Dutzende Firmen arbeiteten dort, fünf Menschen starben – Mohamed Toukabri, Mohamed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi und Luigi Coclite – beim Einsturz eines Stahlbetonträgers.
„Bei so langen Ketten wird die Verantwortung für die Sicherheit stets an kleine und mittlere Unternehmen delegiert, die sich den Auftrag durch Dumpingpreise sichern – und dabei oft am Lohn und an der Arbeitssicherheit sparen.“ Aber ein „starker“ Auftraggeber, betont der Richter, „kann sich keine Schutzlücken leisten.“
Die sieben Tote des Enel-Green-Power-Wasserkraftwerks
Kaum einen Monat nach dem Unglück von Florenz – für das kürzlich erste Festnahmen und Berufsverbote erfolgten – erschütterte ein weiterer Großunfall das Land. Am 9. April explodierte eine Turbine im achten Untergeschoss des Enel-Green-Power-Wasserkraftwerks in Bargi am Suviana-See im Apennin bei Bologna. Zwei Stockwerke der Anlage stürzten ein und wurden überflutet. Sieben Techniker starben – wie einst bei Thyssenkrupp in Turin: Paolo Casiraghi, Alessandro D’Andrea, Vincenzo Franchina, Vincenzo Garzillo, Mario Pisani, Adriano Scandellari und Pavel Petronel Tanase. Über ein Jahr später gibt es weder eine offizielle Rekonstruktion des Ablaufs noch Ermittlungen gegen konkrete Personen.
Vergast in der Kanalisation
Anders bei der Tragödie in Casteldaccia: Dort sind laut Staatsanwaltschaft und Gutachtern die Ursachen eindeutig. Eine Arbeitergruppe war im Auftrag der AMAP – dem rein öffentlich finanzierten Wasser- und Abwasserunternehmen von Palermo – zu Arbeiten in einem Abwassertank abgestellt worden. Am 6. Mai stiegen sie hinab und starben nacheinander: Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano und Giuseppe La Barbera – erstickten an den giftigen Gasen aus der Gärung der Fäkalien.
AMAP hatte den Auftrag an die Firma Tech vergeben, die ihn wiederum an Quadrifoglio weiterreichte. Es waren Routinearbeiten, einfache Wartung. Laut den Sachverständigen der Staatsanwaltschaft Termini Imerese unter Leitung von Elvira Cuti trugen die Arbeiter keine Schutzkleidung. „Keiner der Mitarbeiter der Auftraggeberfirma oder der Subfirma – mit Ausnahme von vielleicht einem – hatte eine spezifische Schulung zur Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen erhalten.“
Eni-Werk von Calenzano – Ermittlungen laufen
Auch im Eni-Werk von Calenzano, wo am 9. Dezember fünf Männer starben, sollen „schwere und unentschuldbare“ Fehler begangen worden sein. Die Toten: Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Gerardo Pepe, Franco Cirelli und Davide Baronti. Die Staatsanwaltschaft Prato ermittelt gegen neun Personen – darunter sieben Führungskräfte von Eni. Sie wirft ihnen vor, Wartungsarbeiten durchgeführt zu haben, obwohl der normale Betrieb der Tankwagenanlage weiterlief. Es wurden weiterhin Benzin und Diesel durch die Leitungen gepumpt, die LKWs fuhren wie gewohnt weiter. All das, so die Ermittler, auch wegen des „wirtschaftlichen Vorteils“, der daraus gezogen werden sollte.
Zweifel bei Toyota in Bologna
In Bologna starben zwei junge Männer – Lorenzo Cubello und Fabio Tosi – in einer Lagerhalle von Toyota Material Handling. Es war der 23. Oktober. Die Staatsanwaltschaft – vertreten durch Francesca Rago und die stellvertretende Chefermittlerin Morena Plazzi – hat seither Dutzende Zeugen vernommen und tausende Dokumente gesichtet, um ein klares Bild zu gewinnen und Verantwortliche zu identifizieren. Zwölf Personen stehen unter Verdacht, darunter auch Geschäftsführer Michele Candiani und zwei Vorgänger. Die zentralen Fragen bleiben: Wie wurden die Anlage geplant, installiert und gewartet? Welche Risiken bestanden für die Arbeiter? Welche Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen? War ein Notfallmechanismus vorgesehen? Und wie wurde die Wartung überwacht?
Zwischen Selbsterklärungen und Illegalität
Einerseits verweist der Unfall am Faito auf Selbsterklärungen, die an die ANSFISA (die Aufsichtsbehörde für Infrastrukturen) geschickt werden müssen – eine Behörde, die Giordano 2021 im Arbeitsparlament als „zergliedert und uneinheitlich“ beschrieb. Andererseits erinnert Ercolano an ein anderes Problem: „Die Explosion ereignete sich in einer illegalen Fabrik, in der für ein paar Euro und ohne Arbeitsvertrag gearbeitet wurde.“ Anders gesagt: „Das war Ausbeutung innerhalb einer Lieferkette völlig außerhalb jeder gesetzlichen Struktur.“ Damit sei man bei der Frage der Legalitätskontrolle, jenseits von Arbeitsinspektion oder staatlichen Behörden. „Die eine Frage, die man sich stellen muss, lautet: Wie kann es sein, dass sich eine unsichtbare Produktionskette entwickeln konnte, die in einer Villa begann und mit dem Barverkauf illegaler Böller endete?“, so Giordano.
Quelle: IlFattoQuotidiano