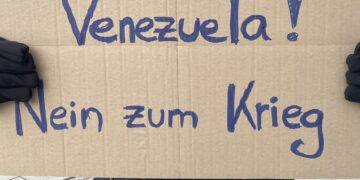Bundesregierung und Wirtschaftskammer machen ausgerechnet rund um den heutigen Tag der Pflege klar, dass sie kein Interesse an besseren Arbeitsbedingungen haben. Stattdessen soll Pflegepersonal aus den Philippinen die Lösung sein.
Wien. Geschlossene Spitäler, personell ausgedünnte Stationen und das jahrelange systematische Kaputtsparen des Gesundheitswesens haben sich in der Pandemie deutlich bemerkbar gemacht. Doch außer einem unverbindlichen „Danke“ hatte die Politik den Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen bisher nichts zu bieten. Die Milliardenhilfen flossen von Beginn an in Richtung Unternehmen; eine substanzielle Anhebung der Löhne und Gehälter, um mehr Menschen für Gesundheitsberufe zu gewinnen und somit auch den Personalnotstand mindern zu können, war nie ernsthaft angedacht.
Kapitalistische Logik schafft ein ineffizientes System
Aufgrund der miserablen Bedingungen in vielen Bereichen – Arbeitszeit, Stress, Bezahlung, Vereinbarkeit, ständige Einsparungen etc. – liegt die durchschnittliche Verweildauer etwa von Pflegekräften nur bei rund sechs Jahren. Die zunehmende Orientierung auf marktwirtschaftliche Kennzahlen führt auch hier im Endeffekt zu geringerer Effizienz – gut ausgebildetes Personal bleibt oft nicht in der Branche oder wechselt häufig zwischen Einrichtungen. Das lohnt sich gerade für private Betreiber aber trotzdem, solange die öffentliche Hand wesentlich zur Organisation und Finanzierung der Ausbildung beiträgt.
Die Wirtschaftskammer (WKÖ) wirbt jetzt in einem Pilotprojekt überhaupt gleich um Pflegekräfte aus den Philippinen, um den steigenden Bedarf zu decken. Das verursacht zwar enorme Rekrutierungskosten, dafür müssten auch die Anforderungen hinsichtlich der Sprachkenntnisse im Beruf gelockert werden – aber zumindest wäre die „Gefahr“ steigender Löhne und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen gebannt. Diese wären nämlich tatsächlich eine wirksame und nachhaltige Lösung des Pflegenotstands.
Bei den Spitalsärzten setzt die Bundesregierung auf überlange Arbeitszeiten – bis zu 55 Stunde pro Woche sollen es weiterhin „auf freiwilliger Basis“ sein. Das ist also scheinbar die Lösung für die selbstgeschaffenen Probleme sein: Begrenzung im Medizinstudium, unattraktive Einstiegsgehälter oder auch Nichtverlängerung von Verträgen bei politisch unliebsamen Ärzten, wie der SPÖ-dominierte Wiener Krankenanstaltenverbund 2016 im Fall Gernot Rainer vorlebte.