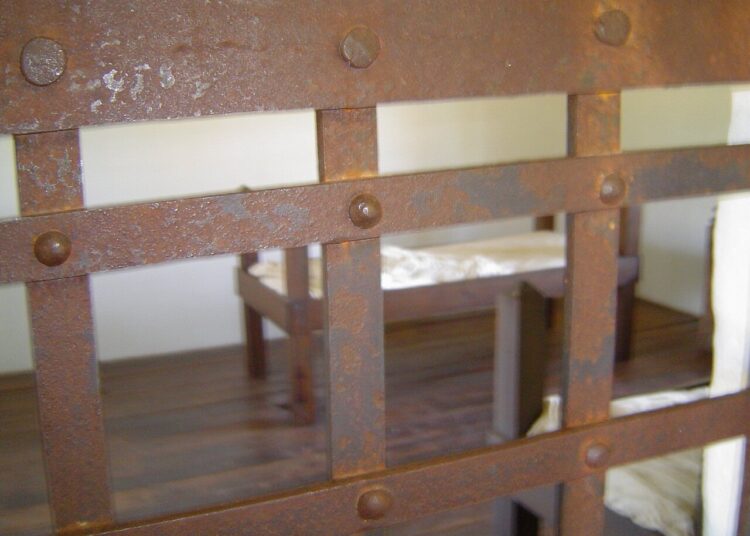Der Sturm auf das irakische Landwirtschaftsministerium Ende Juli wirkt auf den ersten Blick wie ein lokaler Machtkampf um Posten. Doch hinter dem Vorfall, bei dem zwei Brigaden der schiitisch dominierten Popular Mobilisation Forces (PMF, arabisch al-Hashd al-Shaabi) mit der Polizei zusammenstießen und ein Beamter getötet wurde, verbirgt sich eine tiefere Dynamik: Der irakische Staat ringt seit Jahren damit, wie er mit den mächtigen Milizen umgehen soll – Gruppen, die längst integraler Teil des politischen Systems geworden sind, aber zugleich die Autorität des Staates immer wieder infrage stellen.
Von der Anti-IS-Front zur politischen Macht
Die PMF wurden 2014 ins Leben gerufen, als der „Islamische Staat“ (IS) weite Teile des Irak und Syriens kontrollierte und Mossul zur Hauptstadt seines „Kalifats“ erklärte. Auf die Fatwa des schiitischen Großayatollahs Ali al-Sistani hin meldeten sich hunderttausende Freiwillige, viele in Milizen, die bereits im Widerstand gegen die US-Besatzung aktiv gewesen waren. Mit westlicher Unterstützung kämpften sie im Irak gegen den IS.
Diese Gruppen – unter ihnen Asaib Ahl al-Haq oder Kataib Imam Ali – erhielten teils direkte Unterstützung aus dem benachbarten Iran. Einige Kämpfer wurden in Syrien eingesetzt, um an der Seite der Regierung Baschar al-Assad gegen dschihadistische Gruppen zu kämpfen. Damit waren die Milizen von Beginn an nicht nur nationale Verteidiger, sondern auch Akteure in einem regionalen Machtgefüge, das bis heute wirkt.
2016 anerkannte das irakische Parlament die PMF offiziell als Teil der nationalen Sicherheitskräfte. Das eröffnete ihnen den Zugang zu staatlichen Budgets, Posten und Ressourcen. 2024 wurden ihnen 3,4 Milliarden US-Dollar zugewiesen – mehr als der gesamte Staatshaushalt Libanons. Gleichzeitig ist die genaue Mitgliederzahl unklar: Schätzungen gehen von rund 238.000 Kämpfern aus, doch die staatlichen Kontrollmechanismen sind schwach.
Gewalt als politisches Instrument
Obwohl die PMF offiziell in den Staatsapparat integriert sind, agieren viele ihrer Fraktionen nach eigenen Regeln. Immer wieder setzen sie Waffen ein, um politische und wirtschaftliche Interessen zu sichern. Das zeigte sich im Juli, als Brigaden das Landwirtschaftsministerium besetzten, weil ein ihnen nahestehender Funktionär abgesetzt worden war.
Ähnliche Beispiele gibt es zahlreiche: 2021 attackierten pro-iranische PMF-Gruppen mit einer Drohne das Haus des damaligen Premierministers Mustafa al-Kadhimi – offenbar aus Frust über Verluste bei den Parlamentswahlen. Zuvor hatten Milizionäre bei den Protesten von 2019 hunderte Demonstrierende getötet, die gegen Korruption und Machtmissbrauch auf die Straße gingen.
Die Episode im Landwirtschaftsministerium reiht sich also in ein Muster ein: Die Milizen verstehen sich einerseits als Teil des Staates, sind aber jederzeit bereit, dessen Regeln zu brechen, wenn es ihrem Machterhalt dient.
Ein riskantes neues Gesetz
Um diese Ambivalenz zu überwinden, arbeitet die Regierung von Premierminister Mohammed Schia al-Sudani an einem neuen Gesetz. Es soll die PMF noch enger in die staatliche Hierarchie eingliedern, alle Kämpfer offiziell anstellen und sie klar dem Oberkommando des Premiers unterstellen.
Befürworter sehen darin eine Chance, die Milizen durch institutionelle Einbindung zu disziplinieren und ihre Eigenmächtigkeit zu begrenzen. Sie argumentieren, dass legale Strukturen die Bereitschaft stärken könnten, sich an staatliche Vorgaben zu halten.
Kritiker hingegen warnen, das Gesetz werde den Milizen lediglich einen legalen Schutzschild verschaffen. Statt die Macht der Gruppen zu zügeln, könnte es ihre Position im Staat weiter verfestigen – gerade weil einige Fraktionen enge Beziehungen zum Iran pflegen. Zudem sieht der Entwurf vor, PMF-Mitgliedern Zugang zu geheimdienstlichen Informationen zu gewähren. Skeptiker befürchten, dass sensible Daten an Teheran weitergeleitet werden könnten.
Internationale Dimension
Die Debatte ist nicht nur eine innere irakische Angelegenheit. Für die USA und Israel sind die PMF zentrale Akteure im regionalen Machtkampf. Beide Staaten betrachten sie als „iranische Stellvertreter“ und warnen vor einer institutionellen Absicherung ihres Einflusses. Washington übt daher massiven Druck auf Bagdad aus, das Gesetz nicht zu verabschieden. US-Außenminister Marco Rubio soll Premier Sudani gewarnt haben, das Gesetz würde „iranischen Einfluss und bewaffnete Terrorgruppen institutionalisieren“.
Gleichzeitig zeigt die jüngste Vergangenheit, dass die PMF nicht immer im Sinne Teherans handeln. Während des kurzen Krieges zwischen Iran und Israel im Juni 2025 griffen sie keine US-Einrichtungen an – offenbar aus Furcht, selbst zum Ziel israelischer Angriffe zu werden. Für viele Fraktionen stehen wohl eigene Patronagenetze, Ressourcen und Machtbasen im Vordergrund, weniger ideologische Loyalität zu Teheran.