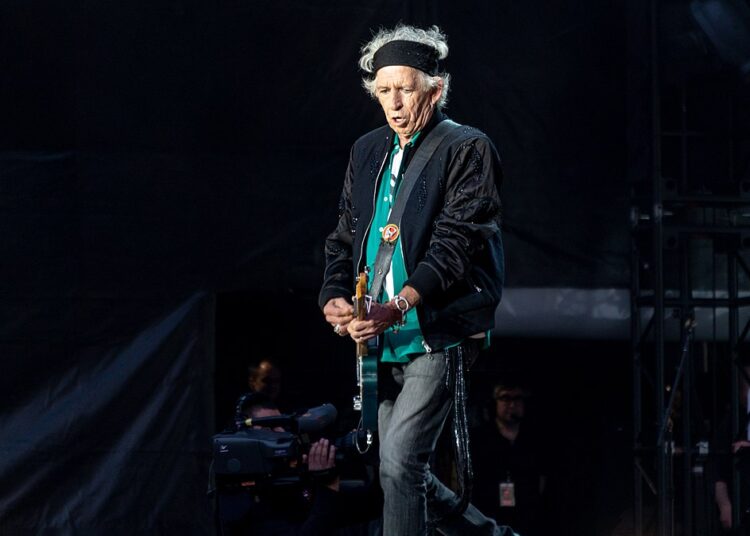Es hätte ein Wendepunkt sein können: Als der Oberste Richter Paul Goldspring Ende September die Terrorismusklage gegen Liam O’Hanna alias Mo Chara, Frontmann der nordirischen Rap-Gruppe Kneecap, für „unrechtmäßig“ erklärte, brandete Applaus im Londoner Gerichtssaal auf. Doch das Verfahren wurde nicht etwa eingestellt, weil der Vorwurf substanzlos war – sondern weil die Staatsanwaltschaft eine Frist versäumt hatte. Der bürokratische Fehler entlarvt unfreiwillig, wie schwach die juristische Grundlage der Anklage war. Und er legt offen, was viele Unterstützer von Anfang an betonten: Hier ging es nie um Terrorismus, sondern um politische Einschüchterung.
Die Anschuldigungen stammten aus einem Konzert im November 2024, bei dem Mo Chara eine Flagge hochhielt, die den libanesischen Hisbollah zugeordnet wird, und die Worte „up Hamas, up Hezbollah“ rief. Für die britische Justiz reichte das, um ein Anti-Terror-Verfahren einzuleiten. Doch wer die politische Haltung Kneecaps kennt, weiß: Die Band steht für antikolonialen Widerstand, für die Artikulation einer irischen Identität – und für eine kompromisslose Solidarität mit Palästina. Diese Haltung ist unbequem für eine britische Politik, die sich international als moralische Instanz inszeniert, aber im eigenen Land die Stimmen der Dissidenz kriminalisiert.
Schon im Sommer dieses Jahres war Kneecap ins Zentrum der Debatte geraten. Auf dem Glastonbury Festival trat Mo Chara mit einem palästinensischen Keffiyeh auf und rief „Free Palestine“ in die Menge. 30.000 Menschen antworteten im Chor. Es war ein Moment kollektiver Auflehnung, den die Regierung sogleich als „unangemessen“ brandmarkte – Premierminister Keir Starmer persönlich versuchte, den Auftritt politisch zu diskreditieren. Noch deutlicher war die Reaktion der BBC, die die Sets von Kneecap und auch der Band Bob Vylan nicht übertrug. Stattdessen sprach man von „beleidigenden Kommentaren“ – und verhinderte, dass diese Bilder in die Öffentlichkeit drangen.
Die Muster sind eindeutig: Kultur wird nicht mehr als Raum kritischer Auseinandersetzung verstanden, sondern als potenzielle Bedrohung, die kontrolliert oder zensiert werden muss. Künstlerinnen und Künstler, die den Mut haben, Missstände klar zu benennen, sehen sich überwacht, verklagt oder ausgeladen. In Deutschland etwa wurden Kneecap im Frühjahr gleich von mehreren Festivals ausgeladen, weil sie in Coachella pro-palästinensische und anti-israelische Botschaften zeigten.
Dabei ist die politische Symbolik ihrer Haltung kaum radikal, wenn man den historischen Kontext bedenkt. In Irland gilt Solidarität mit Palästina seit Jahrzehnten als Teil der eigenen postkolonialen Erfahrung. Viele sehen in der israelischen Besatzung Parallelen zur britischen Herrschaft in Irland. Dass Kneecap in dieser Tradition stehen, ist folgerichtig – und wird von einer breiten Basis getragen.
Die britische Regierung aber geht den entgegengesetzten Weg: Die Innenministerin Yvette Cooper hat die Gruppe Palestine Action mit einem Anti-Terror Paragraphen verboten, die mit direkten Aktionen gegen Waffenlieferungen an Israel protestiert. Militanz gegen Rüstungsexporte wird so mit Terrorismus gleichgesetzt. Wer gegen Massaker, Belagerung und Hungerblockade protestiert, soll kriminalisiert werden.
Mo Chara brachte es nach dem Ende seines Prozesses auf den Punkt: „Es ging nie um Terrorismus. Es ging immer nur um Gaza und darum, was passiert, wenn man es wagt, seine Stimme zu erheben.“ Dass ausgerechnet ein Fristversäumnis die Einstellung der Klage erzwang, ist ein symbolträchtiger Zufall. Denn der Fall zeigt: Die Repressionsmaschinerie mag mächtig erscheinen, aber sie ist brüchig.
Das Beispiel Kneecap macht deutlich, dass die eigentliche Gefahr nicht von Rappern mit Fahnen ausgeht – sondern von einer politischen Kultur, die jede Form von widerständiger Solidarität pathologisiert. Wenn der Staat mehr Angst vor einem Konzert hat als vor Kriegsverbrechen, dann ist es höchste Zeit, die Prioritäten infrage zu stellen.
Quelle: HipHop.de/ZdA