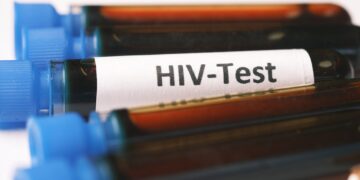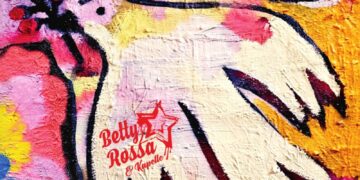In Griechenland spitzt sich die Auseinandersetzung um ein neues Arbeitsgesetz dramatisch zu. Die konservative Regierung in Athen plant, die tägliche Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden auszudehnen und zugleich „flexible“ Arbeitszeitmodelle einzuführen. Gewerkschaften sprechen von einem „arbeitsrechtlichen Monster“ und rufen zu landesweiten Streiks und Protesten auf.
Hinter der nationalen Gesetzgebung steht jedoch nicht nur die Regierung Mitsotakis. Wie aus einer Antwort der EU-Kommission auf eine Anfrage der kommunistischen Europaabgeordneten des KKE hervorgeht, sind die Richtlinien aus Brüssel selbst der Kern des Problems. Die vielzitierte Richtlinie 2003/88 erlaubt – entgegen dem Bild, das manche Oppositionsparteien zeichnen – tatsächlich 13-Stunden-Arbeitstage, solange im Viermonatsdurchschnitt die Wochenarbeitszeit 48 Stunden nicht übersteigt. Damit wird eine permanente Flexibilisierung des Arbeitstags legitimiert, die Beschäftigte zu reinen Spielbällen der Profitinteressen macht.
Zerschlagung kollektiver Rechte
Besonders brisant ist, dass individuelle Abmachungen zwischen Chef und Beschäftigtem künftig stärker gelten sollen als kollektiv ausgehandelte Tarifverträge. Damit wird der Kern gewerkschaftlicher Organisation ausgehöhlt. Gleichzeitig sollen Überstundenzuschläge, Sozialabgaben der Arbeitgeber und sogar der Anspruch auf durchgehende Urlaubswochen beschnitten werden. Der Jahresurlaub könnte in vier Mini-Blöcke zerstückelt werden – ein Schlag gegen jede Erholung.
Solche Regelungen sind kein „griechischer Sonderweg“. Sie reihen sich nahtlos in die europäische Agenda der Arbeitszeitflexibilisierung ein. Schon seit Jahren verweisen Regierungen – ob in Wien, Berlin oder Athen – auf „europäische Normalität“, wenn es darum geht, Arbeitszeitgesetze aufzuweichen und die Interessen von Kapitalverbänden durchzusetzen.
Folgen für die arbeitenden Menschen
Die Realität hinter den Paragrafen zeigt sich tragisch im Alltag: In Griechenland sterben fast jede Woche Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Arbeit. Ein besonders drastisches Beispiel lieferte kürzlich ein Busunglück mit dutzenden Verletzten, darunter Kinder – die Fahrerin war nach mehreren 16-Stunden-Schichten schlicht übermüdet.
Die offizielle Erzählung von „mehr Flexibilität“ bedeutet in Wahrheit mehr Unsicherheit, gesundheitliche Gefahren und eine Rückkehr zu Arbeitsbedingungen, die an die frühen Industriezeiten erinnern. Während Wissenschaft und Technologie längst die Grundlage für kürzere Arbeitszeiten legen könnten, sollen Beschäftigte im 21. Jahrhundert de facto wieder zu Tagelöhnern degradiert werden.
Widerstand wächst
Das griechische Gewerkschaftsfront PAME fordert daher die Rücknahme des Gesetzes und kämpft für die alte Forderung der Arbeiterbewegung: 7 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, 35 Stunden insgesamt – bei höheren Löhnen und verbindlichen Kollektivverträgen. Auch in Österreich sollten Beschäftigte genau hinschauen. Denn was heute in Athen erprobt wird, könnte morgen schon in Wien Realität sein. Der 12-Stunden-Arbeitstag wurde schließlich in Österreich schon vor einigen Jahren von der damaligen ÖVP-FPÖ-Regierung in Komplizenschaft mit der verbrecherischen, sozialdemokratischen Gewerkschaftsführung eingegführt, die jeden Widerstand in den Betrieben erstickt hat.
Die entscheidende Lehre aus Griechenland lautet: Auf EU-Institutionen oder sozialpartnerschaftliche Floskeln ist kein Verlass. Nur der organisierte Kampf von unten kann verhindern, dass die Errungenschaften des 20. Jahrhunderts – Achtstundentag, bezahlter Urlaub, gewerkschaftliche Mitbestimmung – im Namen von Wettbewerbsfähigkeit und Profitmaximierung geopfert werden.