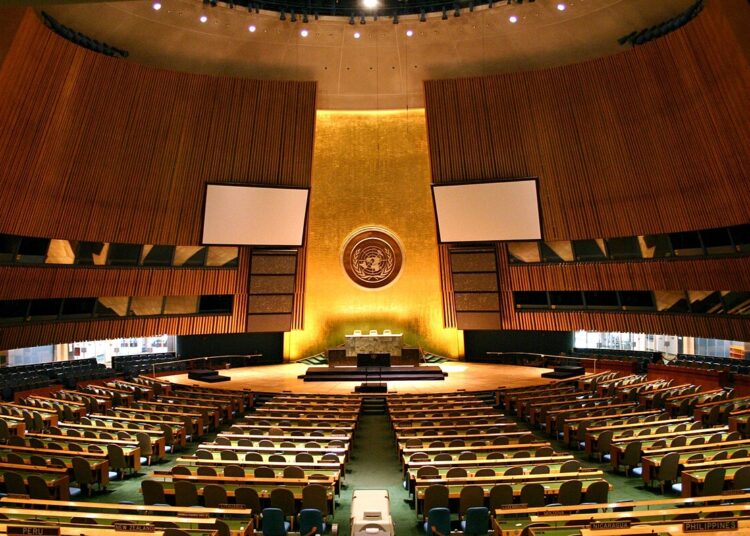Die libanesische Regierung hat begonnen, palästinensische Gruppen in ihren Flüchtlingslagern zu entwaffnen. Den Auftakt machte das Camp Burj al-Barajneh in den südlichen Vororten von Beirut. Soldaten der libanesischen Armee sicherten die Zufahrtsstraßen, während Lastwagen Waffen aus dem Lager transportierten. Offiziell handelt es sich um den ersten Schritt eines umfassenden Plans, mit dem der Staat endlich das Gewaltmonopol für sich beanspruchen will. Doch was auf den ersten Blick nach einer Stärkung staatlicher Autorität aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als hochriskantes politisches Experiment.
Schon vor Ort wurde deutlich, wie tief die Meinungen auseinandergehen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner begrüßten die Abgabe der Waffen, die nach ihrer Einschätzung längst mehr gegen Palästinenserinnen und Palästinenser selbst als gegen Israel eingesetzt worden seien. Andere protestierten heftig: Waffen seien Ehre, Schutz und das letzte Symbol einer Identität, die seit 1948 von Flucht, Entrechtung und dem Verlust der Heimat geprägt ist. Eine junge Krankenschwester sagte, Fatah solle seine Waffen abgeben, „weil sie nur gegen das eigene Volk eingesetzt werden“. Hamas jedoch solle bewaffnet bleiben – eine Aussage, die die Ambivalenz zwischen innerpalästinensischer Rivalität und dem Bedürfnis nach Selbstverteidigung verdeutlicht.
Die Initiative geht zurück auf ein Abkommen zwischen dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem Vorsitzenden der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas (Fatah). Beide hatten bereits im Mai bekräftigt, dass allein der libanesische Staat das Recht haben dürfe, Waffen zu kontrollieren. Dass der Schritt gerade jetzt vollzogen wird, ist kein Zufall. Seit dem von den USA unterstützten Waffenstillstand zwischen Israel und Hisbollah Ende 2024 drängen Washington, Tel Aviv und europäische Hauptstädte auf eine „Normalisierung“. Dazu gehört auch die Forderung, dass Palästinenserinnen und Palästinenser entwaffnet, die Lager langfristig aufgelöst und die Geflüchteten in die libanesische Gesellschaft integriert werden sollen. Offiziell klingt dies nach einer humanitären Lösung. In Wahrheit droht jedoch, dass die palästinensische Nationalität und das Recht auf Rückkehr untergraben werden – Grundpfeiler, die für viele Palästinenserinnen und Palästinenser nicht verhandelbar sind.
Die Rolle von Mahmud Abbas ist dabei umstritten. Kritikerinnen und Kritiker werfen ihm vor, die Entwaffnung zu forcieren, um die politische Konkurrenz von Hamas, Islamischem Dschihad oder kleineren linken Organisationen auszuschalten. Selbst innerhalb der Fatah stößt er damit auf Widerstand. Menschenrechtsanwälte warnen vor einer gefährlichen Entwicklung: Entweder werde Abbas eine ihm unterstellte Polizei einsetzen und damit interne Kämpfe auslösen, oder er suche die Zusammenarbeit mit libanesischen Christinnen und Christen – mit der Gefahr, dass alte Wunden des Bürgerkriegs neu aufreißen. Die Phalange, ursprünglich aus der maronitisch-christlichen nationalen Jugendbewegung hervorgegangen, kooperierte im libanesischen Bürgerkrieg mit Israel und verübte schwere Verbrechen. Unteranderem ist die Phalange für das Massaker im westbeiruter Flüchtlingslager Sabra und Schatila verantwortlich. Unter Aufsicht des israelischen Militärs wurden hunderte palästinensische Flüchtlinge im Lager von Milizen der Phalange ermordet.
Nicht minder brisant ist der Zusammenhang mit der angekündigten Entwaffnung der Hisbollah. Westliche Staaten fordern, dass nach den Palästinenserinnen und Palästinensern auch die schiitische „Partei Gottes“ ihre Waffen abgibt. Doch viele Beobachterinnen und Beobachter halten dies für eine Illusion: Hisbollah und Amal verfügen über ein größeres Waffenarsenal und mehr Kämpfer als die libanesische Armee. „Diese Armee wird niemals gegen Hisbollah kämpfen“, sagt ein langjähriger Kenner der politischen Szene in Beirut. Ein Entwaffnungsbeschluss, so die Sorge, würde nicht Stabilität schaffen, sondern das Land erneut spalten.
Die aktuelle Dynamik rührt zugleich an eine historische Dimension, die nicht ausgeblendet werden darf. Seit der Vertreibung von 1948 leben hunderttausende Palästinenserinnen und Palästinenser im Libanon, rechtlich entrechtet und in Lager gedrängt. Manche Orte, wie das christlich geprägte Camp Dbayeh nördlich von Beirut, sind nahezu waffenfrei und gleichen eher einem Dorf. Andere Lager gelten als Hochburgen bewaffneter Fraktionen. Allen gemeinsam ist jedoch ein Gefühl von Vorläufigkeit, Ausgrenzung und Unsicherheit. Die Entwaffnung trifft also auf eine Bevölkerung, die seit Jahrzehnten im Wartestand lebt – ohne Aussicht auf Rückkehr, ohne volle Bürgerrechte im Libanon, und nun womöglich auch ohne den letzten Rest an Selbstverteidigung.
Die libanesische Regierung präsentiert die Entwaffnung als Schritt in Richtung Souveränität. Doch viele Palästinenserinnen und Palästinenser sehen darin das Gegenteil: einen Versuch, sie politisch zu entmündigen, während Israel weiter bombardiert, die USA Druck ausüben und die eigene Führung in Ramallah interne Machtkämpfe austrägt und immer wieder mit der israelischen Regierung kooperiert, um den bewaffneten Widerstand gegen die israelische Armee im Westjordanland zu schwächen. Der Verweis auf das „Gewaltmonopol des Staates“ wirkt in einem Land, dessen Institutionen selbst tief zersplittert sind, wenig überzeugend. Am Ende könnte das Experiment genau das Gegenteil bewirken: Statt Stabilität bringt es neue Unsicherheit, statt Einigung neue Spaltung.
Für die libanesische Gesellschaft ist die Entwaffnung der Palästinenserinnen und Palästinenser deshalb ein doppeltes Wagnis. Einerseits verspricht sie internationale Anerkennung und die Aussicht, dass Israel sich aus Teilen des Südens zurückzieht. Andererseits droht sie, alte Bürgerkriegsfronten neu zu beleben und die palästinensische Bevölkerung in eine noch größere Schutzlosigkeit zu treiben. Zwischen äußeren Forderungen, inneren Rivalitäten und der historischen Bürde der palästinensischen Frage bleibt offen, ob Libanon damit Stabilität gewinnt – oder den nächsten großen Konflikt heraufbeschwört.
Quelle: AJ/L’Orient Today/al Mayadeen/jW/jW/jW