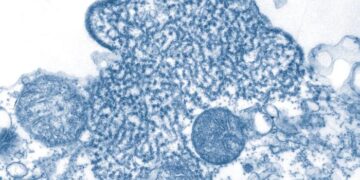Kommentar von Lukas Haslwanter, Mitglied des Parteivorstandes und der Internationalen Kommission der Partei der Arbeit Österreichs
Vor 80 Jahren wurde der große antifaschistische Sieg der Völker über den deutschen Faschismus errungen. Heute muss wieder daran erinnert werden, dass der Faschismus kein Betriebsunfall war und Hitler nicht einfach das absolute Böse. Der Faschismus entspringt dem Kapitalismus. Der Faschismus ist der entfesselte Terror des Monopolkapitals gegen die Arbeiterklasse zur Verteidigung und Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung.
Weder der österreichische Faschismus der Christliche-Sozialen Partei – Dollfuß‘ und Schuschniggs – noch der deutsche Faschismus der Nazis waren ein Unglück. Sie wurden gefördert und in Stellung gebracht vom Monopolkapital und dem bürgerlichen Staat, um den revolutionären Schutt der revolutionären Erhebungen der Arbeiterklasse am Ende des ersten Weltkrieges zu beseitigen und die permanente Bedrohung durch eine gut organisierte und in Teilen bewaffnete Arbeiterklasse zu beseitigen. Sie waren die Rache der herrschenden Klasse für die nicht zu Ende gebrachte Revolution von 1918, sie vollendeten das von der Sozialdemokratie begonnenen Werk der Sicherung der Herrschaft des Monopolkapitals.
Weit verbreitet ist die Legende, der Faschismus wäre an die Macht gekommen, weil die Kommunistinnen und Kommunisten die Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie verweigert hätten. Die Wahrheit ist aber eine andere. Die Sozialdemokratie hat die Arbeiterklasse und die Völker 1914 verraten und die eigene Monopolbourgeoisie im mörderischen Wüten des Ersten Weltkrieges unterstützt. Millionen Arbeiter ließen ihr Leben an allen Kriegsfronten für die Neuaufteilung der Welt unter den Imperialisten.
Die Sozialdemokratie und die Faschisten
Als die Arbeiterinnen und Arbeiter unter dem Eindruck der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution im zaristischen Russland 1917 begannen, auch in den westeuropäischen Ländern zu revoltieren, war die Sozialdemokratie darum bemüht, die Kämpfe einzuhegen und zu bremsen. Im Jänner 1918 fand der größte Streik in der österreichischen Geschichte statt. Im Verlauf des Streiks vom 3. Jänner bis zum 25. Jänner 1918 traten über 800.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der damaligen Donaumonarchie in den Streik. Der Streik schwappte schließlich auch in das Deutsche Kaiserreich über, wo ab dem 25. Jänner ebenfalls zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter in den Streik traten. Im Zentrum stand die Forderung nach Brot und Frieden, die Sozialdemokratie in Österreich und in Deutschland unternahm alles Mögliche, um die Streiks einzudämmen und zu kanalisieren.
Im Verlauf des weiteren Jahres 1918 kam es zur Gründung revolutionärer und linksradikaler Organisationen außerhalb der Sozialdemokratie und die Arbeiterklasse war kaum mehr zu bremsen. Im Herbst 1918 kam es schließlich zu revolutionären Aufständen von Arbeiterinnen, Arbeitern und Soldaten. Die Sozialdemokratie schwankte und drohte die Führung zu verlieren. Im November 1918 wurde schließlich die Kommunistische Partei in Österreich gegründet, die zu einem großen Teil aus eben jenen linksradikalen und revolutionären Organisationen hervorging. Allerdings fehlte es an einer kampferprobten, revolutionären Führung, die fest verankert war in der Arbeiterklasse, wie es sie in Russland mit den Bolschewiki gegeben hatte. Bis 1919 konnte die Sozialdemokratie gemeinsam mit den bürgerlichen Parteien und dem Monopolkapital ihre Herrschaft absichern und stabilisieren. Insbesondere in Deutschland, wo es auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit revolutionären Arbeiterinnen, Arbeitern und Soldaten kam, bediente sich die Sozialdemokratie bereits damals bewaffneter, faschistischer Verbände. Revolutionäre wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wurden ermordet. In Österreich war der Einfluss der Kommunistischen Partei wesentlich geringer und die Sozialdemokratie bediente sich eines verbalen Radikalismus, um die Arbeiterklasse zu bremsen und in die Irre zu führen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war ein radikaler und aggressiver Antikommunismus fixer Bestanteil sozialdemokratischer Propaganda und Agitation. Die Kommunistinnen und Kommunisten wurden als rotlackierte Faschisten diffamiert.
Es war, wie sich in aller Deutlichkeit zeigt, nicht die kommunistische Bewegung, die nicht bereit war, mit der sozialdemokratischen Führung zusammenzuarbeiten, die dem Faschismus den Weg bereitete. Es waren die Verräter in der Führung der sozialdemokratischen Parteien, die die Herrschaft des Monopolkapitals absicherten, sich eines aggressiven Antikommunismus bedienten und bereit waren, mit faschistischen Verbänden gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung zusammenzuarbeiten.
In Deutschland, wie auch in Österreich hatte die Sozialdemokratie keine Skrupel, auf Arbeiterinnen und Arbeiter zu schießen. Am 14. Juli 1927 wurden mehrere Mitglieder der faschistischen Heimwehr im sogenannten Schattendorfer Urteil freigesprochen, nachdem sie einen kroatischen Arbeiter und ein 6‑jähriges Kind erschossen hatten. Während die Parteizeitung der österreichischen Sozialdemokratie zu Protesten aufrief, unternahm die Partei keinerlei Versuche, die Proteste am 15. Juli in organisierte Bahnen zu lenken. Als die Protestierenden schließlich den Justizpalast anzündeten und die Feuerwehr am Durchkommen hinderten, ließ der Wiener Polizeipräsident Johann Schober die Polizei mit Waffen aus Bundesheerbeständen ausrüsten und auf die Menge schießen. 84 Arbeiterinnen und Arbeiter wurden ermordet, mehr als 500 wurden verletzt. Die Sozialdemokratische Partei, die in Wien regierte, hielt ihre Hand schützend über Schober. Ähnliches ereignete sich am Berliner Blutmai. Vom 1. Mai bis zum 3. Mai 1929 ließ der sozialdemokratische Polizeipräsident auf jeden Versuch, eine Maidemonstration der Arbeiterinnen und Arbeiter zu organisieren, schießen. 33 Menschen wurden von der Polizei ermordet, beinahe 200 wurden verletzt.
Als sich zu Beginn der 1930er Jahre ein weiteres Erstarken faschistischer Bewegungen abzeichnete und die Gefahr eines neuen imperialistischen Krieges angesichts der Wirtschaftskrise von 1929 immer drohender wurde, wandten sich die Kommunistinnen und Kommunisten auch an die Führung der Sozialdemokratie, um eine Einheit der Arbeiterbewegung gegen die drohende faschistische und Kriegsgefahr herzustellen. Die verräterische sozialdemokratische Führung lehnte dies ab und verschärfte ihre antikommunistische Agitation noch weiter.
Die faschistische Diktatur in Österreich und die Sozialdemokratie
Im Jahr 1933 ging die Christlich-Soziale Partei mit Engelbert Dollfuss an ihrer Spitze schließlich daran, den bürgerlichen Parlamentarismus endgültig beiseite zu räumen. Das Parlament wurde unter Ausnutzung eines Fehlers in der Geschäftsordnung am 4. März 1933 ausgeschaltet. Drei Tage später erfolgten ein Versammlungsverbot und die Einschränkung der Pressefreiheit. Als die deutschnationale und sozialdemokratische Opposition am 15. März versuchte, das Parlament erneut zusammentreten zulassen, ließ die Regierung das Parlament von der Polizei umstellen und hinderte die Abgeordneten am Betreten des Parlaments. Die Sozialdemokratie nahm dies hin, ohne irgendeine Form des politischen Kampfes zu organisieren, weder die Ausrufung eines Generalstreiks noch die Mobilisierung des Schutzbundes, um ein Zusammentreten des Parlaments zu erzwingen, erfolgte.
Die Christlich-Soziale Regierung ging nun endgültig in die Offensive. Am 31. März erfolgte das Verbot des sozialdemokratischen Schutzbundes, während die Rechtmäßigkeit bewaffneter faschistischer Verbände, wie der Heimwehr, bestätigt wurde. Am 10. Mai wurde die Aussetzung aller Wahlen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene verfügt. Am 26. Mai folgte das Verbot der Kommunistischen Partei, der Kommunistische Jugendverband war bereits 1931 verboten worden. Die Sozialdemokratische Partei wurde nicht verboten, da von ihr ohnehin keine Gefahr ausging und sie keinerlei Widerstand gegen die Ausschaltung der bürgerlichen Demokratie unternahm. Am 19. Juni wurden schließlich auch die österreichischen Nazis verboten, nach einem Bombenanschlag auf einen jüdischen Juwelier in Wien-Meidling.
Ab September 1933 begann sich die faschistische „christlich-soziale“ Regierung endgültig auf die Reste der organisierten Arbeiterbewegung zu konzentrieren. Hausdurchsuchungen und Verhaftungen von Kommunistinnen und Kommunisten, Schutzbundführern, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern standen zunehmend auf der Tagesordnung. Entgegen den Vorgaben der sozialdemokratischen Parteiführung begann es an der Basis zu brodeln und sich zunehmend Widerstand gegen die faschistische Regierung zu bilden. Im Februar 1934 beschloss der Republikanische Schutzbund in Linz schließlich, keine weiter Waffensuche der Polizei sowie keine weiteren Verhaftungen mehr zu dulden. Der Beschluss wurde auch an die sozialdemokratische Parteiführung weitergegeben. Als die Polizei am Morgen des 12. Februars 1934 anrückte, um das sozialdemokratische Parteiheim „Hotel Schiff“ in Linz zu durchsuchen, eröffneten die Arbeiter das Feuer. In den folgenden Tagen breitete sich der bewaffnete Kampf gegen die faschistische Diktatur auf große Teile von Österreich aus. Vielerorts griffen die Arbeiter zu den Waffen und verteidigten sich heldenhaft gegen Polizei, faschistische Verbände und Bundesheer. Die Kommunistische Partei unterstützte den bewaffneten Widerstand nach Kräften und vielerorts in Österreich kämpften Kommunistinnen und Kommunisten gemeinsam mit Mitgliedern des sozialdemokratischen Schutzbundes. Die KP war jedoch zu klein, um die Führung des Kampfes zu übernehmen. Die sozialdemokratische Parteiführung unternahm gleichzeitig alles, um den Kampf scheitern zu lassen und der endgültigen Durchsetzung der faschistischen Diktatur den Boden zu bereiten. Die Parteiführung unterließ es, einen Generalstreik auszurufen und so zu verhindern, dass das Bundesheer Artillerie und große Verbände in den Gebieten der Kampfhandlungen zusammenziehen kann. Sie untersagte den Arbeitern jede Form von offensiven Aktionen, so dass die Arbeiter sich vielerorts in den Parteiheimen verschanzten und auf das Heranrücken von Polizei und Bundesheer warteten. Anderenorts verweigerten Schutzbundführer die Herausgabe von Waffen an Arbeiter, die sich an den Kämpfen beteiligen wollten.
Nach drei Tagen waren die sogenannten Feburarkämpfe niedergeschlagen worden. Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter waren von Polizei, bewaffneten faschistischen Verbänden und Bundesheer bei den Kämpfen getötet oder verletzt worden. In den folgenden Tagen wurden weitere standrechtlich hingerichtet oder im Anhaltelager Wöllersdorf eingesperrt. Die Sozialdemokratische Partei wurde verboten, die Parteiführung hatte sich schon während der Kämpfe ins Ausland abgesetzt.