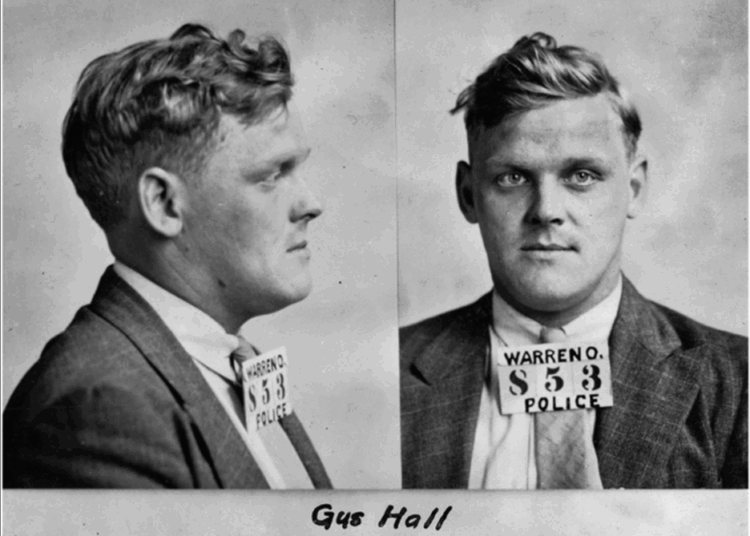Am 15. Juli 1927 gab es in Wien Massenproteste der Arbeiterschaft gegen den gerichtlichen Freispruch dreier faschistischer Mörder. Die Regierung ließ die Polizei mit Militärkarabinern ausrücken und ein Massaker veranstalten: 89 Tote blieben auf den Straßen Wiens zurück.
Der 15. Juli 1927 wird von der bürgerlichen und sozialdemokratischen Geschichtsschreibung vor allem als Tag des Wiener Justizpalastbrandes reflektiert. Doch für die revolutionäre Bewegung war es der Tag des Massenprotestes und des Widerstandes gegen den drohenden Faschismus. Die bürgerliche Staatsmacht richtete unter den hunderttausenden Demonstranten ein Massaker an und verwirklichte ihre Version eines „blutigen Freitags“, der schließlich eine wichtige Etappe bei der Durchsetzung der austrofaschistischen Diktatur sein sollte.
Die Vorgeschichte: Am 30. Jänner 1927 waren im burgenländischen Ort Schattendorf Kundgebungen des sozialdemokratischen Republikanischen Schutzbundes und des faschistischen Frontkämpferbundes aufeinandergestoßen. Dabei hatten die Faschisten, die der christlichsozialen-deutschnationalen Regierung nahestanden, ein sechsjähriges Kind und einen Kriegsinvaliden erschossen. Im darauffolgenden Prozess gegen drei Täter, die auf Notwehr plädierten, entschieden die Geschworenen mit sieben zu fünf Stimmen auf Mord, doch die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung wurde damit verfehlt. Der vorsitzende Richter musste die Angeklagten am 14. Juli 1927 freisprechen und entlassen.
Als die Wiener Arbeiterschaft im Laufe des Tages und am Abend von dem Urteil erfuhr, war die Empörung groß. Während die SP-Führung zu ihrer üblichen Taktik der antizipierten Kapitulation überging, legten die Arbeiter am Vormittag des 15. Juli – ein Freitag – fast überall die Arbeit nieder und formierten sich zu Protestmärschen in die Innenstadt, mit dem Ziel Parlament, um die Aufhebung des Schandurteils zu fordern. Die KPÖ unterstützte diese Vorgehensweise, die Schutzbund-Führung musste sie angesichts der Tatsachen sanktionieren. Bis zu 200.000 Menschen waren auf die Ringstraße geströmt, als berittene Polizisten, mit Pistolen und Säbeln bewaffnet, begannen, die Menge weg von der Ringstraße in Richtung Schmerlingplatz zu treiben. Während dies anfänglich gelang, nutzen die Arbeiter schließlich ihre zahlenmäßige Übermacht, um dagegenzuhalten. In der Lichtenfelsgasse wurde ein Wachzimmer erstürmt, und als aus der Polizeistation im Justizpalast Schüsse fielen, drangen die Demonstranten auch in diesen ein. Zur Mittagsstunde wurde im Gebäude Feuer gelegt, das rasch um sich griff. Für die Feuerwehr gab es lange kein Durchkommen, trotz der Interventionsversuche des SP-Bürgermeisters Seitz und des Schutzbundfunktionärs Körner.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die bürgerliche Regierung bereits die gewaltsame Niederschlagung der Demonstration beschlossen. Der christlichsoziale Bundeskanzler, Prälat Ignaz Seipel, wagte zwar nicht den Einsatz des Bundesheeres, aber er hatte den Wiener Polizeipräsidenten Schober angewiesen, die Exekutivbeamten mit Militärgewehren auszustatten – und auf die Jagd zu schicken. Am frühen Nachmittag begann am Schmerlingplatz ein blutiges Massaker von ungeahntem Ausmaß: Hunderte Polizisten attackierten die Menschenmenge, ermordeten und verletzten wahllos Demonstranten, Schaulustige und sogar unbeteiligte Passanten. Viele Flüchtende, die Richtung Gürtel liefen, wurden in Gruppen oder sogar einzeln verfolgt und in den Rücken geschossen. Bis in die Abendstunden waren Todesschwadrone der Polizei in Arbeitervierteln unterwegs, um auf alles zu schießen, was ihnen vor die Flinten kam. Zum Teil setzte sich dies am 16. Juli fort.
Inzwischen waren tausende Arbeiter und Schutzbundangehörige in den Lokalen der SP und des Schutzbundes eingetroffen und forderten die Herausgabe von Waffen, um sich und ihre Klassengenossen verteidigen zu können. Doch die leitenden sozialdemokratischen Funktionäre verweigerten dies und reagierten mit der Kasernierung des Schutzbundes – d.h. mit dessen Rückzug. Zurück blieben die wehrlosen Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Straßen Wiens. 89 von ihnen waren tot, rund 550 verletzt, viele davon schwer.
Der faktische, von der Arbeiterschaft bereits am frühen Nachmittag des 15. Juli spontan begonnene Generalstreik in Wien sowie der Verkehrsstreik in den Bundesländern wurden von der sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschaftsführung widerwillig im Nachhinein genehmigt – und ehebaldigst wieder beendet. Die SP-Führung hatte bereits Geheimverhandlungen mit der Regierung aufgenommen, um das Zusammentreten des Parlaments zu fordern. Die Arbeiterschaft wurde angewiesen, von allen weiteren Aktionen abzusehen, womit die SP-Führung gegenüber den bürgerlichen Parteien auch ihre Verlässlichkeit und künftige Koalitionsfähigkeit unter Beweis stellen wollte – eine Rechnung, die selbstverständlich nicht aufging. Im Gegenteil: Das abermalige Zurückweichen der SP, der regelrechte Verrat an der Arbeiterklasse schwächte diese weiter. Die Christlichsozialen und die Austrofaschisten erkannten, dass die Sozialdemokratie ihnen nichts entgegensetzen würde und forcierte den Faschisierungskurs – bis zur Ausschaltung des Parlaments 1933, zu den Februarkämpfen 1934 und der Konstituierung des austrofaschistischen Ständestaates am 1. Mai 1934.
Die Kommunisten hatten rund um den 15. Juli 1927 im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine richtige Politik verfolgt. Sie beteiligten sich aktiv an den Protesten und an Verteidigungsmaßnahmen gegen die marodierenden und mordenden Polizeieinheiten. Tatsächlich kam es in diesen Tagen erstmals zu koordinierten gemeinsamen antifaschistischen Aktionen von Sozialdemokraten und Kommunisten. Die KPÖ forderte die Bewaffnung der Arbeiter und das organisierte Ausrücken des Schutzbundes sowie die sofortige Einberufung einer Betriebsrätekonferenz, um das weitere Vorgehen zu diskutieren. Gleichzeitig sollte der Generalstreik umfassend fortgesetzt werden. Die Kapitulation der SP-Führung machte die Umsetzung dieser richtigen Maßnahmen freilich unmöglich – zu gering war noch der Einfluss der KPÖ in der Arbeiterklasse, wenngleich sich viele Arbeiter aufgrund der SP-Kapitulationspolitik von der Sozialdemokratie abwandten.
KPÖ-Sekretär Johann Koplenig landete im Jänner 1928 vor Gericht. Aufgrund seiner Rolle bei der Julirevolte und seiner Rede bei der Beerdigung der Opfer am 20. Juli 1927 am Wiener Zentralfriedhof wurde er des Hochverrats bezichtigt, schließlich wegen Verleitung zum Aufstand sowie Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung angeklagt. Doch Koplenig drehte vor dem Geschworenengericht den Spieß um und nütze seinen Auftritt, um die Regierung des Mordes anzuklagen, die Faschisierung offenzulegen und das Versagen der SP-Führung zu entlarven. Koplenig schloss seine Aussage mit folgenden Worten:
„Wir Kommunisten bekennen uns zum 15. und 16. Juli, wir werden die Opfer, die gefallen sind, sühnen durch die Vorbereitung der Revolution und die Aufrichtung der proletarischen Herrschaft in Österreich! Der 15. Juli war kein Abschluss der revolutionären Bewegung, kein Abschluss im Kampfe, sondern ein Ausgangspunkt zu neuen Kämpfen, und sie werden zur Abrechnung mit den Schuldigen des 15. Juli führen. Die Geschichte kennt verschiedene Fälle, wie Arbeiter im Kampfe Niederlagen erlitten und kurze Zeit später Kämpfe mit Erfolg beendeten. Im Juli 1917 haben die russischen Arbeiter ebenfalls erfolglos gekämpft und im Oktober 1917 waren sie wieder auf die Straße gegangen und haben gesiegt! Bei uns wird diese Periode eine längere sein. Aber auch dem blutigen Freitag in Österreich wird ein Roter Oktober folgen.“
Koplenig musste freigesprochen werden – und die Geschichte wird ihm Recht geben. 95 Jahre nach der Wiener Julirevolte, 105 Jahre nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution ist es die Aufgabe der revolutionären Arbeiterbewegung, den von ihm skizzierten Kampf konsequent und erfolgreich fortzusetzen.