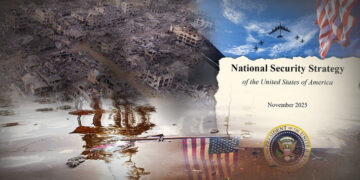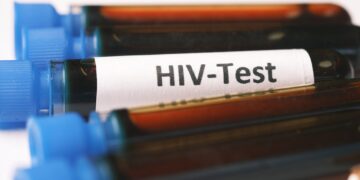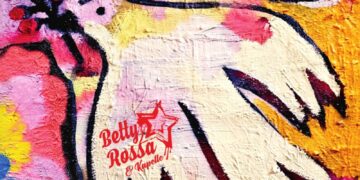Zehn Jahre nach dem EU-Türkei-Abkommen zeigt eine neue Studie: Europas Abschottungspolitik hat nicht nur Migrationsrouten verlagert – sie kostet Menschenleben. Geflüchtete weichen auf tödlichere Wege aus, geraten in libysche Lager, wo Folter, sexuelle Gewalt und Versklavung zum Alltag gehören. Der Preis für Europas Grenzschutz? Menschenleben.
Eine Studie zeigt, wie die europäischen Migrationspolitiken – insbesondere das Abkommen von 2016 zwischen der EU und der Türkei – zu einem Anstieg der Todesfälle im Mittelmeer beigetragen haben, indem sie die Migrationsströme auf gefährlichere Routen verlagerten und die Anfälligkeit der Migrantinnen und Migranten für Folter und systematische Gewalt verstärkten, wie sie in aktuellen Berichten von SOS Humanity und Ärzte ohne Grenzen geschildert werden.
EU-Türkei-Abkommen führte zu mehr Toten im Mittelmeer
Die von der IMT School for Advanced Studies Lucca veröffentlichte Studie in der Fachzeitschrift Humanities and Social Sciences Communications, durchgeführt von Massimo Riccaboni und Irene Tafani, zeigt, dass das EU-Türkei-Abkommen die Zahl irregulärer Ankünfte nicht verringert hat. Ganz im Gegenteil: Es verlagerte die Migrationsbewegungen auf die tödlichste Route – die zentrale Mittelmeerroute.
Auf Basis offizieller Frontex-Daten berechneten die Forschenden, dass zwischen April und Dezember 2016 etwa 2.000 Migrantinnen und Migranten, die ursprünglich die östliche Mittelmeerroute genommen hätten, zur zentralen Route umgeleitet wurden. Dies führte zu einem Anstieg der Todesfälle, den die Studie direkt dem Abkommen zuschreibt – nach dessen Inkrafttreten hat sich die Sterblichkeitsrate entlang der zentralen Mittelmeerroute beinahe verdoppelt.
Die Autoren betonen, dass bilaterale Abkommen ohne umfassendere Koordination lediglich die Ströme verlagern. „Politische Entscheidungsträger sollten der Versuchung widerstehen, den Rückgang der Ankünfte in Griechenland zu feiern, ohne zu erkennen, dass diese Menschen nicht auf Migration verzichten. Sie suchen lediglich riskantere Alternativen in libyschen Gewässern“, so Riccaboni.
Systematische Gewalt in libyschen und tunesischen Lagern
Die aktuellen Daten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) vom 21. Juni berichten, dass seit Jahresbeginn mindestens 255 Menschen auf der zentralen Mittelmeerroute ums Leben gekommen sind und 284 vermisst werden. Doch das ist nur ein Teil der Problematik.
Während Griechenland ankündigt, mit Libyen bei der Eindämmung von Abfahrten zusammenzuarbeiten, und die EU das Mandat der EU-Mission zur Unterstützung des integrierten Grenzmanagements in Libyen (EUBAM Libya) um weitere zwei Jahre und 52 Millionen Euro verlängert hat, stieg die Zahl der auf See abgefangenen und zurückgeschickten Migrantinnen und Migranten durch die sogenannte libysche Küstenwache auf 11.129: Darunter 9.589 Männer, 1.026 Frauen, 369 Minderjährige und 145 Personen mit unbekannten Geschlechtsdaten.
Obwohl Gerichtsentscheidungen die libyschen Küstenwachen als legitime Seenotretter delegitimiert haben, da Rettungsaktionen nicht an Orten enden dürfen, an denen Menschenleben gefährdet sind, hat die jüngste Instabilität der libyschen Einheitsregierung die Entschlossenheit der EU-Staaten bestärkt, bestehende Abkommen zu vertiefen und neue zu schließen – mit Tripolis, Bengasi oder jedem, der sich als Gesprächspartner etabliert.
Dass viele Migrantinnen und Migranten im zentralen Mittelmeer sterben, noch bevor sie das Meer sehen, verdeutlichen erneut die Berichte von Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und SOS Humanity, die systematische Gewalt dokumentieren, besonders in Libyen und Tunesien. Laut SOS Humanity zeigen Aussagen von 64 Überlebenden an Bord der Humanity 1 zwischen Oktober 2022 und August 2024 die Konsequenzen europäischer Politiken, die die Grenzkontrolle an Drittstaaten auslagern.
Versklavung und systematische Diskriminierung in Tunesien
Auch in Tunesien, mit dem die EU kürzlich ein Memorandum unterzeichnet hat, hat sich die Menschenrechtslage verschlechtert. Überlebende berichten von verweigerter medizinischer Versorgung, finanzieller Ausbeutung, Versklavung und systematischer Diskriminierung. „Selbst im Geschäft tun die Tunesier so, als würden sie mit Verwandten plaudern – sie ignorieren dich. Ein anderer Tunesier kommt, wird bedient – und du bleibst außen vor.“ Viele Migrantinnen und Migranten werden in die Wüste gebracht und dort am libyschen oder algerischen Grenzgebiet ausgesetzt – manche sterben. Ein sudanesischer Flüchtling berichtet: „37 Frauen wurden dort vergewaltigt.“
Laut Ärzte ohne Grenzen gaben 80 Prozent der zwischen 2023 und 2025 betreuten 40 Patientinnen an, mindestens einmal sexuell misshandelt worden zu sein. Einige wurden mit der Foltermethode Falanga gequält – Schläge auf die Fußsohlen. Ein Migrant aus Bangladesch erzählt: „Ich verschuldete mich, um mich medizinisch behandeln zu lassen. In Libyen hielten mich Menschenhändler einen Monat lang fest und folterten mich durchgehend. Sie schlugen mich überall, vor allem unter die Füße, um Lösegeld von meiner Familie zu erpressen.“
Libyen: Folter, Hungertode und Vergewaltigungen
In Libyen berichteten fast alle von willkürlicher Inhaftierung unter unmenschlichen Bedingungen: Hunger, fehlender medizinischer Versorgung und willkürlichen Hinrichtungen. Viele wurden wie Sklaven verkauft – auch an Menschenhändler – teilweise über die tunesische Grenze hinweg. Eine Aussage lautet: „In der Nacht im Gefängnis von Ghout al-Shaal verlangten sie 1.500 Dollar von jedem von uns, aber niemand zahlte. Wir wussten nicht, ob wir verkauft worden waren oder nicht.“ Am nächsten Morgen sei man dann an eine Miliz überstellt worden, die ein weiteres Gefängnis kontrollierte – diesmal forderten sie 2.500 Dollar. Weitere Aussagen schildern die katastrophalen Zustände: „Ein Teller Pasta für ein Dutzend Menschen. Alle hatten Hunger. Wir mussten langsam essen… Menschen starben im Gefängnis – an Hunger, Krankheit, sie verrotteten förmlich.“
Auch Kinder sind nicht verschont geblieben: „Die Libyer nahmen mein Kind und warfen es zu Boden. Ich schrie und weinte – als ich es wieder aufnahm, war sein Gesicht voller Blut.“ Häufig wird von sexueller Gewalt berichtet: „Viele Frauen, viele Mädchen, werden entführt und vergewaltigt. Viele werden ungewollt schwanger und entwickeln psychische Probleme.“ Eine schwangere Frau berichtet: „Sie gaben mir Drogen, ich schlief ständig. Die Drogen wirkten auch auf das Kind – es war wie eine Fehlgeburt… Als ich beim zweiten Mal eingesperrt wurde, hatte ich mein Kind bereits. Ich bat oft um Wasser für es – vergeblich. Stattdessen wurde ich geschlagen und vergewaltigt. Sie haben auf mir ejakuliert, während ich mein Kind im Arm hielt.“ Viele Frauen berichten von Versklavung: „Ich habe einen Schleuser bezahlt, um Mali zu verlassen und meine Tochter vor Genitalverstümmelung zu schützen… In Libyen wurde ich an einen anderen Mann verkauft und gezwungen, bei ihm zu leben und zu arbeiten. Er vergewaltigte mich immer wieder.“
Die Flucht übers Meer: Lebensgefahr bis zuletzt
Und dann das Meer: Überfüllte, nicht seetaugliche Boote, ohne Wasser, Nahrung oder Sicherheitsausstattung. Viele mussten mit ansehen, wie ihre Mitreisenden ertranken. Die libysche und tunesische Küstenwache ist direkt in gewaltsame Rückführungen verwickelt: Schläge, Schüsse, sexuelle Gewalt, absichtliches Versenken von Booten und das Zurücklassen von Menschen im Wasser. „Drei junge Männer sprangen nach schweren Misshandlungen ins Meer. Die libysche Küstenwache ließ sie vor unseren Augen sterben und verfluchte sie dabei: ‚Es ist leichter für uns und für sie‘, sagten sie.“ Wie mittlerweile zahlreiche von humanitären Organisationen aufgenommene Videos zeigen, zögern libysche Kräfte nicht, das Feuer zu eröffnen – auch auf Hilfskräfte. Diese Vorfälle werfen direkte Fragen an die EU auf, die als Auftraggeber der libyschen und tunesischen Einsätze gilt und beschuldigt wird, bewusst Seeinterzeptionen und Rückführungen zu fördern.
Die Hinterlassenschaft dieser Politik zeigt sich in den Körpern jener, die es an sichere Küsten geschafft haben. In Palermo betreibt Ärzte ohne Grenzen ein Projekt zur Versorgung und Rehabilitierung Überlebender von Folter und Gewalt, gemeinsam mit der Universität und dem Krankenhaus Policlinico Paolo Giaccone. 67 Prozent der betreuten Personen leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen, verbunden mit Angst und Depression – Symptome, die auf erlittene Traumata zurückgehen.
Viele berichten von chronischen Schmerzen, Knochenbrüchen, Magen-Darm- und neurologischen Problemen. Die psychischen Beschwerden können lähmend sein, mit aufdringlichen Gedanken, Erinnerungen, sozialem Rückzug und Misstrauen. Eine Psychologin von Ärzte ohne Grenzen erklärt, Ziel sei es, aus den Flashbacks und Eindrücken erzählbare Erinnerungen zu machen, in einem sicheren Raum für die Überlebenden. Doch der rechtliche Status der Migrantinnen und Migranten verschärft das Leiden weiter und behindert den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen sowie zu sozialer und wirtschaftlicher Stabilität, die selbst für die Mehrheit jener, die internationalen Schutz erhalten, oft unerreichbar bleibt.
Quelle: IlFattoQuotidiano