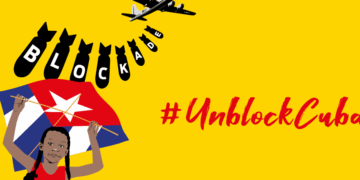Die Krise in Österreich hat viele Zahlen, viele Statistiken und viele Balkendiagramme. Doch hinter jeder Zahl steckt ein Mensch – eine Arbeiterin, ein Arbeiter, eine Angestellte, ein Angestellter. Hinter jedem Prozentpunkt verbergen sich Familien, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, junge Menschen, die von einem Kredit in den nächsten stolpern, und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach jahrzehntelanger harter Arbeit mit Sorge auf ihre Pension blicken.
Die Arbeiterkammer hat mit ihrem aktuellen Arbeitsklima Index eine Realität sichtbar gemacht, die längst zum Alltag gehört: Arbeit schützt nicht mehr zuverlässig vor Armut. Über 120.000 Menschen in Österreich zählen zu den Working Poor, also zu jenen, die Vollzeit arbeiten und trotzdem ihre Grundbedürfnisse nicht decken können. Gleichzeitig erreichen die Privatkonkurse neue Höchststände: Allein in Kärnten mussten heuer bereits 491 Menschen Insolvenz anmelden.
Die Botschaft ist klar: Es handelt sich nicht um individuelles Versagen, sondern um den Ausdruck einer systemischen Krise. Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, das Profite über Menschen stellt, produziert unweigerlich Armut, Verschuldung und Ungleichheit.
Arbeiten und doch arm: Das Schicksal der Working Poor
„Wenn ich nach der Schicht meinen Lohn in der Hand habe, weiß ich, dass ich damit nicht einmal die Fixkosten decken kann.“ – so oder so ähnlich klingt es, wenn man mit jenen spricht, die in der Statistik als „Working Poor“ aufscheinen. 120.000 Menschen in Österreich befinden sich in dieser Situation.
Sie arbeiten Vollzeit, oft in körperlich belastenden, schlecht bezahlten Branchen wie dem Tourismus, im Handel oder in der Leiharbeit. Sie füllen Regale, servieren Getränke, reinigen Hotelzimmer oder schuften auf Baustellen – und doch reicht das Geld nicht zum Leben. Die Arbeiterkammer zeigt: Besonders betroffen sind Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Hilfsarbeiterinnen sowie Hilfsarbeiter.
Die kapitalistische Logik macht diese Menschen doppelt unsichtbar: Einerseits sind sie in Branchen tätig, die oft als „unqualifiziert“ abgewertet werden. Andererseits werden sie statistisch zwar erfasst, aber politisch kaum gehört. Wer trotz 40 Stunden Arbeit nicht über die Runden kommt, ist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass der Mythos „Leistung lohnt sich“ im Kapitalismus eben nicht der Realität entspricht.
Privatkonkurse und Verschuldung – kein individuelles Versagen, sondern Systemlogik
Die explodierenden Privatkonkurse bestätigen dieses Bild. Kärnten meldet mit 491 Fällen bereits jetzt den traurigen Spitzenwert für dieses Jahr, in Niederösterreich suchten 9.071 Menschen 2023 Hilfe bei Schuldnerberatungen, in Salzburg war 2024 jeder dritte Privatkonkurs bei Menschen zwischen 25 und 40 Jahren zu verzeichnen.
Die durchschnittliche Verschuldung beträgt 89.000 Euro. Zum Vergleich: Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen in Österreich liegt bei rund 2.400 Euro brutto – also bei etwa 1.800 Euro netto. Wer 89.000 Euro Schulden hat, braucht mit diesem Einkommen Jahre, um überhaupt aus dem Minus zu kommen, sofern nicht laufend neue Kosten dazukommen.
Besonders perfide ist die Schuldzuweisung. Immer wieder wird Menschen eingeredet, sie seien „selbst schuld“, hätten „über ihre Verhältnisse gelebt“ oder „falsch gewirtschaftet“. Doch die Realität zeigt: Es sind die steigenden Fixkosten – Mieten, Energie, Lebensmittel –, die stagnierenden Löhne und die Profitlogik von Banken und Konzernen, die Menschen in die Verschuldung treiben.
Ein Konsumkredit wird nicht aufgenommen, weil jemand „übertrieben shoppen“ will, sondern weil eine Waschmaschine kaputtgeht, weil die Miete fällig ist, oder weil das Einkommen schlicht nicht reicht. Der Teufelskreis beginnt, wenn Kredite und Zinsen sich auftürmen und Menschen in eine Spirale treiben, aus der es ohne kollektive politische Lösungen keinen Ausweg gibt.
Ungleichheit im Alltag: Frauen, Migrantinnen und Migranten, Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter
Die Arbeiterkammer-Daten verdeutlichen, dass die Krise nicht alle gleich trifft. Frauen verdienen weniger, arbeiten öfter in Teilzeit, tragen unbezahlte Care-Arbeit und sind dadurch häufiger von Armut bedroht.
Während 63 Prozent der Männer mit ihrem Einkommen zufrieden sind, sind es bei den Frauen nur 57 Prozent. Noch drastischer wird es bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund: 56 Prozent der Männer sind zufrieden, aber nur 47 Prozent der Frauen. Diese Lücke ist kein Zufall, sondern Ausdruck patriarchaler Strukturen am Arbeitsmarkt, wo Frauenarbeit systematisch entwertet wird.
Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter sowie Beschäftigte im Tourismus stehen ebenfalls am Ende der Einkommensskala. In der Verwaltung sind 69 Prozent zufrieden, in der Industrie 63 Prozent – im Tourismus hingegen nur 45 Prozent. Besonders dort, wo Arbeitskräfte am dringendsten gebraucht werden, wird am meisten gespart.
Die Ungleichheit zieht sich durch alle Lebensbereiche: weniger Einkommen bedeutet schlechtere Gesundheit, geringere Chancen auf Weiterbildung, mehr Stress und ein höheres Risiko, im Alter mit einer unzureichenden Pension dazustehen.
Gesundheit und Zukunftsperspektiven: Wenn das Einkommen krank macht
Geld allein macht nicht glücklich – aber kein Geld macht krank. Diese einfache Wahrheit bestätigt der Arbeitsklima Index eindrücklich.
Beschäftigte, die gut mit ihrem Einkommen auskommen, bewerten ihre Gesundheit und ihre körperliche Leistungsfähigkeit deutlich besser als jene, die kaum über die Runden kommen. Wer sich ständig Sorgen machen muss, ob das Geld für die Miete reicht, entwickelt Stresssymptome, Schlaflosigkeit, Gereiztheit oder sogar Depressionen.
Die Zukunftsperspektiven sind düster: Nur ein Drittel der Beschäftigten glaubt, mit der Pension später gut auszukommen. Besonders Frauen sind hier pessimistisch: 27 Prozent gehen davon aus, dass die Pension nicht reicht – bei Männern sind es 17 Prozent. Die Ungleichheit im Erwerbsleben setzt sich also in der Altersarmut fort.
Wenn Armut krank macht und Krankheit wiederum Armut verschärft, entsteht eine Abwärtsspirale, die nur durchbrochen werden kann, wenn die politischen Rahmenbedingungen radikal verändert werden.
Das kapitalistische Grundproblem: Profite vor Menschen
Ob Privatkonkurse, Working Poor oder geschlechtsspezifische Ungleichheit – all diese Probleme sind keine „Fehler im System“, sondern das System selbst. Der Kapitalismus funktioniert nach einer einfachen Logik: Gewinne privatisieren, Kosten sozialisieren.
Während Konzerne Rekordgewinne einfahren, stagnieren die Realeinkommen. Während Immobilienunternehmen Dividenden ausschütten, steigen die Mieten ins Unerschwingliche. Während Banken Zinsen einstreichen, werden Menschen durch Kreditlasten erdrückt.
Es ist kein Zufall, dass die Krise gerade jene trifft, die ohnehin am wenigsten haben. Der Kapitalismus lebt davon, Ungleichheit zu produzieren, Arbeitskräfte gegeneinander auszuspielen und Armut als Druckmittel zu verwenden. Wer Angst vor dem Absturz hat, wagt es nicht, sich zu wehren. Wer verschuldet ist, akzeptiert vielleicht eher schlechte Arbeitsbedingungen.
Die Rolle der Politik: Kosmetik statt Kurswechsel
Politische Maßnahmen der letzten Jahre haben bestenfalls an den Symptomen gekratzt. Einmalige Teuerungsausgleiche, Energieboni oder Mietzuschüsse lindern kurzfristig, verändern aber nicht die strukturellen Ursachen.
Die Politik, egal ob konservativ, sozialdemokratisch oder liberal, scheut davor zurück, Konzerne ernsthaft zu besteuern, Mietpreise zu regulieren oder Löhne konsequent zu erhöhen. Stattdessen werden Arbeitslose drangsaliert, Sozialleistungen in Frage gestellt und Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer mit moralischen Appellen abgespeist.
Doch solange die Ursachen – niedrige Löhne, steigende Fixkosten, ungleiche Verteilung – nicht bekämpft werden, bleibt alles beim Alten.
Die Arbeiterkammer hat konkrete Forderungen auf den Tisch gelegt, die ein Schritt in die richtige Richtung wären:
- Wirksame Inflationsbekämpfung bei Energie, Mieten und Lebensmitteln.
- Rechtsanspruch auf Qualifizierung und ein umfassendes Qualifizierungsgeld, das auch längere Weiterbildungen ermöglicht.
- Kostenloses Nachholen von Lehrabschlüssen und die Übernahme von Prüfungsgebühren am zweiten Bildungsweg.
- Bundesweite Anerkennung von Kompetenzen, die im Berufsleben erworben wurden, nach dem Modell „Du kannst was!“.
Doch aus klassenpolitischer Sicht reicht das nicht. Es braucht mehr:
- Offensive Lohnkämpfe und Lohnerhöhungen über der Inflation.
- Verstaatlichung zentraler Bereiche wie Energie, Wohnen und Gesundheit, um Grundbedürfnisse nicht dem Profitstreben zu überlassen.
- Ausbau des Sozialstaats, der Armut nicht verwaltet, sondern verhindert.
- Reorganisation der Gewerkschaft, um sozialdemokratische Gewerkschaftsführung zu entmachten und eine kollektive Gegenmacht aufzubauen.
Die Rekordzahlen bei Privatkonkursen, die wachsende Zahl der Working Poor und die ungleiche Verteilung von Einkommen und Chancen sind kein Naturereignis. Sie sind das Ergebnis eines Systems, das Reichtum bei wenigen konzentriert und die Mehrheit mit Sorgen zurücklässt.
Doch die Geschichte lehrt: Nichts muss so bleiben, wie es ist. Arbeiterinnen und Arbeiter haben in der Vergangenheit durch Kämpfe Arbeitszeitverkürzung, Sozialleistungen und Mitbestimmung erkämpft und den Kapitalismus zu Fall gebracht. Auch heute gilt: Die Krise ist kein Schicksal, sondern ein Auftrag.
Nur wenn die Arbeiterklasse ihre Stimme erhebt, gemeinsam organisiert auftritt und das Primat des Profits in Frage stellt, kann eine Gesellschaft entstehen, in der Arbeit nicht mehr arm macht, sondern ein gutes Leben ermöglicht. Die Partei der Arbeit Österreichs versteht sich als ein Angebot an die Arbeiterklasse genau diesen gemeinsamen Kampf gemeinsam zu führen und eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen.
Quelle: APA-OTS