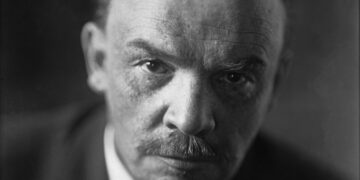Drei Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine ist kein Frieden in Sicht. Was im Februar 2022 als „Spezialoperation“ Russlands begann und vom Westen als „Verteidigung der Demokratie“ deklariert wurde, war von Anfang an ein offener Machtkampf zwischen imperialistischen Zentren. Die Front verläuft nicht nur an den Schützengräben von Pokrowsk oder Kupjansk, sondern quer durch Europa – zwischen geopolitischen Interessen, wirtschaftlichen Abhängigkeiten und innenpolitischen Spannungen.
Während die Kämpfe im Osten der Ukraine an Intensität zunehmen, ringt die Europäische Union darum, ihre politische und wirtschaftliche Rolle im sich verschärfenden globalen Konkurrenzkampf neu zu definieren.
Die EU zwischen Kriegsökonomie und Erweiterungspolitik
Die Europäische Kommission hat jüngst ein neues „Erweiterungspaket“ verabschiedet, das die Ukraine und Moldawien als künftige Mitglieder des imperialistischen Bündnisses in Aussicht stellt. Offiziell lobt Brüssel die „außergewöhnliche Entschlossenheit“ Kiews auf dem Weg nach Europa, mahnt aber zugleich, dass die jüngsten „negative Entwicklungen im Kampf gegen Korruption“ und Defizite im Rechtsstaat nachgebessert werden müssten.
Hinter dieser technokratischen Sprache verbirgt sich eine doppelte Logik: Einerseits soll die politische Bindung der Ukraine an die EU vertieft werden, um die geopolitische Einflusssphäre Brüssels bis zum Schwarzen Meer auszuweiten. Andererseits verlangt das europäische Kapital nach Stabilität, Berechenbarkeit und einer marktorientierten Gesetzgebung, um Investitionen im ukrainischen Wiederaufbau abzusichern. Die „Reformagenda“ der EU ist Instrument wirtschaftlicher Steuerung – ein Mechanismus zur Einbindung der Ukraine in den ökonomischen Raum der europäischer Banken und Konzerne.
Gleichzeitig zeigen sich die Bruchlinien im Inneren des Blocks. Ungarn blockiert die Aufnahme neuer Beitrittsverhandlungen mit der Begründung, ein Krieg führe nicht zu einer „Vertiefung der Einheit“, sondern gefährde sie. Teile des ungarischen Kapitals sind stärker nach Osten orientiert und fürchten, durch die totale Westbindung wirtschaftliche Spielräume zu verlieren. So spiegeln sich im Streit um das ukrainische EU-Dossier auch die inneren Widersprüche der europäischen Bourgeoisien wider.
Militärische Dynamik und ökonomische Interessen
Parallel dazu verstärken die führenden EU-Staaten ihre militärische Präsenz und Aufrüstung. Deutschland plant, die Unterstützung der Ukraine im Jahr 2026 um weitere drei Milliarden Euro zu erhöhen und investiert weiter in die eigene Aufrüstung – in einer Zeit, in der im eigenen Land Sozialprogramme gekürzt und Ausgaben für Bildung und Gesundheit reduziert werden. Diese Umverteilung zugunsten der Rüstungsindustrie zeigt, dass der Krieg längst zur wirtschaftlichen Triebkraft geworden ist. Auch die österreichische Bundesregierung aus Konservativen, Sozialdemokraten und NEOS verfolgt eine ähnliche Politik: Zerschlagung sozialer Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter bei gleichzeitiger weiterer Aufrüstung des Bundesheeres.
Die „Permanenz des Ausnahmezustands“ verwandelt sich in ein neues ökonomisches Normal: Verteidigungsfonds, Aufrüstungsprogramme und Industriepartnerschaften werden zur Grundlage eines europäischen Kriegsmarkts. Unter dem Vorwand der Sicherheit betreibt die EU eine Militarisierung, die ihr eigenes Selbstverständnis als „Friedensprojekt“ konterkariert.
Auch in den östlichen Mitgliedsstaaten nimmt der nationale Rüstungswettlauf Fahrt auf. Polen baut eine eigene Anti-Drohnen-Abwehr ohne auf Brüssel zu warten, finanziert durch den EU-Sicherheitsfonds SAFE. Das Land erhält allein daraus mehr als 40 Milliarden Euro – ein Beweis dafür, wie stark militärische Projekte inzwischen in den Binnenhaushalt der Union integriert sind.
Kriegserschöpfung in der Ukraine nicht mehr zu übersehen
Für die ukrainische Bevölkerung bedeutet all das einen weiteren Winter zwischen Front, Frost und Hoffnungslosigkeit. Russische Angriffe auf Heiz- und Stromanlagen lassen ganze Regionen ohne Energieversorgung zurück. Präsident Selenskyj versucht, mit Notmaßnahmen gegenzusteuern – etwa kostenlosen Bahnfahrten, damit Menschen wenigstens im warmen Zug übernachten können. Diese Bilder, so tragisch sie sind, symbolisieren die Realität eines Landes, das zwischen westlicher Abhängigkeit und östlicher Aggression von den tonangebenden Kapitalfraktionen im eigenen Land zerrieben wird.
Auch das humanitäre Antlitz, das sich der Westens versucht selbst zu geben, zeigt Risse. Die Hilfszahlungen für Privatpersonen bleiben minimal, während Milliarden in Rüstungsdeals und Infrastruktur fließen, die vor allem westlichen Unternehmen zugutekommen. Die Ukraine wird zum Versuchslabor eines Wiederaufbaus unter kapitalistischer Aufsicht – ähnlich wie es nach den Kriegen im Irak oder auf dem Balkan zu beobachten war.
Pokrowsk, Kupjansk und die militärische Sackgasse
Militärisch ist die Lage festgefahren. In Pokrowsk und Kupjansk kämpfen ukrainische Einheiten unter immer schwierigeren Bedingungen, während Moskau von „vollständiger Einkesselung“ spricht – ein Narrativ, das sich nicht unabhängig überprüfen lässt, aber den Druck auf Kiew erhöht.
Der Frontverlauf steht sinnbildlich für den Gesamtzustand des Konflikts: Beide Seiten sind erschöpft, keiner kann den entscheidenden Durchbruch erzwingen. Dennoch wird der Krieg weitergeführt – nicht aus Hoffnung auf Sieg, sondern weil ein Rückzug als geopolitische Niederlage gewertet würde. Die Logik des Kapitals und der Machtinteressen ersetzt zunehmend die der Vernunft.
Zwischen Blockbildung und geopolitischem Chaos
Die EU positioniert sich als Verteidigerin einer „regelbasierten Ordnung“, doch faktisch beteiligt sie sich an deren militärischer Auflösung. Die geplante Erweiterung nach Osten ist weniger ein Schritt zur Einheit als eine Bewegung der Blockbildung – Teil eines neuen Kalten Krieges, in dem Europa zugleich Akteur und Schauplatz ist.
Der Krieg in der Ukraine offenbart die Grenzen einer Weltordnung, die auf Konkurrenz statt Kooperation beruht. Die rivalisierenden Machtblöcke – USA, NATO, EU und Russland – kämpfen nicht um Werte, sondern um Einflusszonen, Rohstoffe, Absatzmärkte und geopolitische Stellung. Die Ukraine, Moldawien und Georgien sind in dieser Logik nicht Ziel selbstbestimmter Entwicklung, sondern Instrumente in einem Konflikt, der von Washington bis Moskau, von Berlin bis Brüssel strategisch kalkuliert wird. Und auch Wien versucht sich sein Stück vom Kuchen im Rahmen der EU abzuschneiden.
Die EU betreibt eine verstärkte Militarisierung unter dem Banner der Solidarität, die soziale Konflikte verschärft und politische Abhängigkeiten vertieft. Die Ukraine wird zum Experimentierfeld eines neuen Typus von Krieg: einer permanenten, ökonomisch eingebetteten Auseinandersetzung zwischen Machtblöcken, deren Preis von den Bevölkerungen gezahlt wird.
Während in Brüssel über „Reformen“ und „Erweiterungen“ debattiert wird, sterben Menschen in Pokrowsk. Und während in Berlin, Warschau, Paris und Wien die Rüstungsetats steigen, frieren Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in ihren Wohnungen. Und nicht nur dort, steigende Energiekosten und damit einhergehende Energiearmut wird auch hierzulande immer mehr ein Thema und die Menschen bekommen zunehmend Probleme ihre Wohnung zu beheizen.