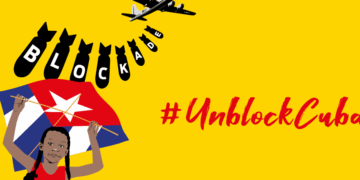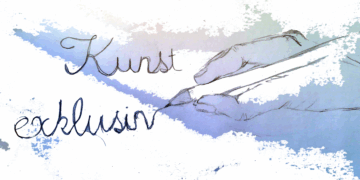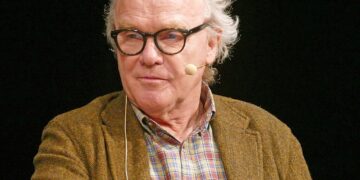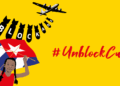Die OMV präsentiert sich 2025 als globaler Energiekonzern im Wandel. Während sie noch vor wenigen Jahren ihre Expansionsstrategie im Ölgeschäft feierte, soll nun der Einstieg in den grünen Wasserstoff den Konzern in die Zukunft führen. Doch hinter den PR-tauglichen Schlagworten von „Transformation“ und „Nachhaltigkeit“ verbergen sich alte Strukturen – und neue Widersprüche.
Vom schwarzen Gold zur grünen Hoffnung
2019 markierte einen Wendepunkt in der internationalen Positionierung der OMV. Gemeinsam mit der italienischen Eni beteiligte sich der Konzern an der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und wurde Teil eines milliardenschweren Raffinerie- und Handels-Joint-Ventures. Mitten im Erdölmekka der Golfregion sicherte sich die OMV so den Zugang zu einem der größten Raffineriekomplexe der Welt – und zu einem der profitabelsten Downstream-Märkte überhaupt.
Damals war die Rhetorik klar: Die Partnerschaft mit ADNOC sollte das „globale Handelsgeschäft“ ausbauen und den Einfluss der OMV von der Nordsee bis zum Persischen Golf erweitern. Der damalige CEO Rainer Seele sprach von einem „strategischen Meilenstein“ und einem Schritt zur „vertikalen Integration von Förderung bis Petrochemie“. Tatsächlich war es der Einstieg in eine neue Phase kapitalistischer Globalisierung des Unternehmens – mit allen Risiken geopolitischer Abhängigkeiten.
Der Preis des Erfolgs: Gewinne oben, Jobverluste unten
Sechs Jahre später steht die OMV erneut im Rampenlicht – diesmal nicht wegen internationaler Deals, sondern wegen Massenentlassungen. Im September 2025 kündigte das Management an, weltweit rund 2.000 Stellen zu streichen, davon mehrere hundert in Österreich. Offiziell nennt man das ein „Effizienzprogramm“. Tatsächlich ist es ein massiver Personalabbau in einem Konzern, der im selben Quartal mehr als eine Milliarde Euro Gewinn erzielte.
Während die OMV im Glanz ihrer Quartalszahlen badet und Dividenden in Millionenhöhe ausschüttet – allein eine halbe Milliarde Euro flossen an die staatliche ÖBAG –, werden die Beschäftigten mit der Rechnung für die Profitsteigerung konfrontiert. Der Staat, der über die ÖBAG Miteigentümer ist, schweigt weitgehend. Die Gewerkschaft zeigt sich empört, aber verhandlungsbereit – ein bekanntes Muster. Soziale „Abfederung“ ersetzt strukturellen Widerstand.
Der Widerspruch ist offensichtlich: Ein teilstaatlicher Energiekonzern kürzt Stellen in Österreich, um im globalen Wettbewerb profitabler zu werden – während die Republik als Anteilseigner selbst von den Gewinnen profitiert. Es zeigt einmal mehr, die Aktualität der Analyse vom Staatsmonopolistischen Kapitalismus.
Grüner Wasserstoff – das neue geopolitische Geschäft
Und nun, im November 2025, präsentiert sich die OMV mit einem neuen Prestigeprojekt: Gemeinsam mit Masdar, der staatlichen Erneuerbare-Energien-Gesellschaft aus Abu Dhabi, baut der Konzern in Bruck an der Leitha eine der größten Wasserstoffanlagen Europas. Masdar hält 49 Prozent, die OMV 51 Prozent.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach in Abu Dhabi von einem „historischen Projekt“ und OMV-Chef Alfred Stern schwärmte von „Europas fünftgrößtem Elektrolyseur“. 140 Megawatt Elektrolyseleistung sollen bis 2027 entstehen – für rund 700 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt teils durch arabisches Kapital, teils durch EU-Fördergelder aus der Europäischen Wasserstoffbank.
Doch die Anlage in Bruck wird nicht etwa den öffentlichen Energiemarkt versorgen, sondern ausschließlich die Raffinerie Schwechat. Der dort erzeugte grüne Wasserstoff soll helfen, fossile Treibstoffe „zu dekarbonisieren“ und EU-Richtlinien zu erfüllen. Mit anderen Worten: Der „grüne“ Wasserstoff dient in erster Linie der Verlängerung des fossilen Geschäftsmodells – nicht seiner Überwindung.
Alte Partner, neue Etiketten
Bemerkenswert ist, dass die OMV damit erneut auf die Vereinigten Arabischen Emirate setzt – denselben Staat, mit dem sie 2019 im Ölgeschäft expandierte. Damals ging es um Raffinerien und Handelsprofite, heute um Wasserstoff und Klimaziele. Der gemeinsame Nenner bleibt derselbe: Kapitalströme zwischen Wien und Abu Dhabi, eingebettet in geopolitische Interessen.
Dass die operative Führung des Joint Ventures in österreichischer Hand bleibt, ändert nichts an der Abhängigkeit: Die OMV braucht arabisches Kapital und politische Rückendeckung aus Brüssel, um ihre „grüne“ Transformation zu finanzieren. Das fossile Erbe wird mit neuem Vokabular versehen – „Dekarbonisierung“ statt „Diversifizierung“, „Nachhaltigkeit“ statt „Downstream“.
Eine Transformation im Widerspruch
Die OMV steht damit exemplarisch für die Widersprüche der europäischen Energiepolitik: Während Klimaziele, geopolitische Abhängigkeiten und Marktinteressen gegeneinander prallen, bleibt die eigentliche Transformation oberflächlich. Der grüne Wasserstoff ersetzt nicht das fossile System, sondern stabilisiert es.
Gleichzeitig werden jene, die die Energiewende tragen sollen – die Beschäftigten – zu Opfern der Konzernstrategie. In Schwechat sollen grüne Moleküle entstehen, während in Wien und Linz Arbeitsplätze verschwinden.
Der Konzern zeigt damit, wie die „Energiewende“ im Kapitalismus funktioniert: als ökonomische Restrukturierung von oben, nicht als gesellschaftliche Transformation von unten.