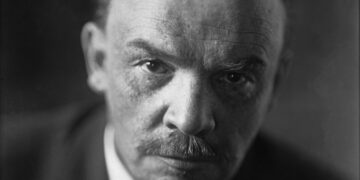Innerhalb der türkischen Regierungspartei AKP verschärft sich der Machtkampf zwischen verschiedenen Parteiflügeln und einflussreichen Personen aus Politik, Wirtschaft und Sicherheitsapparat. Eine Reihe von Ermittlungen, Festnahmen und medialen Auseinandersetzungen deutet auf eine tiefgreifende Krise im Machtzentrum rund um Präsident Recep Tayyip Erdoğan hin. Beobachter sprechen von einem „niedrigintensiven internen Krieg“, der jederzeit eskalieren könnte.
Ermittlungen und Festnahmen als Auslöser
Den jüngsten Höhepunkt bildete die Festnahme des bekannten Anwalts Rezan Epözdemir am 10. August 2025. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul ermittelt gegen ihn wegen „Korruption“, „Beihilfe zu einer terroristischen Organisation“ und „politischer und militärischer Spionage“. Die Ermittlungen lösten nicht nur ein juristisches, sondern vor allem ein politisches Beben aus. Epözdemir gilt als gut vernetzt in politischen Kreisen und als Verteidiger prominenter Persönlichkeiten.
Die Reaktionen innerhalb der AKP fielen heftig aus. Ehemalige Parteifunktionäre wie Şamil Tayyar, Metin Külünk und Mücahit Birinci stellten sich in sozialen Medien und Interviews offen gegen Personen aus dem Umfeld des Präsidentenpalasts. Tayyar warf etwa Mehmet Uçum, einem engen Berater Erdoğans, vor, Einfluss auf die Ermittlungen genommen zu haben. Er rief den Präsidenten dazu auf, den ermittelnden Staatsanwalt Akın Gürlek zu schützen. Auch Külünk und Birinci kritisierten, dass „mächtige Kreise“ versuchten, die Justiz zu beeinflussen.
Solche offenen Angriffe gegen den innersten Kreis des Präsidenten sind in der AKP bislang selten – sie gelten als Zeichen wachsender innerparteilicher Spannungen.
Eine Kette von Operationen
Die Epözdemir-Affäre ist nur ein Teil eines größeren Bildes. Seit Monaten reiht sich in der Türkei eine Serie von Ermittlungen und wirtschaftlichen Eingriffen an die nächste: Can Holding, Ciner Holding, Papara, Paramount Hotel und die Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) stehen im Zentrum der Schlagzeilen. Offiziell geht es um Korruption, Steuervergehen oder Verbindungen zu kriminellen Netzwerken – inoffiziell sehen Beobachter darin eine systematische Säuberung innerhalb der Machtstrukturen.
So wurde etwa die Can Holding, Eigentümerin des Fernsehsenders Habertürk, in eine umfassende Untersuchung verwickelt. Laut Medienberichten wurde das Unternehmen mit dem Namen des Geheimdienstchefs Hakan Fidan in Verbindung gebracht, der sich damit angeblich eine eigene mediale Basis aufbauen wollte. Die Ermittlungen gegen die Holding wurden daher als indirekter Angriff auf Fidan interpretiert.
Auch die Ciner-Gruppe, einflussreich in der Energie- und Medienbranche, geriet ins Visier der Behörden. Sogar Cüneyt Zapsu, einst enger Wirtschaftsberater Erdoğans, wurde laut Berichten kurzzeitig von Ermittlungen betroffen.
Parallel dazu kam es zur „Papara-Operation“ – die Finanzplattform wurde beschlagnahmt, nachdem Verbindungen zu dem getöteten Glücksspielboss Halil Falyalı bekannt wurden. Auch hier führen die Spuren in Richtung Regierungsnetzwerke.
Alte Allianzen, neue Fronten
Die Vielzahl an Ermittlungen hat verdeckte Frontlinien innerhalb der AKP sichtbar gemacht. Neben den wirtschaftlichen Interessen spielt auch der Streit um die Nachfolge Erdoğans eine zentrale Rolle.
Schon seit Jahren wird in Ankara darüber spekuliert, wer den 71-jährigen Präsidenten politisch beerben könnte. In den internen Machtkämpfen tauchen immer wieder dieselben Namen auf: Berat Albayrak (Erdoğans Schwiegersohn und ehemaliger Finanzminister), Selçuk Bayraktar (Ehemann von Erdoğans Tochter Sümeyye und Chef des Drohnenherstellers Baykar), Hakan Fidan (Außenminister und früherer Geheimdienstchef) sowie İbrahim Kalın (Präsident des Geheimdienstes MIT und ehemaliger Regierungssprecher).
Zwischen diesen Lagern verlaufen – laut türkischen Medien – teils offene, teils verdeckte Konfliktlinien. Während Fidan und Kalın als Vertreter eines eher technokratischen, sicherheitsorientierten Flügels gelten, repräsentiert das Umfeld um Albayrak und Bayraktar stärker die wirtschaftlich-islamisch orientierte, unternehmernahe Seite der AKP.
Ein weiterer Schauplatz des Machtkampfes ist die Medienpolitik. Die Abberufung von Fahrettin Altun als Kommunikationschef im Sommer 2025 gilt als Wendepunkt. Medienberichte zufolge soll Altun versucht haben, seinen Nachfolger Kalın öffentlich zu schwächen – was schließlich zu seiner Entlassung geführt habe. Kurz darauf folgten mehrere Hausdurchsuchungen und Medienverhaftungen, die Beobachter mit dieser Entmachtung in Verbindung bringen.
Schweigen aus dem Präsidentenpalast
Auffällig ist, dass sich Präsident Erdoğan zu den meisten dieser Vorgänge nicht öffentlich geäußert hat. Weder zu den Vorwürfen gegen seinen Berater Uçum noch zu den Ermittlungen gegen Can oder Ciner Holding gab es offizielle Stellungnahmen. Diese Sprachlosigkeit wird von türkischen Kommentatoren als Zeichen einer „kontrollierten Krise“ gedeutet: Der Präsident lasse die verschiedenen Machtzirkel gegeneinander agieren, um die Loyalität seiner Umgebung zu testen und potenzielle Nachfolger in Schach zu halten.
Ein Kommentator fasste es so zusammen: „Die AKP erlebt gerade die normale Funktionsweise des Systems, das sie selbst geschaffen hat – ein Netzwerk aus Politik, Geschäft und Loyalität, das nun implodiert.“
Verflechtungen zwischen Politik, Wirtschaft und Sicherheitsapparat
Besonders auffällig ist die Dichte der Verbindungen zwischen Politikern, Geschäftsleuten und Sicherheitsakteuren. Namen wie Sedat Peker, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu oder Cihan Ekşioğlu tauchen in den Ermittlungen immer wieder auf – Personen, die bereits in früheren Korruptions- und Machtmissbrauchsdebatten eine Rolle gespielt haben.
Die MKE-Affäre – eine Untersuchung gegen den früheren Vorsitzenden der Rüstungsfirma Makine ve Kimya Endüstrisi, İsmet Sayhan – zeigt, dass die Ermittlungen auch das Verteidigungsnetzwerk der Türkei berühren. Beobachter sehen darin eine Warnung an den ultranationalistischen MHP-Flügel, der mit der AKP regiert und im Sicherheitsapparat starken Einfluss ausübt.
Ein fragiles Gleichgewicht
Die Vielzahl der parallelen Operationen deutet darauf hin, dass Erdoğan versucht, die Kontrolle über ein System zurückzugewinnen, das zunehmend von inneren Rivalitäten zerrissen wird. Dabei gerät auch das Verhältnis zu Koalitionspartner Devlet Bahçeli und der MHP in den Fokus, deren Einfluss auf Polizei und Justiz in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist.
Analysten sehen in den jüngsten Entwicklungen den Beginn einer „Neuordnung“ der Machtverhältnisse in Ankara. Ob diese Neuordnung von oben gesteuert oder von internen Dynamiken getrieben wird, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass sich innerhalb der AKP Machtzentren herausgebildet haben, die längst nicht mehr reibungslos zusammenarbeiten.
Was nach außen wie eine Reihe unzusammenhängender Ermittlungen wirkt, erscheint bei genauerem Hinsehen als Spiegel einer tiefen systemischen Krise. Korruptionsvorwürfe, wirtschaftliche Razzien, Machtkämpfe um Loyalitäten und Schweigen an der Parteispitze – all das deutet darauf hin, dass die AKP nach über zwei Jahrzehnten an der Macht an innerer Stabilität verliert.