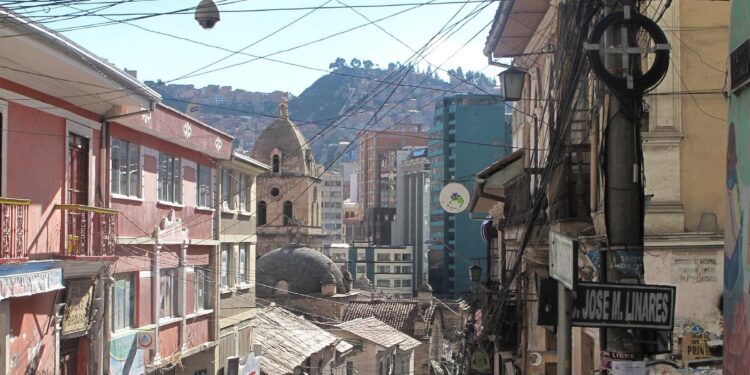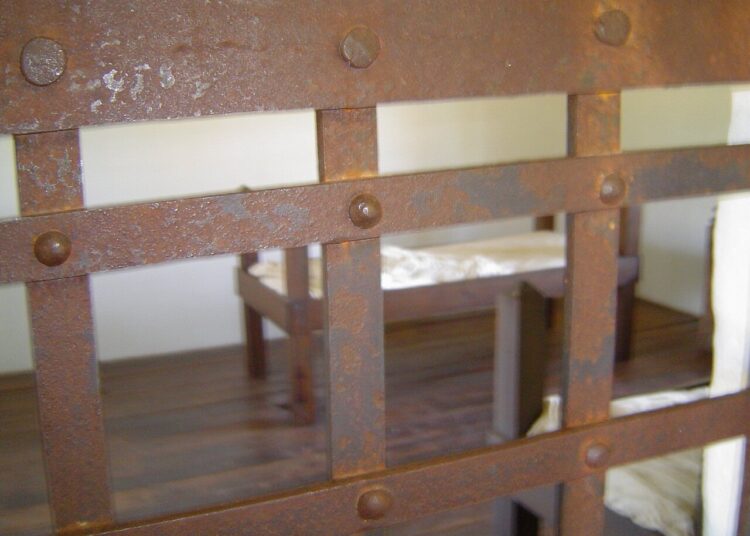Sucre. In Bolivien hat der Mitte-rechts-Politiker Rodrigo Paz Pereira von der Demokratisch-Christlichen Partei überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach vorläufigen Angaben der Wahlbehörde erreichte er knapp ein Drittel der Stimmen und verwies den ultrakonservativen Jorge Fernando „Tuto“ Quiroga von der Alianza Libertad y Democracia mit 26,9 Prozent auf Platz zwei. Der Unternehmer Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) kam auf 20 Prozent und scheidet ebenso aus dem Rennen wie der bestplatzierte linke Kandidat, der 37-jährige Senatspräsident Andrónico Rodríguez, der mit 8,1 Prozent Rang vier belegte. Für die Regierungspartei Bewegung zum Sozialismus (Movimiento al Socialismo, MAS) endete der Abend mit einer historischen Niederlage: Ihr Spitzenkandidat Eduardo del Castillo erhielt lediglich 3,1 Prozent, nachdem die MAS vor fünf Jahren noch 55 Prozent geholt hatte. Da niemand die verfassungsrechtlich geforderte absolute Mehrheit oder mindestens 40 Prozent bei einem Vorsprung von zehn Punkten erzielte, treten die zwei Erstplatzierten am 19. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an. Der neue Präsident übernimmt laut Verfassung am 8. November das Amt.
Auffällig hoch war der Anteil ungültiger Stimmen, der bei fast 20 Prozent lag. Beobachterinnen und Beobachter führen dies auch auf den Aufruf von Ex-Präsident Evo Morales und seinen Anhängerinnen und Anhängern zurück, aus Protest ungültig zu wählen, nachdem das Verfassungsgericht eine erneute Kandidatur des ehemaligen Staatschefs nach drei Amtszeiten untersagt hatte. Der Aufstieg von Paz sei auch als Abstrafung jener Kandidaten zu deuten, die ihre Kampagnen primär an der Polarisierung gegen die MAS ausrichteten, schreibt Amerika21. Die Wählerinnen und Wähler hätten damit eine andere, moderatere Alternative belohnt. Paz profitierte zudem von seinem populären Vizekandidaten Edman Lara, einem Polizeikommandanten mit starker Verankerung im Westen des Landes.
Die Wahl findet inmitten einer schweren Wirtschaftskrise statt, geprägt von Devisenknappheit, Treibstoffmangel und der höchsten Inflation seit Jahrzehnten. Paz, 1967 in Spanien geboren und aufgrund der damaligen Putschfolgen in der Jugend im Exil, begann 2002 als Abgeordneter in Tarija, wurde 2015 Bürgermeister dieser gasreichen Departementshauptstadt und 2020 Senator für Comunidad Ciudadana. Programmatisch setzt er auf weitgehende Dezentralisierung, stärkere departementale Autonomie und mehr Budgetmittel für die Regionen. Ökonomisch kündigt er an, defizitäre Staatsbetriebe zu schließen, Steuern zu senken, Kredite an Unternehmerinnen und Unternehmer auszuweiten und Importbeschränkungen sowie Zölle zu lockern. Er hält internationale Kredite, etwa vom IWF, für entbehrlich, da im Land ausreichend Mittel zur Konjunkturbelebung vorhanden seien. Doria Medina hat bereits erklärt, Paz im zweiten Wahlgang zu unterstützen, was die Mitte-rechts-Achse zusätzlich stärkt.
Quiroga startet hingegen bereits zum vierten Mal in ein Präsidentschaftsrennen. Er war in den Jahren der MAS-Hegemonie wiederholt Kandidat, 2020 trat er gegen Luis Arce an und zog kurz vor der Abstimmung zurück. Politisch ist er eng mit der neoliberalen Öffnung der späten 1990er und frühen 2000er Jahre verbunden: Als Vizepräsident unter dem früheren Diktator Boliviens, Hugo Banzer (1997–2001), rückte er nach dessen Rücktritt im August 2001 bis 2002 ins Präsidentenamt auf. Im aktuellen Wahlkampf wirbt er für drastische Ausgabenkürzungen – in eigenen Worten mit „Kettensäge, Machete oder Schere“ – und für eine aggressive Strategie zum Abschluss von Freihandels- und Investitionsschutzabkommen, flankiert durch die Unterstützung von Weltbank, IDB und IWF. Außenpolitisch kündigt er ein Abkoppeln von Venezuela, Kuba, Nicaragua und Iran an, will den BRICS-Verbleib prüfen, handelsseitig aber die Beziehungen zu Indien und China betonen. Gegenüber dem Mercosur zeigt er Skepsis und favorisiert stattdessen ein „südamerikanisches Dreieck“ zur Lithiumförderung mit Argentinien und Chile.
Bemerkenswert ist, dass Meinungsumfragen vor der Wahl noch Doria Medina vor Quiroga gesehen hatten, während Paz mit etwa neun Prozent als abgeschlagen galt, in etwa gleichauf mit Cochabambas Bürgermeister Manfred Reyes Villa (Súmate). Die reale Dynamik am Wahltag widersprach damit klar den Erwartungen. Die Beteiligung lag traditionell hoch bei 89 Prozent; im Inland waren über sieben Millionen Menschen wahlberechtigt, zusätzlich gaben rund 270.000 Bolivianerinnen und Bolivianer in 22 Ländern ihre Stimmen ab, besonders in Argentinien, Spanien, Brasilien, Chile und den USA. Parallel zur Präsidentschaft wurden 130 Abgeordnete und 36 Senatorinnen bzw. Senatoren gewählt; insgesamt waren 2.136 Kandidaturen zugelassen, die genaue Sitzverteilung wird in den kommenden Tagen erwartet. Der Ablauf galt laut Beobachterinnen und Beobachtern als friedlich und geordnet, auch wenn die Polizei von einem Sprengsatz in der Nähe eines Wahllokals in Entre Ríos (Cochabamba) berichtete. Andrónico Rodríguez, der dort seine Stimme abgab und mit Steinen beworfen wurde, sprach von isolierten Vorfällen kleiner Gruppen. Ein Journalist wurde leicht verletzt.
Die Kombination aus tiefer ökonomischer Krise, Ressourcenabhängigkeit und politischer Fragmentierung öffnet den Raum für eine neoliberale Politik der Haushaltskonsolidierung und Marktöffnung, die kurzfristig Kapitalinteressen bedient und die sozialen Risiken auf Lohnabhängige, ländliche Gemeinschaften und indigene Bevölkerungen abwälzt. Weder Paz’ Dezentralisierungsagenda, die auf Tarijas Erdgasreichtum setzt, noch Quirogas Ankündigungen, mit radikalen Kürzungen und Handelsabkommen den Staat im Interesse der Märkte umzubauen, stellen eine Alternative im Sinne der arbeitenden Klassen dar. Beide Programme sind lediglich Varianten derselben Klassenpolitik: Der öffentliche Sektor wird zurückgestutzt, staatliche Schutzfunktionen werden relativiert und die Macht des Kapitals weiter gefestigt.
Die Stichwahl am 19. Oktober entscheidet daher nicht über unterschiedliche gesellschaftliche Projekte, sondern nur darüber, welche Fraktion der herrschenden Klasse die Krise verwalten wird. Für die lohnabhängige Bevölkerung bedeutet das: weder Löhne, Preise, Subventionen oder Arbeitsplatzsicherheit werden im Zentrum stehen, noch wird es eine Politik geben, die die Machtverhältnisse zugunsten der Mehrheit verschiebt. Der historische Einbruch der MAS ist in diesem Zusammenhang hausgemacht. Sie hat die Macht des Kapitals nicht gebrochen, sondern lediglich versucht, sie in sozialere Bahnen zu lenken – ein Projekt, das mit der aktuellen Krise des Landes an seine Grenzen gestoßen ist.
Quelle: Amerika 21