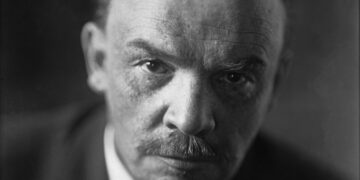Die Wohnpolitik in Österreich steht an einem Wendepunkt – und ist zugleich ein Spiegelbild der politischen Kräfteverhältnisse. Während die Regierung ihre jüngsten Maßnahmen als Meilenstein verkauft, bleibt bei genauerer Betrachtung vieles beim Alten: Symbolpolitik dominiert, während strukturelle Probleme ungelöst bleiben.
Politische Rahmensetzung: Sparpolitik und Ausreden
Wien. Seit der Bildung der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS wird klar: Entlastungen für die breite Bevölkerung haben keinen Vorrang. Stattdessen dominiert ein Sparkurs, der von allen Regierungsparteien getragen wird. Sozialpolitische Impulse finden sich nur am Rande. Die Interessen von Kapital und Investoren haben Vorrang, während die Belastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigen. In dieser Gemengelage wird Wohnen zu einer der zentralen sozialen Fragen – und gleichzeitig zum Schauplatz ideologischer Auseinandersetzungen.
Inflation und Teuerung haben Wohnen, Energie und Lebensmittel zu den Hauptpreistreibern der letzten Jahre gemacht. Der ÖGB warnt, dass ohne Mietpreisdeckel, ohne klare Sanktionsmöglichkeiten gegen Preiswucher und ohne einen Krisenmechanismus bei Energiepreisen ein weiterer Kaufkraftverlust droht. Ihre Forderungen reichen von einem generellen Mietpreisdeckel von zwei Prozent bis zum Ende befristeter Mietverträge.
Dass es bisher allerdings nur bei Appellen der Gewerkschaften bleibt, liegt nicht an fehlendem Problembewusstsein. Vielmehr wird die Gewerkschaftsführung von der SPÖ dominiert, die selbst Teil der Regierung ist. Zahlreiche Führungsmitglieder der Gewerkschaft sitzen für die SPÖ im Parlament. Sie liefern die Begleitmusik zur Regierungspolitik und versuchen, unzureichende Maßnahmen der Regierung der Arbeiterklasse als Erfolg zu verkaufen. Gleichzeitig soll von den beginnenden Lohnverhandlungen und der Notwendigkeit nach offensiven Kämpfen für höhere Löhne und Gehälter abgelenkt werden. Kämpfe, die die sozialdemokratische Gewerkschaftsführung sicherlich nicht organisieren wird, stattdessen werden uns Lohnabschlüsse unter der rollierenden Inflation als wirtschaftliche Notwendigkeit verkauft werden.
Die Maßnahmen der Regierung im Detail
Das neue „Mieten-Wertsicherungsgesetz“ umfasst mehrere Punkte, die von der Regierung als großer Schritt verkauft werden. Ab 2026 dürfen die rund 600.000 Richtwert- und Kategoriemieten sowie alle Mieten auf Basis des „angemessenen Mietzinses“ nur um maximal ein Prozent steigen, 2027 um maximal zwei Prozent. Ab 2028 greifen die neuen Bestimmungen auch im regulierten Bereich. Zudem wird die Mindestbefristung von drei auf fünf Jahre verlängert.
Ein „Bremsanker“ soll wirken, sobald die Inflation in zwei Jahren mehr als drei Prozent beträgt: Der über drei Prozent hinausgehende Teil darf dann nur noch zur Hälfte an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden. Diese Regelung soll – mit wenigen Ausnahmen – für alle neuen und auch bestehenden Verträge gelten. Zusätzlich dürfen Mieten künftig nur noch einmal jährlich erhöht werden.
Diese Maßnahmen bringen zweifellos eine gewisse Entlastung und mehr Planbarkeit für Mieterinnen und Mieter. Doch sie sind kleinteilig, greifen spät und bleiben in der Wirkung begrenzt – ein klassischer Kompromiss, der weder die strukturelle Teuerung noch den Mangel an leistbarem Wohnraum löst.
Die neue Mietpreisbremse – Fortschritt oder Feigenblatt?
Die Mietervereinigung begrüßt die jüngste Entscheidung: Mit dem neuen „Mieten-Wertsicherungsgesetz“ sollen Erhöhungen künftig gebremst werden. Ein Fortschritt, zweifellos – aber ein begrenzter. Erst ab 2026 greifen die Regelungen, und auch dann bleiben sie ein Kompromiss. Befristete Verträge werden zwar etwas länger, aber nicht abgeschafft. Für viele Haushalte bedeutet das: ein wenig mehr Sicherheit, aber keine echte Wende.
Eigentümer warnen – und argumentieren absurd
Ganz anders die Sicht der Vermieterinnen und Vermieter: Für den Haus- und Grundbesitzerbund sind die Klagen über „explodierende Mieten“ ideologisch überzogen. Nicht die Mieten, sondern Betriebskosten und Energiepreise seien die wahren Preistreiber. Mietpreisbremsen würden Investitionen verhindern, Neubau drosseln und so das Angebot an Wohnraum verknappen. Diese Argumentation wirkt absurd: Denn wer steigende Betriebskosten als Hauptproblem benennt, kann nicht gleichzeitig jede Regulierung bei den Mieten ablehnen. In Wahrheit geht es um Renditeinteressen, nicht um Versorgungssicherheit. Mietpreisbremsen bedrohen nicht den Markt, sondern lediglich überhöhte Profite. Mal abgesehen davon, dass die Maßnahmen ohnehin sehr begrenzt wirksam sind aber selbst das scheint den Immobilienkonzernen schon zu weit zu gehen. Eingreifen soll der Staat in den Markt nur, wenn es darum geht die eigenen Profite zu sichern.
Der blinde Fleck: Gemeinnütziger und geförderter Wohnbau
Ein zentraler Schwachpunkt bleibt der Umgang mit dem sozialen und gemeinnützigen Wohnbau. Gemeinden selbst bauen kaum mehr Wohnungen, stattdessen dominiert der geförderte Wohnbau. Dieser, bezeichnet Wohnraum, der von Immobillienkonzernen geschaffen wird, und durch staatliche Mittel unterstützt wird, um ihn leistbarer zu machen. Gefördert werden sowohl Miete als auch Eigentum, wobei die Förderung an bestimmte Bedingungen und Einkommensgrenzen gebunden ist, die von den Bundesländern festgelegt werden. Doch dieses Modell ersetzt nicht den klassischen Gemeinnutz, der auf dauerhafte Leistbarkeit und soziale Durchmischung setzt. Gleichzeitig schreitet der Ausverkauf bestehender gemeinnütziger Bestände an private Investoren voran. Dass das neue Wohnpaket diese Entwicklung nicht einmal anspricht, ist bezeichnend – und gefährlich.
Wer das Thema ernst nimmt, muss über Feigenblätter hinausgehen: Die Gemeinden müssen wieder eigenständig bauen und so im großen Stil leistbaren Wohnraum schaffen, Spekulation kann letztlich nur durch Enteignung dauerhaft verhindert werden. Bis dahin bleibt Wohnen in Österreich das, was es längst ist: Profite für die einen, immer höhere Mieten für die anderen.