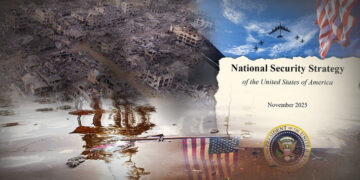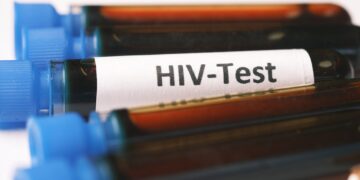In Österreich, einem der reichsten Länder Europas, wo Supermärkte täglich tonnenweise Lebensmittel entsorgen, gilt es als Gesetzesverstoß, sich aus dem Müll zu bedienen. Brot, das gestern noch verkauft wurde, wird damit zur juristischen Grauzone. Wer es aus Müllcontainern fischt, könnte sich strafbar machen – nicht etwa, weil es jemandem fehlt, sondern weil es „Eigentum“ des Abfallentsorgungsunternehmens ist. Willkommen in einer Welt, in der Eigentum mehr zählt als das Bedürfnis Hunger zu stillen.
Die Realität: Lebensmittelpreise sind in den letzten zehn Jahren um 37 Prozent gestiegen, Wohnkosten um 46 Prozent. Löhne? Oft stagnierend. Für viele reicht das Geld längst nicht mehr bis zum Monatsende. Was bleibt, ist für manche der Gang zum Müllcontainer.
Wer seine Schulden nicht mehr überblickt, landet irgendwann bei der Schuldnerberatung – im Durchschnitt mit 65.000 Euro im Minus. Der Rat der Expertinnen und Experten: Bargeld statt Karte. „Weil das aus ist, wenn’s aus ist.“ Willkommen im minimalistischen Elendsmanagement. Während der Markt dafür sorgt, dass Waren in den Müll wandern, soll der Mensch lernen, sich selbst besser zu kontrollieren. Die Verantwortung für Armut wird dem Individuum übertragen – nicht der Struktur. Selbstkontrolle statt Umverteilung, Verzicht statt Gerechtigkeit.
Gleichzeitig wirft der Konsumapparat unvorstellbare Mengen genießbarer Produkte weg – aus Kalkül. Denn Lebensmittel sind Ware, und Waren dürfen nicht kostenlos werden, selbst wenn sie bereits im Abfall liegen. Supermarktketten wie REWE geben sich dabei betont juristisch korrekt: „Dumpstern oder Containern heißen wir nicht gut, wir unternehmen aber auch keine rechtlichen Schritte.“ Wie großzügig. Gleichzeitig verweisen sie auf „gesundheitliche Gefahren“ durch verunreinigte Produkte. Die eigentliche Gefahr besteht allerdings in einem System, das Überschuss produziert und Zugang zu Lebensmitteln verweigert – nicht aus Mangel, sondern aus Prinzip.
Der Irrsinn endet nicht beim Brot. Auch das Sammeln von Pfandflaschen aus dem Müll ist illegal – denn dieser Müll gehört der Entsorgungsfirma. Wer Salatblätter aus leeren Kisten fischt, handelt nur dann legal, wenn der Marktstand ein Einsehen hat. Bedürftigkeit ist kein Rechtsanspruch, sondern bleibt eine Bittstellung an das Wohlwollen der Besitzenden.
Dieser Alltag ist kein Betriebsunfall, sondern das Resultat einer kapitalistischen Ordnung, in der selbst der Abfall verwertet werden muss – aber nicht von den Armen, sondern von Unternehmen. Es ist ein System, das Überschuss produziert und gleichzeitig die Bedürftigen diszipliniert. In dem es einfacher ist, in Armut zu geraten, als sich daraus zu befreien. Und in dem die Moral sich nicht gegen Verschwendung richtet, sondern gegen jene, die versuchen, ihr zu entkommen.
Wer heute im Container nach Brot sucht, sucht nicht nach Almosen, sondern nach Würde. Der eigentliche Skandal liegt nicht bei den Menschen, die Lebensmittel aus dem Müll holen, sondern in einem System, das diesen Müll produziert – und jene zurücklässt, die ihn brauchen.
Quelle: ORF