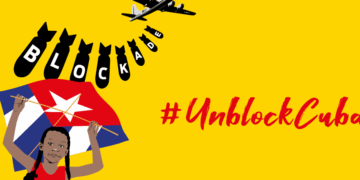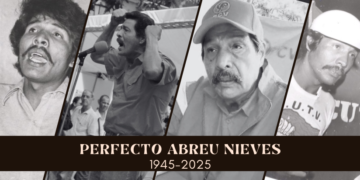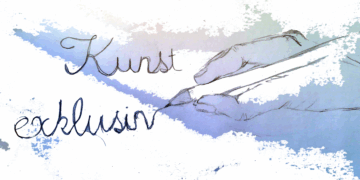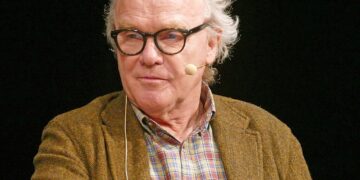Gastbeitrag von Gerhard Oberkofler, geb. 1941, Dr. phil., Universitätsprofessor i. R. für Geschichte an der Universität Innsbruck.
Wladimir I. Lenin an die „Enkel“
„Wir, die Alten, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe dieser kommenden Revolution nicht erleben. Aber ich glaube mit großer Zuversicht die Hoffnung aussprechen zu dürfen, dass die Jugendlichen, die so ausgezeichnet in der sozialistischen Bewegung der Schweiz und der ganzen Welt arbeiten, dass sie das Glück haben werden, nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu siegen in der kommenden proletarischen Revolution“ – das meinte der 47jährige Wladimir I. Lenin (1870–1924) am 9. Jänner 1917 im Zürcher Volkshaus in einer Versammlung der schweizerischen Arbeiterjugend bei seinem Vortrag über die Revolution in Russland von 1905.[1] Dieser „Alte“ erlebte wenige Wochen später in seiner Heimat die Februarrevolution 1917. Das revolutionäre Denken und Handeln von Lenin und seiner Genossinnen und Genossen führten zum Sieg der die Welt verändernden Oktoberrevolution 1917.
Am 1. Mai 1919, der nach der Revolution als „Fest der Befreiung der Arbeit“ galt, hielt Lenin auf dem Roten Platz in Moskau mit Blick auf die nachfolgende Generation eine Rede: „Unsere Enkel werden die Dokumente und Denkmäler aus der Epoche der kapitalistischen Ordnung als Kuriositäten bestaunen. Es wird ihnen schwerfallen, sich vorzustellen, wie der Handel mit Artikeln des täglichen Bedarfs in Privathänden liegen konnte, wie Fabriken und Werke einzelnen Personen gehörten konnte, die nicht arbeiteten. Bislang hat man über das, was unsere Kinder erleben werden, wie von einem Märchen gesprochen. Heute aber, Genossen, seht ihr klar und deutlich, dass das Gebäude der sozialistischen Gesellschaft, dessen Grundstein wir gelegt haben, keine Utopie ist. Noch eifriger werden unsere Kinder an diesem Gebäude bauen“.[2] Mit wunderschönen Geschichten aus dem Alltag von Kirgisien beschreibt Tschingis Aitmatow (1928–2008) die Grundlegung dieses Gebäudes.[3] In der Sowjetunion war der Kommunistische Jugendverband formal keine Parteiorganisation, er sollte eine richtungsgebende Organisation der Arbeiterjugend mit einer kommunistischen Organisation unter Führung der Partei sein.
Über die Gründung von Jugendorganisationen nach dem ersten Weltkrieg in Deutschland und Österreich
Nach Ende des ersten imperialistischen Weltkrieges wurde in Deutschland und Österreich der Jugend über die herkömmliche Perspektive hinaus besondere Aufmerksamkeit gegeben. Die ältere Generation wollte wie immer ihre Erfahrungen entsprechend ihrer Position in der Klassengesellschaft weitergeben. Der katholische Priester Romano Guardini (1885–1968) entwarf 1920 für die katholische Kirche ein widersprüchliches Konzept, um in der Jugend für das Christentum und die katholische Kirche tätig zu werden. Die durch Zusammenwirken von Sozialdemokratie und reaktionären bis erzreaktionären Kräften in Deutschland und Österreich zu Ende gegangene, vom revolutionären Aufbruch geprägte Situation nach 1917 sollte den davon enttäuschten Jugendlichen einen demütigen, angepassten und zugleich elitären Sehnsuchtsort mit „dreimal ja“ katholisch vermitteln.[4] Seine Inspiration erhielt Romano Guardini von einer Mainzer katholischen Jungengruppe, die sich nach der römischen Göttin der Jugendkraft „Juventus“ nannte.[5] Der sudetendeutsche katholische Priester Eduard Winter (1896–1982), der sich in der Deutschen Demokratischen Republik öffentlich für die „Jugendweihe“ einsetzte, hat in den 1920er Jahren im Sudetenland mit seiner dem Naturerlebnis verbundenen Jugendwanderbewegung in der katholischen Jugend sehr viel Anklang.[6] Unter den Gebeten der katholischen Jugend war in diesen Jahren das Gebet pro perfidis Judaeis ein nicht hinterfragtes Anliegen.
Am 20. November 1919 trafen sich in Berlin nach über Wochen andauernden illegalen Vorbereitungen Jugendliche aus europäischen Ländern und gründeten auf einem vom deutschen Kommunisten Willi Münzenberg (1889–1940) eröffneten Kongress die „Kommunistische Jugendinternationale“ (KJI). Delegierter aus Österreich war der 18jährige Wiener kommunistische Jugendliche Richard Schüller (1901–1957). Nicht dem „Altersklassenkampf“ innert der Kommunistischen Parteien sollte Vorschub geleistet werden, sondern die Gesinnung des Kommunismus sollte unmittelbar, organisch und in gemeinsamer Arbeit an die Jugend weitergegeben werden: „Die Erschließung des Erkenntnisses der Klassenlage der Jugend in der heutigen Gesellschaft – das ist der erste, der Haupt- und Zentralpunkt des Programms der KJI“.[7] Außerhalb der Sowjetunion mussten die Mitglieder KJI mit Diskriminierung und Verfolgung rechnen, in der Deutschen Ausgabe der „Jugend-Internationale. Kampforgan der Kommunistischen Jugendinternationale“ ist darüber zu lesen. Dennoch, ihre Kampflosung blieb aufrecht: „Kampf der Verelendung! Nieder mit dem Faschismus und dem imperialistischen Krieg! Es lebe die geschlossene Kampffront der werktätigen Jugend der ganzen Welt!“.[8] Die Vertiefung der kommunistischen Erziehung im Geiste des Leninismus der Mitglieder und deren Beitrag zur Geschlossenheit der kommunistischen Parteien gehörte zu den zentralen Aufgaben der KJI. Während des zweiten Weltkrieges musste die KJI aufgelöst werden (1943). Ihre Nachfolge traten seit 1947 (Prag, 20. Juli bis 17. August) die Weltjugendfestspiele an.[9]
„Hitlerjugend“ trifft sich in Wien mit der „europäischen Jugend“
In den Märztagen 1938 sind in Österreich die „Hitler-Jungen“ und „Hitler-Mädchen“ zur Ankunft des Reichsjugendführers Baldur von Schirach (1907–1974) in Wien aufmarschiert. Dieser hielt in Wien am 14. März 1938 am Platz vor dem Westbahnhof eine Ansprache: „Keine Klasse, kein Stand und keine Konfession zerreißt mehr Deutschösterreichs deutsche Jugend. In der kommenden Zeit gilt es, die ganze deutsche Jugend auf das Werk des Führers auszurichten und in den jungen Kameraden, die jetzt in eure Reihen eintreten werden, jene Ideale und jene Treue zu verwurzeln, die ihr Deutschösterreich und dem ganzen deutschen Volk in einer furchtbaren und harten Zeit vorgelebt hat.“[10] Der austrofaschistische Bundesjugendführer Georg Thurn-Valsassina (1900–1967) hat noch am 14. März 1938 die im „Österreichischen Jungvolk“ organisierten, in ihrer Mehrzahl aus der Kleinbourgeoisie kommenden Jugendlichen aufgefordert, in die Reihen der Hitler-Jugend, die ihr Erbe angetreten habe, einzutreten.[11] Die österreichischen Faschisten dachten wie die deutschen Faschisten „europäisch“ und organisierten sich als antirevolutionäre, antiproletarische und antisemitische Kohorten. In der Woche vom 14. – 19. September 1942 trafen sich Jugendführer aus Europa, um den „Europäischen Jugendverband“ zu gründen: „Die Jugend ist sich in dem Willen einig, die Erziehung ihre Jugend im Geiste der Soldaten durchzuführen, die heute gemeinsam den größten Sieg der Geschichte erringen“.[12] „Mit stärkstem Beifall“ wurde die von dem aus Finnland nach Wien gekommene Präsident der finnischen Jugendorganisation und Kommandant der finnischen Pfadfinder Pastor Antti Niilo Verneri Louhivouri (1886–1980) vorgestellte Entschließung der Arbeitsgemeinschaft „Ethische Erziehung“ begrüßt, denn: „Die Arbeitsgemeinschaft sieht in den Werten und Tugenden, welche die Soldaten Europas auf den Schlachtfeldern dieses Krieges im Kampf gegen den Bolschewismus und seine Verbündeten leuchtend vorleben, die geistigen und sittlichen Grundlagen des neuen Europa. Sie will den Glauben an Gott, sowie die Werte Familie, Volk, Vaterland, Ehre, Arbeit und Freiheit zu den unzerstörbaren Fundamenten der neuen europäischen Gemeinschaft machen“.[13] Louhivuori benutzte den Rufnamen „Verneri“ und sein Spitzname war „Louhisusi“. Louhi ist eine Figur aus der finnischen Mythologie und gilt als Göttin der Dunkelheit, der Unterwelt und des Todes, „susi“ bedeutet Wolf.[14]
Einige weibliche und männliche, zum Teil unter 18 Jahren alte österreichische Jugendliche wurden von „europäischen Werten“ nicht infiziert. Sie organisierten sich in der „Gruppe Soldatenrat“, die im ersten Kriegsjahr der deutschen Wehrmacht und ihrer Verbündeten gegen die Sowjetunion vielfältige und großräumige antifaschistischen Widerstandsaktionen für den Frieden und gegen den Krieg entfaltete. Ihr Einsatz in den Jahren zwischen 1940 und 1942 wurde von dem unter Leitung des Österreichers Ernst Kaltenbrunner (1903–1946) stehenden deutschen Sicherheitsdienst und der deutschen Justiz schonungslos verfolgt. SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner legte Wert, dass zur umfassenden Arbeit des Sicherheitsdienstes „die Fühlung mit der Hitler-Jugend und allen übrigen mit der Jugendarbeit betrauten Stellen einschließlich der Justizbehörden eine besonders tiefe“ war.[15] Unter den im Wiener Landesgericht Geköpften der „Gruppe Soldatenrat“ war der Wiener Sanitätssoldat Alfred Rabofsky (1919–1944).[16] Sein älterer Bruder und Kampfgefährte im illegalen Kommunistischen Jugendverband (KJI) Eduard Rabofsky (1911–1994) hat dank glücklicher Umstände und der Standhaftigkeit seiner Kampfgenossen trotz Folterung durch die Staatspolizei überlebt. Immer wieder hat Eduard Rabofsky mit seinen persönlichen Erfahrungen und als Jurist den die Jugend erfassenden Klassencharakter der Justiz dargestellt.[17] Der österreichische Jurist Wenzeslaus Graf Gleispach (1876–1944), der den Staat Serbien als „Täter“ bezeichnete, dessen Strafe mit dem Krieg zu vollziehen sei, hat während des ersten Weltkrieges die Justiz der deutschen Faschisten rechtswissenschaftlich vorbereitet.[18] An sein Denken knüpften die Grünen Deutschlands an, die 1999 an vorderster Front des völkerrechtswidrigen Bombenkrieges gegen Belgrad gestanden sind.
Um 1941 dachte der österreichische Pädagoge Carl Furtmüller (1880–1951) mit dem Decknamen Karl Schratt, dem die Flucht in das Exil geglückt ist, darüber nach, ob und wie weit die Hitlerjugend für das Schicksal der heranwachsenden Jugend bestimmend sein werde. Sein intellektuell privilegierter Blick auf die Struktur der Hitlerjugend war voreingenommen und verkennt deren Begeisterungsfähigkeit für ihren Führer, wenn er schreibt: „Fragen wir uns nun, was die Jugend von dem, was sie in der Jugendbewegung gesucht hat, im Nationalsozialismus wiederfinden kann, so muss man sagen, dass da von Bewegung eigentlich nur mehr in dem körperlichen Sinn des Marschierens und des Dauerlaufs gesprochen werden kann, im übrigen ist an ihre Stelle Erstarrung und feste Regelung getreten“.[19] Carl Furtmüller verkannte die Rolle des Sports als wichtiges Instrument der menschlichen Bildung und der Begegnung, dessen sich der deutsche Faschismus ganz gezielt bediente. Die Hoffnung allein, dass Erfahrungen in und mit der Hitlerjugend genügen werden, eine neue Jugend entstehen lassen, war völlig illusionär. Jugend allein kann die Zukunft nicht gestalten, da nützt auch eine rebellisch lärmende Studentenbewegung mit ihren zersetzenden Elementen und aparten Personen nichts.
Zehnjährige „Pimpfe“ haben 1941 am Vorabend des 20. April des Geburtstages von Adolf Hitler (1889–1945) dem Reichsjugendführer die Verpflichtungsformel zur Aufnahme in die Hitler-Jugend nachgesprochen: „Ich verspreche, in der Hitler-Jugend allzeit meine Pflicht zu tun in Liebe und Treue zum Führer und unserer Fahne, so wahr mir Gott helfe!“.[20] Diese Besiegelung knüpft an die Firmung in der katholischen Welt an, die in Österreich noch in den 1940er Jahren am Ende der vierklassigen Volksschule innerhalb des zuständigen Pfarrbezirkes gespendet wurde. Die Firmung als „Sakrament des Heiligen Geistes“ sollte der Beginn der aktiven Teilnahme am kirchlichen Leben bedeuten, die „Asche der Gewohnheit und der Untätigkeit“ abschütteln. Das jedenfalls wünschte sich Papst Franziskus (1936–2025).[21]
Gedanken an eine „Jugendführerschule“ in der Emigration
Wenige Monate vor der Befreiung Wiens durch die „Russen“ veröffentlichten Wiener Emigranten in London das Heft „Jugendführerschule des jungen Österreich“ (132. Westbourne Terrace, London, W. 2) mit einer Einleitung zu den Materialen von Fritz Walter. Fritz Walter ist der Deckname von Otto Brichacek (d. i. Otto Prhaček) (1914–1999), der Partner von Berta Brichacek geb. Gratzl (1914–2009), deren Deckname Emmi Walter war. Berta Brichacek und Otto Brichacek, deren Tochter die ungebrochene kommunistische Aktivisten Elisabeth Rizy (1947–2022) war,[22] haben mit wenigen anderen nach dem Einmarsch der deutschen Faschisten aus Wien vor der politischen oder rassistischen Verfolgung geflüchteten Jugendlichen eine Jugendgruppe in der Hoffnung auf die Wiedererstehung einer selbständigen Republik Österreich gegründet.[23] Fritz Walter, also Otto Brichacek, der im November 1945 in London zu den Mitbegründern des Weltbundes der Demokratischen Jugend (WBDJ) gehört, stellte das Programm für die Jugendführerschule vor:
„Unsere Jugendführerschule soll uns helfen, uns vorzubereiten für die Arbeit in den Reihen der österreichischen Jugend in der Heimat. Ebenso soll sie es uns ermöglichen, unsere Arbeit hier, in unserer Organisation ‚Junges Österreich‘ zu verbessern; und wir wissen recht gut, dass unsere Arbeit hier noch nicht beendet ist.
Wie der Name Jugendführerschule bereits sagt, sollen diese Kurse uns behilflich sein Jugendführer, Jugendleitet heranzubilden. Was ist ein Jugendführer? Wie muss ein Jugendführer beschaffen sein, um unsere Aufgaben meistern zu können? Der Jugendführer muss Erzieher und Leiter der Jugend sein. Er muss helfen bei dem Zusammenschluss der Jugend zu eigenen Gruppen – und sagen wir es noch deutlicher – er muss führend sein bei der Vereinigung junger Menschen zu freien, antifaschistischen, demokratischen Gruppen und Organisationen der Jugend. Niemand wird als Jugendleiter geboren. Man muss es lernen, wie man eben alles lernen kann. Man muss selbst lernen und mit der Jugend arbeiten und auch von ihr lernen. Man muss diese Arbeit lieben und bereit sein, auch Opfer auf sich zu nehmen. Man muss selbst jung sein, flink und lebensfroh, schnell sich zurechtfinden und überall, wo es notwendig ist, anpacken. Man darf kein ‚alter Professor‘ oder ‚Schulmeister‘ der Jugend gegenüber sein wollen.
In unserer österreichischen Jugendführerschule wollen wir uns bemühen, nicht Jugendführer im allgemeinen zu erziehen, sondern Jugendführer für eine demokratische, antifaschistische, österreichische Jugendbewegung. Das ist sehr entscheidend. Sicher werden Spiele in jeder Gemeinschaft von jungen Menschen gespielt, sicher werden Lieder in allen Jugendbewegungen gesungen, – das ist aber nicht der Inhalt einer Jugendorganisation, das sind nur einige Formen, – und selbst sie gleichen sich nur nach aussen hin, oberflächlich. Unsere Lieder und unsere Spiele helfen unserer Bewegung und unserer Idee. Sie stärken unsere demokratische Gemeinschaft und sind lebensfroh. Wir leben das Leben. Unsere Lieder besingen nicht den Tod, verherrlichen nicht das Morden und bereiten nicht zum Krieg gegen freie Völker vor.
[…]
Die österreichischen Jugendorganisationen haben viel von den Jugendbewegungen anderer Länder zu lernen. Die siebenjährige faschistische Abgeschlossenheit unserer Heimat und unserer Jugend haben es mit sich gebracht, dass unsere Jugend nur verhältnismäßig wenig von den demokratischen Jugendbewegungen anderer Länder etwas weiß. Wir wollen vor allem von den demokratischen Jugendorganisationen Großbritanniens, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjet-Union lernen. Wir wollen uns über die Erziehung der Jugend in diesen Ländern informieren. Wir müssen uns aber auch mit den demokratischen antifaschistischen Jugendorganisationen unserer Nachbarländer, und da vor allem mit den großen Jugendbewegungen in Jugoslawien und in der Tschechoslowakischen Republik, beschäftigen. Wir haben viel von ihnen zu lernen. […]
Unsere Losungen für diese österreichischen Jugendführerschule solle sein: ‚Wissen ist Macht‘ und ‚Alles für unsere Heimat‘. […].“
Mit Millionen von Opfern errangen die von der Jugend getragenen Völker der Sowjetunion über die mörderischen Kampftruppen des deutschen Faschismus den Sieg. Auch in Österreich zeichnete sich ein Neuanfang an und selbst im erzkatholischen Tirol sprach Bischof Paulus Rusch (1903–1986) von den Arbeitern, vom Weltfrieden, von der Welternährung und der weltweiten Not der „unterernährten Völker“. Es brauche zur Abhilfe Organisationen wie der Vereinten Nationen: „Aber immer gehört beides zusammen: Gesinnung und Einrichtung, Gesinnung und Organisation.“[24] Dieser Tiroler Bischof hat, auch wenn er vom „Arbeiterstand“ anstelle der Arbeiterklasse spricht, einige Jahre vor dem II. Vatikanischen Konzil (1962–1965) kommunistische Wegweisungen als Christ instinktiv aufgenommen und der Befreiungstheologie den Boden vorbereitet. Daran und an vieles mehr kann erinnert werden, gerade deshalb, weil im Auf und Ab der Geschichte ideologisch, politisch, ökonomisch und militärisch das Geschehen der Gegenwart von den imperialistischen Kräften bestimmt wird. Tradierte Erfahrungen dürfen nicht verloren gehen. Mit Wladimir I. Lenin müssen die Gesetze und Kräfte des Imperialismus wieder neu erforscht werden. „Die Geschichte tut nichts […] sie ist nichts als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen“. wie Karl Marx (1818–1883) treffend sagt.[25] Und so bedarf es einer neuen Generation der Jugend, die sich „unter den Bedingungen des disziplinierten, erbitterten Kampfes gegen die Bourgeoisie in bewusste Menschen“ zu verwandeln beginnt.[26]
[1] W. I. Lenin: Werke, Band 23 (August 1916-März 1917), Dietz Verlag Berlin 1975, S. 244–262, hier S. 261 f.
[2] W. I. Lenin, Werke, Band 29 (Dietz Verlag Berlin 1976), S. 319.
[3] Z. B. Kindheit in Kirgisien. Hg. und aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Hitzer. Unionsverlag Zürich 2010.
[4] Romano Guardini: Neue Jugend und katholischer Geist (= Das neue Münster. Baurisse zu einer deutschen Kultur). Matthias Grünewald Verlag Mainz Auflage Sechstes bis Achtes Tausend. 1924.
[5] Romano Guardini: Aus einem Jugendreich. Matthias Grünewald Verlag in Mainz 1921.
[6] Eduard Winter: Mein Leben im Dienst des Völkerverständnisses. Nach Tagebuchaufzeichnungen, Briefen, Dokumenten und Erinnerungen, Band 1. Akademie Verlag Berlin 1981; Ines Luft: Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere. Vom böhmischen katholischen Jugendbundführer zum DDR-Historiker. Leipziger Universitätsverlag GmbH 2016.
[7] Grigori J. Sinowjew: Die historische Rolle der KJI. In: Jugend-Internationale. Kampforgan der kommunistischen Jugendinternationale. Deutsche Ausgabe. 6. Jg., Heft 4, Dezember 1924, S. 100 f.; Programm der Kommunistischen Jugend-Internationale. Angenommen vom 5. Weltkongreß der KJI und bestätigt vom Präsidium des EKKI am 13. März 1929. Verlag der Jugendinternationale Berlin 1929, hier S. 6
[8] Z. B. Jugend-Internationale. Kampforgan der Kommunistischen Jugendinternationale. Deutsche Ausgabe. 4. Jahrgang. August 1923, Nr. 12.
[9] Vgl. Erwin Breßlein: Drushba! Freundschaft! Von der Kommunistischen Jugendinternationale zu den Weltjugendfestspielen. Mit einem Vorwort von Johano Strasser (Jungsozialisten). Fischer Tb Verlag Frankfurt a. M. 1973.
[10] Wiener Kronen-Zeitung vom15. März 1938.
[11] Ebenda
[12] Neues Wiener Tagblatt 19. September 1942
[13] Neues Wiener Tagblatt 19. September 1942; Das kleine Volksblatt vom 19. September 1942
[14] Frdl. Auskunft von Jenni Vilkman aus Helsinki!
[15] SS-Obergruppenführer und General der Polizei Dr. Kaltenbrunner, Chef der Sicherheitspolizei und des SD: Die Jugendarbeit der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes. In: Deutsches Jugendrecht. Heft 4, S. 26–32, hier S. 27.
[16] Eduard Rabofsky: Über das Wesen der „Gruppe Soldatenrat“. Erinnerungen und Einschätzungen. In: Helmut Konrad / Wolfgang Neugebauer (Hrsg.), Arbeiterbewegung – Faschismus – Nationalbewusstsein. Festschrift zum 20jährigen Bestand des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und zum 60. Geburtstag von Herbert Steiner. Europaverlag Wien / München / Zürich, S. 213–224; Willi Weinert: >Mich könnt ihr löschen, aber nicht das Feuer<. Biografien der im Wiener Landesgericht hingerichteten WiderstandskämpferInnen. Ein Führer durch die Gruppe 40 am Zentralfriedhof und zu den Opfergräbern auf Wiens Friedhöfen. 4. neu bearb. u. erg. Ausgabe Wien 2017.
[17] Vgl. Gerhard Oberkofler: Eduard Rabofsky. Jurist der Arbeiterklasse. Eine politische Biographie. StudienVerlag Innsbruck / Wien 1997.
[18] Wenzeslaus Graf Gleispach: Die strafrechtliche Rüstung Österreichs. Deutsche Arbeit 14 (1915), S. 257–268; Eduard Rabofsky / Gerhard Oberkofler: Verborgene Wurzeln der NS-Justiz. Strafrechtliche Rüstung für zwei Weltkriege. Europa Verlag Wien / München / Zürich 1985.,
[19] Karl Schratt: Ist die Hitlerjugend uns verloren? In: Der sozialistische Kampf. Begründet von Otto Bauer. 20. April 1940, S. 179–183.
[20] Reinhold Sautter: Hitlerjugend. Das Erlebnis einer großen Kameradschaft. Hg. mit Genehmigung der Reichsjugendführung von Gustav Memminger. Carl Röhrig Verlag München 1941.
[21] Papst Franziskus: Beginn der aktiven Teilhabe am kirchlichen Leben: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2024–10/papst-franziskus-generalaudienz-firmung-heiliger-geist.
[22] Lisl Rizy (1947–2022) – Zeitung der Arbeit
[23] Alfred Klahr Gesellschaft – Otto Brichacek, Robert Bondy; Günther Grabner: Geschichte der „Freien Österreichischen Jugend“ (FÖJ) als politische Jugendbewegung in Österreich 1945–1969. Diss. 1978 (Institut für Geschichte, Abtlg. für österreichische Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte Lehrkanzel Univ. Prof. Dr. Erika Weinzierl). Druck Steyr; Sonja Frank (Hg.): Young Austria. ÖsterreicherInnen im britischen Exil 1938–1947. Für ein freies, demokratisches und unabhängiges Österreich. ÖGB Verlag Wien 2012.
[24] Paul Rusch: Junger Arbeiter, wohin? Tyrolia Verlag Innsbruck 1953, S. 195.
[25] MEW 2 (1972), S. 98 (Die heilige Familie).
[26] W. I. Lenin, Werke, Bd. 31 (1974), S.284–290 (Die Aufgaben der Jugendverbände), hier S.284.