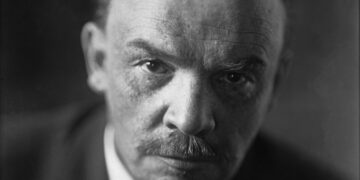In Europa wächst ein gefährlicher Trend: Der offene Antikommunismus kehrt zurück – nicht als Randphänomen, sondern zunehmend als Bestandteil staatlicher Politik. Was früher als Relikt des Kalten Krieges galt, erlebt heute eine Renaissance – mit Unterstützung oder stillschweigender Duldung durch die Europäische Union.
Kriminalisierung politischer Ideen
In Tschechien sollen Bürgerinnen und Bürger künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden, wenn sie Sympathie für den Kommunismus äußern. Ähnliche Gesetze existieren bereits in Polen und den baltischen Staaten. Die offizielle Begründung: Man wolle „totalitäre Ideologien“ bekämpfen. In der Praxis aber wird die kommunistische Bewegung mit dem völkermörderischen deutschen Faschismus gleichgesetzt – eine gefährliche und historisch falsche Gleichsetzung, die das antifaschistische Erbe Europas verhöhnt.
Der EU-Kommissar für Justiz, Didier McGrath, bestätigte jüngst in seiner Antwort auf eine Anfrage des griechischen EU-Abgeordneten Kostas Papadakis (Kommunistische Partei Griechenlands, KKE), dass diese Praxis völlig im Einklang mit den „Kompetenzen der Mitgliedsstaaten“ stehe. Mit anderen Worten: Die EU sieht keinen Grund, gegen die Kriminalisierung kommunistischer Ideen einzuschreiten.
Doppelmoral im Namen der Demokratie
Während die EU in anderen Bereichen lautstark behauptet die „Rechtsstaatlichkeit“ zu verteidigen, herrscht beim Thema Antikommunismus Schweigen. Dass Gesetze, die marxistische Parteien verbieten oder ihre Symbole kriminalisieren, eklatant gegen die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit verstoßen, scheint in Brüssel niemanden zu stören. Die europäische Demokratie präsentiert sich damit einmal mehr als selektiv – tolerant, solange die Meinung systemkonform bleibt.
Gerade in Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit, steigender Lebenshaltungskosten und neuer Kriegsgefahr gewinnt die kapitalismuskritische Perspektive wieder an Bedeutung. Wer das bestehende Wirtschaftssystem grundsätzlich infrage stellt, gilt schnell als „extremistisch“.
Geschichtsvergessenheit als politisches Programm
Die Gleichsetzung von Kommunismus und Faschismus – oft als „Hufeisentheorie“ bezeichnet – ist nicht nur wissenschaftlich widerlegt, sie ist politisch gefährlich. Denn sie verschleiert, dass der Faschismus ein Produkt des Kapitalismus war, während der Kommunismus historisch als dessen Gegenentwurf entstand. Der Antikommunismus dient damit als ideologische Waffe, um jede ernsthafte Systemkritik zu delegitimieren. Im Gegenteil stärkt der Antikommunismus indirekt erneut faschistische und chauvinistische Strömungen, den in der Ablehnung des Kommunismus ist man sich einig.
Auch in Österreich sind antikommunistische Reflexe tief verwurzelt – von der politischen Kultur der Zweiten Republik bis zur aktuellen Rhetorik mancher Medien. Wer sich für soziale Eigentumsformen, kollektive Entscheidungsprozesse oder eine gerechtere Verteilung des Reichtums einsetzt, stößt rasch auf den Vorwurf, „linksextrem“ zu sein.
Der Kampf der Völker lässt sich nicht verbieten
Doch trotz aller Versuche, kommunistische Ideen zu verbieten oder zu kriminalisieren, bleibt der gesellschaftliche Widerstand lebendig. Ob in Gewerkschaften, Mieterinnen- und Mieterinitiativen oder Friedensbewegungen – der Wunsch nach einer Welt ohne Ausbeutung und Krieg ist ungebrochen. Kein Gesetz, kein Verbot und kein ideologisches Framing wird verhindern, dass Menschen sich gegen Ungerechtigkeit erheben.
Der Antikommunismus der Gegenwart ist ein Symptom der Krise: Eine herrschende Ordnung, die sich zunehmend durch Repression statt durch Überzeugung legitimiert. Doch Geschichte lehrt, dass sich Ideen nicht einsperren lassen. Im 21. Jahrhundert wird die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, Frieden und Eigentum erneut gestellt werden – und mit ihr auch die nach einer Alternative zum Kapitalismus.
Quelle: Solidnet