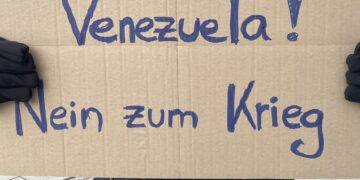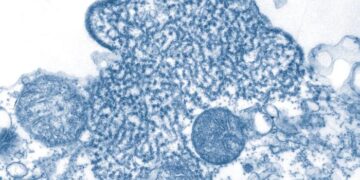Hans Marchwitzas „Kumiak“ wird KPD-Genosse (ab 1925), Antifaschist (1933)
Gastautor: Peter Goller, geb. 1961, Univ.-Doz. Dr. und Archivar an der Universität Innsbruck
Unser Gastautor Peter Goller widmet sich in einer fünfteiligen Artikelserie der Arbeiterliteratur. Im Mittelpunkt steht dabei das Leben und Wirken von Adam Scharrer und Hans Marchwitza. Peter Goller hat sich bereits in früheren Beiträgen für die Zeitung der Arbeit mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befasst.
1925 kehren die Kumiaks an die Ruhr zurück. Nationale Vereine, schlagende Studentenverbindungen, der Kyffhäuserbund feiern gerade den Abzug der Franzosen aus dem besetzten Ruhrgebiet. Die Bergarbeiter fürchten die Rückkehr der deutschen Sipo. „Sie bringen kein Brot, Gewehre bringen sie mit … Sie werden euch totschießen, denn dazu kommen sie her!“
Die versöhnlerisch sozialdemokratischen Gewerkschaftsverbände verhindern jeden Protest: „Auch an dem alten Gewerkschaftshaus, in dem der Verbandssekretär Grimanski seit Oktober 1918 herrschte, hing eine schwarzrotgoldene Fahne. Grimanski hatte eine Demonstration und den vorgeschlagenen Proteststreik gegen die Wiedereinsetzung der alten Polizei abgelehnt. Er hatte den Unzufriedenen mit Ausschluss aus dem Verband gedroht und damit die Auflehnung gegen die neue Regierungsmaßnahme wieder unterdrückt.“
Man lebte „in der Zeit der von den Gruben- und Stahlherren eingeleiteten Rationalisierung“. Die alten roten Ruhrkumpel Lewandowski, Kruschin, Kudiazek oder, wie sie alle heißen mögen, stehen immer noch auf der schwarzen Liste: „Alle drei waren entlassen worden und nach dem Zusammenbruch des Streiks 1923 auf keiner anderen Zeche mehr untergekommen.“ Seit 1889, 1905, 1912, 1920 haben sie sich in allen Ruhrbergbaustreiks bewährt und sich mit den „rotkragigen, blauuniformierten Polizeigarden“ herumgeschlagen. Nun sind sie wegrationalisierte „Stempelbrüder“. Der Bergkumpel Kruschin ist seit den Ruhrkämpfen 1920 halb invalid: „Im März zwanzig hatten sie ihm bei Dinslaken den Knochen zerschossen. Eine Kugel der Grünen war es gewesen.“ Mit seiner achtköpfigen Familie haust er in drei engen zugigen Räumen. (HK 5–7, 15)[1]
Auch Kumiak steht immer noch auf der schwarzen Liste, ganz abgesehen davon, er fände ohnedies keine Arbeit: „‚Arbeit? Mann, wo kommst denn du her?‘, sagte der eine. ‚Du machst wohl Spaß?‘ brummte der andere. ‚Oder willst du dich vielleicht unter Tarif anbieten? Schufte nehmen sie, aber dann brichst zu dir bald den Hals!‘ Der Mann spuckte aus und sah in drohend an.“ (HK 26)
Kumiak ist jetzt 43 Jahre alt. Er ist 1892 geboren. Seine Frau ist noch an die im Westpreußischen vermittelten Traditionen von Kirche und Religion gebunden, aber auch Kumiak selbst kann sich noch nicht aus der Taglöhnerwelt befreien. Er sieht den strengen verstorbenen Vater vor sich: „Ein Kumiak hat bisher noch immer seine Arbeit gefunden … Das alles fiel ihm wieder ein, während er in seine Dachkammer hinaufstieg, und er sagte sich unter tiefen Seufzern: ‚Sie hatten recht, ich hätt‘s mir tatsächlich überlegen sollen. Recht, recht hatten alle, die uns warnten!‘ Aber wohin sollten sie sonst? Als Tagelöhner zurück ins Dorf?“ Gewarnt hatten sie Kumiak vor einigen Jahren vor einem Wegzug aus dem Kleinhäuslerleben mit einer ärmlichen Kuh, aus dem Dasein als Knecht bei dem Gutsherren Schachanowski.
Der 1. Mai 1925 ist einer der Hoffnungslosigkeit, eine verschärfte absolute und relative Mehrwertausbeutung, vor allem die Arbeitszeiterhöhungen, ständige Aushebelung von Tarifen und eine den Arbeitern ungünstige staatliche Schlichtung empören. Beim Arbeitsamt sortieren sie alle roten „Skandal- und Radaubrüder“ aus. Lewandowski will Kumiak für die KPD gewinnen. Dieser erkundigt sich, „was man für die Partei bezahlen müsse“: 20 Pfennig für die Partei? HK 35f.
Nach den gescheiterten Arbeitskämpfen 1923 war es in dem um die Siebenstundenschicht geführten „Maistreik“ 1924 noch einmal zu einer Radikalisierung des Ruhrproletariats gekommen. Bei den Betriebsratswahlen 1924 wird die kommunistisch ausgerichtete „Union der Kopf- und Handarbeiter“ mit gut einem Drittel der Stimmen erstmals stärkste Gruppierung vor dem sozialdemokratischen „Verband“. Übrigens: Der Autor Hans Marchwitza wurde 1924 nach Streikende entlassen und andauernd auf eine „schwarze“ Liste gesetzt.[2]
Ende 1925 schließen sich der alte sozialdemokratische Bergarbeiterverband und die Union zusammen, allerdings zu den Bedingungen des Verbandes. Grimanski, der ehemalige Bergarbeiter und nunmehrige „Kleinbürger“, will gestandene Unionisten wie Lewandowski nicht mehr aufnehmen: „Die Wiedervereinigung der beiden großen Arbeiterorganisationen, des alten Bergarbeiterverbandes und der Union der Kopf- und Handarbeiter, war nach vielen Verhandlungen und Kämpfen vollzogen worden. Aber viele Funktionäre der Union … warteten noch immer auf eine Bestätigung ihrer Wiederaufnahme in den Verband, unter ihnen waren auch Jupp Kudiatzeck und die beiden Alten, Lewandowski und Kruschin.“
Die beiden alten Häuer, die schon vor 1914 so viel für den Verband gelaufen waren, sind verbittert: „Sie haben uns als die ‚Unruhestifter‘ nicht wieder aufgenommen.“ Ein Apparatschik hat über einen Bergarbeiter wie Jupp Kudiatzek, der 1920 an der Ruhr gekämpft hat, entschieden: „Seine Fäuste und seine Schultern hatten im Herbst neunzehnhundertzwanzig die Zellentüren des Essener Gefängnisses zerbrochen, als er seine gefangenen Genossen herausholte.“
Lewandowski sieht in seinem Ausschluss die Fortsetzung einer langen Verratsgeschichte:
„Seit 1912, seit unserem großen Streik, stockt es irgendwie und geht und geht nicht weiter. Zum Krieg haben sie ‚Ja‘ gesagt, das war ihr erstes großes Vergehen, damit haben sie uns geopfert, und dann ging es weiter, ein Verrat nach dem anderen. Im November haben sie uns verkauft, mit Hindenburg haben sie sich befreundet und haben ihn gestützt. Mit ihrem Einverständnis sind Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg erschlagen worden. Natürlich möchten diese Leute unsereinen nicht gern wieder im Verband sehen.“ (HK 48, 51)
Langsam leuchten auch Kumiak – er tritt in vielem naiv wie ein Schwejk an der Ruhr auf – die nicht zu übersehenden Widersprüche als die des Kapitalismus ein. Er sieht den Reichtum, „die Schornsteine rauchten, die Seilscheiben im Schacht drehten sich“: „Viele, die mit ihm stempeln gegangen waren, hatten wieder Arbeit bekommen, aber sie schlichen immer welk und abgehungert umher, wie vorher. Die Zeitungen schrieben: ‚Deutschland gesundet wieder‘, (…). Und daheim fand man in der Bohnen- oder Kohlsuppe jeden Mittag mehr Schaben als Speck oder Fleisch.“ (HK 81f.)
Noch einmal wirbt der „gelbe“ Bergbaubeamte Baum um Kumiak. Baum ist Organisator im paramilitärischen „Stahlhelmbund“: „Wenn du mit den roten Brüdern rumrennst, dann kannst du nichts werden.“ Baum organisiert rechte Aufmärsche, „Musikkapellen schmettern den Alten Torgauer und den Dessauer und den Fridericusmarsch“. Er mobilisiert Angestellte, Kleinbürger, Händler, „kräftige Wirts‑, Bäcker und Fleischerbäuche, bebrillte Beamtengesichter und darunter die schmalen, dreisten Schülergesichter“. Zechendirektor Hindemann finanziert diverse Stahlhelm-Provokationen: „Baum hatte verlauten lassen, dass er die roten Arbeiterfestungen im Sturm nehmen werde.“ Kumiak lässt Baum stehen. (HK 88, 94)
Anfangs 1926 tritt Ernst Thälmann vor den Ruhrbergarbeitern auf, die Internationale erklingt. Kumiak ist beeindruckt. Thälmann spricht gegen die „verlogene Arbeitsgemeinschafts- und Schlichterpolitik“, erinnert an die Kämpfe des Spartakusbundes, an den Ruhraufstand 1920, an den Versuch, die Lasten der Reparationen über den „Dawes-Plan“ auf die Arbeiterklasse abzuwälzen, an die neue Kriegsgefahr: „‚Die Krupp‘, sagte Thälmann, ‚die Stinnes. (…) Unsere Kinder sollen nicht zum zweitenmal Kanonenfutter werden.‘“ Kumiak tritt dem 1924 gegründeten Roten Fronkämpferbund bei, erster Einsatz: Demonstration gegen Stahlhelm-Aufmarsch! (HK 58–62, 93)
Im großen Metallarbeiterstreik von 1928 („Ruhreisenstreit“) läuft der arbeitslose Kumiak als Spendensammler für die Internationale Arbeiterhilfe (IAH), für die Rote Hilfe. Es stößt auf viel Solidarität und auf noch mehr Unverständnis: „Warum streiken denn die Dummköpfe jetzt, wo sie noch Arbeit haben. Es doch purer Übermut, in einer solchen Zeit zu streiken, wo Tausende auf Arbeit warten! (…) Heut‘ streiken, das ist reiner Selbstmord.“ Kumiak versucht dagegen zu halten: „Das Rennen um die Groschen war eine ermüdende Geschichte.“ (HK 111f.)
Ein alter jüdischer Textilhändler Levy spendet, will aber aus Angst vor antisemitischer Diffamierung nicht in der Spendenliste aufscheinen: „Nein, lassen Sie’s, ich geb‘ Ihnen so – gehen Sie und reden Sie nicht darüber.“ Viele Proleten kauften bei Levy zu günstigen Preisen billige Stoffe. Einer seiner Söhne, ein Arzt, ist stolz auf die Kriegsdekorationen als Leutnant. Dessen Bruder Sally Levy vertritt als Anwalt auch die „Rote Hilfe“. Er wird 1933 so wie Kumiak oder Lewandowski im KZ Börgermoor interniert. Sally Levy will seinen Bruder desillusionieren: Dieser müsse doch einsehen, dass die ganzen Kriegervereine ihn „heute nur wieder als den Juden Levy und nicht als den Herrn Leutnant Levy, der mit Orden und Ehrenzeichen behängt zurückgekommen war, betrachten“. (HK 111f., 121)
Der Arbeitskampf steht Ende 1928 auf der Kippe: „Und wenn wir daheim Kartoffelschalen fressen müssen‘, sagen andere, ‚es wird nicht aufgegeben.‘ – ‚Wir wären tatsächlich Schläge wert, wenn wir jetzt kuschen würden!‘ (…) Die IAH hatte in den Wohnbezirken der Werkarbeiter Küchen eingerichtet, aus denen sich die Frauen der Streikenden in Töpfen Essen holten. (…) Die durch das lange Streiken der Männer erbitterten und verängstigten Frauen fanden hier eine willkommene Gelegenheit, sich ihren Groll vom Herzen zu schimpfen.“
Jupp Kudiatzeck ist ein erprobter roter Arbeiterkämpfer, er will noch nicht aufgeben, auch wenn unter Polizeischutz immer mehr Streikbrecher herangekarrt werden: „Einige Gesellschaften hatten über ihre Belegschaft vollständige Aussperrung verhängt. Die gewaltigen Hallen lagen totenstill da, die Hochöfen wurden nicht mehr unterhalten, die Ankündigungen der Aussperrung in den Zeitungen und an den Werktoren war für viele ein Todesurteil.“
Viele Streikaktivisten werden mehr oder weniger verdeckt entlassen: „Als die Werkmänner in der Markenkontrolle zum ersten Mal nach sechs Wochen wieder nach ihrer Kontrollmarke griffen, war bei manchen ein Zettel darüber gesteckt. Auf dem Zettel stand: ‚Wegen Stilllegung der Arbeitshalle fühlen wir uns verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass mit Ihrer Wiedereinstellung nicht gerechnet werden kann!‘“ (HK 124–128)[3]
Der erwerbslose Kumiak ist auf Wunsch von Lewandowski als Wohnzellenkassier der KPD aktiv: „Und der Wunsch nach ‚Arbeit‘ war in graue Ferne gerückt.“ Der Niederschlag des 1. Mai 1929, der Berliner Zörgiebelsche Blutmai mit den von der Polizei niedergeschossenen Arbeitern deprimiert Kumiak: „Daraufhin hatte die sozialdemokratische Regierung ein Verbot des gesamten Roten-Frontkämpfer-Bundes erlassen.“ (HK 135f.)
Der „Blutmai 1929“ schreibt sich tief in das Bewusstsein nicht nur kommunistischer, sondern auch sozialdemokratischer Genossen und Genossinnen ein. Allein das ausgerechnet vom sozialdemokratischen Polizeipräsidenten Emil Zörgiebel erlassene Demonstrationsverbot war für alte Maidemonstranten unfassbar, so legt Klaus Neukrantz 1931 in seinem Roten Eine-Mark-Roman „Barrikaden am Wedding“ einem ergrauten Sozialisten folgende Worte in den Mund: „Der Alte schüttelte leise den Kopf. ‚Nee … nee, Willi …, ick gloob es noch nich! So alt wie ick heute bin, habe ick jeden 1. Mai gefeiert und bin seit 40 Jahren, solange wie ick organisiert bin, uff de Straße gegangen – Willi …, ick weeß et noch, als wir 1890 zum erstenmal am 1. Mai mit rotem Schlips und de Nelke in‘ Knopploch hier in Berlin demonstriert haben. Draußen am Landsberger Tor. Da hab’n se vor Schreck gleich den ‚Verband Berliner Metallindustrieller‘ gegründet gegen die Maidemonstration … Der hat der Polizei nachher 3000 Mark vor ‚geleistete Dienste‘ gegeben, weil se so schön blank gezogen haben gegen uns – Hat aber nischt geholfen …‘ Einen Augenblick schwieg er, als wenn er angestrengt über etwas nachdachte. ‚Willi …, ob se … nach’en Mittwoch dem Polizeipräsidenten von Berlin … ooch Geld dafür geben werden?!‘“[4]
Die Behörden und die Zechdirektion inszenieren eine scheinheilige Trauerfeier für in der Grube getötete Bergarbeiter und entrücken dabei das Unglück in das natürlich Gegebene. Direktor Hindemann spricht „von unheilvoller Wirtschaftskrise und Not des Vaterlandes, von unerwarteten Schicksalsschlägen“. Der Häuer Jupp Kudiatzek widerspricht den Herren mit den Zylinderhüten: „Der furchtbare Krieg geht weiter. Dieses Mal raffte sie nicht die Kugel dahin, die Stoppuhr, die Angst vor der völligen Brotlosigkeit raffte sie dahin. Die Krise, der größte Betrug, den man mit uns armen Menschen je getrieben hat, hat auch diese Opfer verursacht.“ Der Zechdirektor winkt rot vor Ärger einen Polizeioffizier heran: „Schaffen sie den Mann weg, es ist doch eine Schande – an so einem Tag.“
Unter Rufen „Nieder mit den Ausbeutern! Nieder mit den Mördern!“ stimmt die Trauergesellschaft das „Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt!“ an. Jupp K. wird verhaftet. (HK 144)
1938 wird Walter Benjamin Anna Seghers‘ Roman „Die Rettung“ als eine „Eine Chronik der deutschen Arbeitslosen“ beschreiben. Sieben Bergarbeiter haben im November 1929 überraschend ein Grubenunglück in einem oberschlesischen Montandorf überlebt, um dann an der gesellschaftlichen Katastrophe der kapitalistischen Massenarbeitslosigkeit zu scheitern: „Werden sie die Solidarität, die sie in der Naturkatastrophe bewährt haben, in der Katastrophe der Gesellschaft bewahren können?“
Die von Seghers beschriebene Verlangsamung des Arbeitslosenlebens, die gesellschaftliche Erosion Richtung Faschismus, die Qualen des Müßiggangs, die nicht nur zu einer Streckung des Haushaltsgelds, sondern auch des psychischen Erlebnishaushalts führen, hebt Benjamin hervor: „Diese Proletarier müssen bei ihrem immer geringeren Einkommen zugleich ein immer geringeres Erleben strecken. Sie verfangen sich in nichtssagende Gepflogenheiten; sie werden umständlich; sie führen über jeden Pfennig ihres eingeschränkten psychischen Haushalts Buch.“
Benjamin zeigt aber auch, wie Anna Seghers ein dagegen anwachsendes Klassenbewusstsein gestaltet. Die Hauptfigur des Romans entwickelt sich vom katholisch braven Bergarbeitertruppführer, „der nichts auf den Herrgott und seinen Pfarrer kommen lässt“, zum vom Faschismus verfolgten Illegalen: „Er ist von Hause aus kein politischer Kopf, und ein radikaler am allerwenigsten. (…) Es ist übrigens ein langer Weg. Er führt Bentsch in das Lager der Klassenkämpfer.“[5]
Ab 1930 terrorisieren Hitlerbanden die Ruhrgegend: „Der alte, zähe Genosse grollte: ‚Diese braunen Rotten sind nichts anderes als der neue Krieg. Sie finden oben überall Unterstützung, und wir sind nur auf uns angewiesen. Unsere sozialdemokratischen Genossen müssten sich mehr regen, aber sie lassen sich von der lahmen Politik ihrer Führer leiten und vergessen ihre Pflicht als Sozialisten. Neunzehnhundertfünf und neunzehnhundertzwölf standen wir noch zusammen, und heute geht es nicht mehr? Ein Keil wird seit neunzehnhundertvierzehn, seit neunzehnhundertachtzehn zwischen uns getrieben von gewissenlosen Spekulanten und von unserer Sache längst abgekehrten Politikern.“
Die Stahlhelmtruppen des Bergingenieur Baum rücken in den Hintergrund. Jetzt geben rabiate SA-Figuren wie der „herrische“ Glimke mit seinem „zersäbeltem Gesicht“ den Ton an. Er konferiert mit den Werksdirektoren. Glimke ist der Typ des rabiaten Freikorpsoffiziers, 1920 einer von den Kapp-Lüttwitz-Offizieren, „die unter General Watter im März 1920 das Waffenstillstandsabkommen von Bielefeld brachen und die Metzeleien bei Wesel, in Bottrop und Pelkum in Szene gesetzt hatten“. Der SA-Führer Glimke spottet „über die unkriegerischen Gestalten und die Bürgerbäuche in Baums Stahlhelmbund“. (HK 151–153)
Kumiak hat 1929 noch einmal Arbeit gefunden. Kumiak lässt wieder einmal sein mühevolles Leben passieren, die Schinderei als Knecht und Kleinhäusler im Westpreußischen unter der Fuchtel des Herrn von Schachanowski: „Sein Leben war eine lange, von keiner Menschenseele beachtete Mühe und Hetzjagd gewesen, in keinem Buche beschrieben, denn man glaubte ja über ‚Besseres‘ schreiben zu müssen. (…) Ja dachte Kumiak, wenn unsereiner nicht mehr will, dann schreien sie nach der Polizei, und der Kolben schlägt auf den Kopf, denn du bist ja nur ein Kumiak, ein armseliger Hund.“ (HK 177f.)
Im neuen Schacht trifft er auf den klassenbewussten Kollegen Bergemann, der später mit seiner Frau Lena von den Nazis gequält und verfolgt werden soll. Bergemann orientiert sich an der Oktoberrevolution: „In Russland hat das Volk seine Parasiten zum Teufel gejagt – da herrschen kein Hindenburg und Stinnes!“ Wir müssen uns mit den „Kapp-Lüttwitz“, mit den „General Watter“-Figuren herumschlagen. Bergemann hat so wie Lewandowski Lenin gelesen, aus Bergemanns Mund hört Kumiak ihm noch immer fremde Begriffe wie „Diktatur des Proletariats“. (HK 186)
Kumiak liest vermehrt Parteibroschüren, Stellen aus dem „Kommunistischen Manifest“. Da stoßen Kumiak und Lewandowski auf allerhand fremde Begriffe, wie jenen von den zu enteignenden Expropriateuren: „Ex-pro-priateure (…) ‚Na, was soll das sein?‘, brummte Lewandowski (…). ‚Dann kann ich’s dir sagen‘, sagte Kumiak wichtig. ‚Du weißt doch, die Ausbeuter bestehlen uns doch um unsere ganze Arbeit, sie bestehlen unsere armen Menschen, um ihre Mühe – Siehste – Ex-pro-priation ist eben die Enteignung der Spitzbuben, verstehst du. Die Enteignung der Enteigner …!‘“
Lewandowski wiederum hat Kumiak mit Lenins Sager von der Köchin, die den Staat regieren soll, in ungläubiges Erstaunen, eine Köchin? (HK 234)
Willi Bredel hat 1931 in seinem Roman „Rosenhofstraße“ nicht nur die Armut, die Welt der repressiven Armenpflege, des täglichen Gangs zur Pfandleihe, die von einer kommunistischen Straßenzelle organisierten Delogierungsblockaden, einschließlich Mieterstreiks, sondern auch die proletarische Hamburger Bildungswelt geschildert. In einer engen Arbeiterwohnung findet sich ein Brett mit Büchern von Friedrich Engels Grundsätzen des Kommunismus, Franz Mehring Geschichte Sozialdemokratie, August Bebel Sozialismus und Frau, Lenin Staat und Revolution, Upton Sinclair Jimmie Higgins, Gottfried Keller Der grüne Heinrich, Schriften von Kropotkin. Im Parteilokal finden Vorträge über die Pariser Kommune statt, in denen Gustav Noske mit den Mördern der Kommunarden gleichgesetzt wird. (Rosenhofstraße 2. und 8. Kapitel)
Otto Biha hat 1930 angesichts einer Flut an bürgerlicher „Konfektionsware des Geistes“, an „reaktionärer Schundliteratur“ konsequente „rote Literarturarbeit“ eingeklagt: „Die von den Scherl und Ullstein der Welt am fließenden Band des Geistes hergestellte Ideologie ist das gefährlichste Giftgas an der Kulturfront. In überfüllten Wartesälen, in den U‑Bahnen am Morgen folgen Millionen in allen Industriezentren in ihrer Phantasie den Schicksalsberichten der ‚Selfmademan‘-Romantik des kleinen Mannes, der Erfolg hat, des Redlichen, der es ‚zu etwas‘ bringt, während sie der trostlosen Wirklichkeit ihrer alltäglichen Tretmühle entgegenrasen. Die Romantik begleitet sie in ihre Elendsquartiere und zaubert den Traum von Luxus und Wirklichkeit an die graue Wand ihres Lebens. Sie füllt die Leihbibliotheken der Arbeiterviertel, sie steckt in der Rocktasche der Erwerbslosen, die stempeln gehen, sie verfolgt die Ausgesteuerten und Kranken in die Obdachlosenasyle und Spitäler.“ Dem muss der „rote Massenroman“ entgegengestellt werden.
Bei allen Erfolgen der Arbeiterkorrespondentenbewegung, der roten „Lit.-Stellen“ waren sich die Aktivisten des „Bundes proletarisch revolutionärer Schriftsteller“ 1931 bewusst, dass die bürgerliche Bildungsideologie selbst auf die kommunistisch organisierte Arbeiterschaft weiterhin in großem Maßstab einwirkt: „Von den Kurzgeschichten der Tagespresse bis zu Courths-Mahler und den Detektivromanen wird diese Literatur in Millionen Exemplaren nach wie vor unter den Werktätigen abgesetzt. Presse, Radio, Kino, Theater, Schule, Leihbibliotheken, Bücherkreise stehen im Dienste der Verbreitung dieser Literatur. Der proletarisch-revolutionären Literatur ist es dagegen noch nicht einmal gelungen, im fortgeschrittensten Teil der Arbeiterbewegung die bürgerliche Schundliteratur zu verdrängen.“[6]
Kumiak betätigt sich als Arbeiterkorrespondent für den „Roten Schachtboten“. Er zögert, hatte er doch von Kindheit an als Hüterbub arbeiten müssen, und so kaum etwas von der ohnedies miserablen Volkschulbildung mitbekommen, und folglich auch Probleme mit der Rechtschreibung. Fritz Kulik, ein neuer Arbeitskollege, der Kumiaks Tochter Martha heiraten wird und nach 1933 als illegaler KP-Kader flüchten muss, lässt dies nicht gelten: „Deine Kassierung ist eine notwendige Arbeit für die Organisation der Partei. Sie ist genau so wichtig wie das Wissen, das unsere Partei beherrschen muss.“
Im „Roten Schachtboten“ waren „die verschiedenen Missstände in der Grube beschrieben und die Verwaltung wegen der willkürlichen Gedingelöhne der Kohlenpartien angegriffen worden“. Als „Mieter aus einem solchen Mauseloche“ schreibt Kumiak einen ersten Artikel: „Da hocken in einer vollgestoppten Kolonie hunderte Leute, die eine halbes oder ein Dutzend Krabben haben, in Löchern wie die Mäuse und Kaninchen. Das sind keine gesunten (!) Zustände. Warum baud (!) die Direkzion (!) keine neuen Wohnungen? Nu, weil sie das Geld für andere Zwecke aufspart. Wir werden es spüren, wenn sie wieder Krieg machen, da wird das ganze Geld verpulvert und wir Menschen umgebracht, die sich heute in den Rattenlöchern rumquetschen müssen.“ (HK 191–193)
Carl Grünberg, selbst anfangs Korrespondent, berichtet, dass die in der „Roten Fahne“ eingefügten Betriebsseiten den Verkauf der Zeitung im lokalen Rahmen erleichtert hat, allein die Ankündigung einer Arbeiterkorrespondenz genügte: „Solche Ankündigungen wie ‚Lesen Sie nächsten Freitag: Enthüllungen über Rationalisierungsmethoden bei Borsig‘ lösten bei den Herren der Betriebe bereits im voraus Schrecken aus. Die Belegschaft aber freute sich und riss unseren vor den Fabriktoren an dem betreffenden Tag verstärkt eingesetzten Händlern die Zeitungen förmlich aus der Hand.“[7]
Ab 1929 betätigen sich die KP-Genossen an der Ruhr für die neue Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO). Ein schläfriger SP-Verbandsbetriebsrat fühlt sich von diesen „Spaltern“ bedrängt: „Sag das deinen Leuten, dass die Einheit auf diese Weise schon gar nicht zustande kommen kann. Sag es ihnen, jawohl.‘“[8]
Ein ewig abwieglerischer Betriebsrat hält sich, „in Paragraphen und Klauseln verrannt, nur an die Anordnungen [der] Verbandsführer, und das ganze Gewerkschaftsleben erschien wie ein eingefrorener, unbeweglicher Strom.“ Die mit der kapitalistischen Wirtschaftskrise ab 1929 einsetzenden Entlassungen nimmt er als unabwendbares Faktum hin: „Was glaubst du denn heute mit einem Protest zu erreichen? Man läuft damit höchstens Gefahr, dass noch andere auf die Liste kommen. Ich will das nicht verantworten. Willst du die Leute vielleicht zum Streik auffordern?“
Viele Bergarbeiter lassen sich nicht abwimmeln. Man soll „nicht stumpfsinnig Kündigung um Kündigung“ hinnehmen. So zu handeln ist eine Schande für die Partei August Bebels: „Überlege es dir, wo du hinsteuerst. Das, was du tust, haben uns Marx und Bebel nicht gelehrt. Unsere Novembergeschichte ist an dieser Politik gescheitert, unsere guten Genossen Karl und Rosa sind durch diese Politik umgebracht worden. (…) Den Nutzen daraus ziehen unsere Ausbeuter. Und wenn ihr ihnen alle Dienste getan habt, dann werden sie auch dir einen Fußtritt geben.“ (HK 215–217)
Im Schacht spielen sich Szenen ab, die an Emile Zolas „Germinal“ erinnern: ein demoralisierter mehrmaliger Streikbrecher, ein verbitterter sich selbst anschweigender, hustend keuchender Kollege, psychotisch ängstliche, ganz „abgewrackte Menschen“ ohne Illusion, ohne Hoffnung. Kumiak ist ratlos: „Die mühselige Straße ihres Lebens war mit unzähligen Leiden und Sorgen besät, und kein Rachegott hatte sich je eingestellt, um sie ihrer Not zu entreißen und die Frevler zu strafen.“ HK 225
Und trotzdem träumen auch die Hoffnungslosen von einer Welt ohne Ausbeuter, von Gerechtigkeit, so in einem Bergloch einer dieser geächteten Kollegen zu Kumiak: „Wo andere sich schon auf ihr Verrecken vorbereiten, glaubst du wie ein glücklicher Narr an diesen Wahn. Aber ich glaube auch schon langsam, dass es tatsächlich möglich wäre, ohne die verfluchte Antreibergesellschaft zu leben. Wer schuftet denn nur? Wir doch alle, wir Dummköpfe oder ist’s nicht so? Ohne uns kriegen sie keine Schippe voll Kohle heraus. Und was für ein Leben führen wir dennoch: zum Wahnsinnigwerden! (…) Die Treiber brauchen uns gar nicht anzutreiben, wir treiben uns selber an. Ja, man schuftet sich ins Grab, weil einen diese verfluchte Angst nicht verlässt. (…) Wir sind hier wie angekettet.“ Kumiak erinnert an seine eigene fatalistische Resignation: „Das sagte ich früher auch immer. Später erst hab‘ ich gemerkt, was ich für’n Esel war. Ich lebte so, wie es die Herren bestimmten und nicht, wie ich es wollte. Sie nahmen den Taler und ich kriegte den Pfennig!“ (HK 227–229)
Die Krise versinnbildlicht sich für die Bergarbeiter in der Stoppuhr der Aufseher. Ein Ingenieur, ein Faschist, hetzt Kumiak und Kollegen mit einer Uhr. Er kam immer öfter in den Stollen „und hielt dabei eine Uhr in der Hand, wie Wettende bei einem Pferderennen. Es sah so aus, als verfolge er jeden Schlag und jede Schippenbewegung, vielleicht sogar jeden Atemzug. Wenn der Häuer eine Sekundenpause machte, um nach einem anderen Werkzeug zu greifen, verzog sich das spitze Gesicht des Laufhundes ärgerlich: ‚Warum unterbrechen Sie gerade jetzt das Hauen? Los, hauen Sie weiter!‘“
Kumiak berichtet für den „Roten Schachtboten“ unter dem Namen „Philipp Oonehemd“: „… bei uns in der Rutsche sind sie jetzt mit der Stoppuur. Das is eine Teufelserfindung. Der Steiger krazt sich und wir scharren wie die Aaffen. Die Verwaltung will sowas aus uns machen. Dafür also diese Uur. Was kann man dagegen tun? Einfach wie der Steiger. Auch die Uur zusehn und sich ebenso kratzen. Dann ziehn sie sicher mit allen diesen Teufelsuuren wieder ab.“ Die Aufseher-Type Grüneich sieht sich mit passivem Arbeitswiderstand konfrontiert. Mit der Rutsche, in der Kumiak arbeitet, ist er besonders unzufrieden: „Wenn ich denen auf die Spur komme, die mir die Partie verderben, die haben hier ihre letzte Schicht getan.“ (HK 230f., 248)
Willi Bredel beschreibt 1930 in seinem proletarischen Alltagsroman „Maschinenfabrik N & K“ in Form episodischer Enthüllungstechnik den analogen Kampf einer kommunistischen Betriebszelle gegen eine übermächtig scheinende reformistische Gewerkschaftsbürokratie. In einer Hamburger Maschinenfabrik protestieren 1929 Gewerkschaftsoppositionelle (RGO) in ihrer Betriebszeitung „Der Rote Greifer“ gegen die Neukalkulierung, also gegen die Herabsetzung der Akkordlöhne. Arbeiterkorrespondenten berichten über herabgekommene Aufenthaltsräume, über verdreckte Abortanlagen, über fehlende Arbeitsschutzeinrichtungen, über Arbeitsunfälle, über einen alten Arbeiter, der entlassen in den Suizid getrieben wird. Der freigewerkschaftliche Betriebsrat wird im Sinn der Sozialfaschismuslosung als willfähriges Werkzeug des Kapitals dargestellt.
Neben der kleinen RGO-Betriebszelle und den vielen sozialdemokratisch passiven Arbeitskollegen gibt es vereinzelt scheinradikale oder „gottsuchende“ Kollegen und nicht selten den Typ des sich nach vielen Enttäuschungen gerade in der neuen Wirtschaftskrise zynisch in Kleinbürgernischen Zurückziehenden: „Der alte Mathews war seit dem Kriege politisch uninteressiert, indifferent. Die Enttäuschungen, die ihm als einem alten Sozialdemokraten aus den achtziger Jahren die Scheidemänner bereiteten, konnte er nicht überwinden. Er schimpfte bei jeder Gelegenheit auf den Ministersozialismus und nannte die Kommunisten eine neue Auflage der alten Verräter. Er war ein politisch Gescheiterter, er nahm keine Partei, wählte nicht, baute nach Feierabend seinen Kohl und seine Kartoffeln in seinem Schrebergarten und spielte Sonntags seinen Skat.“
Die Betriebsleitung verkündet eine große „Rationalisierungsoffensive“, die Verlängerung der Arbeitszeit, die Intensivierung der Arbeit und einen Abbau der innerbetrieblichen sozialen Versorgung: „Um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, müsse rationalisiert werden, habe die Betriebsleitung erklärt. Man habe sich aus dem Ausland den besten Schnelldrehstahl besorgt und gedenke mit einem Instrukteur die Dreherarbeiten zu schematisieren. Jeder einzelne Dreher soll künftig nur seine Spezialarbeiten anfertigen, seine Bank ganz auf dies eine Arbeitsstück einrichten und sein dazugehöriges Werkzeug erhalten. Er müsse natürlich bei dieser rationellen Arbeitsweise auch entsprechend schneller fertig werden.“
Ein zynischer Kalkulator plant „rationellere Arbeitsmethoden“: „Warum laufen die Arbeiter hier spazieren? (…) Warum bedienen nicht die Dreher und Hobler zwei von den großen Maschinen? (…) Warum murksen vier oder fünf Arbeiter immer nur einen Kran fertig? – Das ist Spielerei! – Wer kann sich das heute noch erlauben? Warum wird nicht systematisch Hand in Hand gearbeitet? – Dieser Betrieb muss ja unrentabel sein! – 300 Prozent mehr ließen sich herausholen!“ Keine „unangebrachte Humanität“ mehr! Und: „Mehrarbeit und Entlassungen“ sind angesagt.
Für viele „Fabrikkulis“ ist das eine „Kriegserklärung“. Wie reagieren? Mit passiver Resistenz oder gar mit Sabotage? Die RGO-Zelle stellt Gegenforderungen: „20 Prozent Lohnerhöhung auf den Effektivlohn und 45-Stunden-Woche“. Die Rationalisierungskampagne wird von gezielten Entlassungen begleitet, um die Arbeiter gegeneinander auszuspielen, aber auch um „unruhige Elemente“, also RGO-Aktivisten, aus dem Betrieb zu entfernen. In den bürgerlichen Medien wird die passive Lohnpolitik der Gewerkschaften als „verantwortungsvoll“ und „besonnen“ angepriesen. So lobt ein Börsenblatt der Industrie die gewerkschaftliche „Lohndisziplin“.
Die RGO-Zelle führt eine erfolgreiche Kampagne für einen neuen, um 15 Prozent erhöhten Tarif. In einer Betriebsversammlung gelingt es sogar eine Streikmehrheit zu gewinnen. Es gelingt aber den Streik durch Aussperrung nach zwei Wochen zu brechen. Die Internationale Arbeiterhilfe muss mit Nothilfen einspringen: „Fast sämtliche Streiker waren gewerkschaftlich organisiert, viele schon zehn und zwanzig Jahre, und diese Arbeiter, die jahrzehntelang regelmäßig ihren Beitrag den Gewerkschaften gezahlt hatten, bekamen nun in ihrem Wirtschaftskampf keinen Pfennig Unterstützung.“[9]
Im Jänner 1931 rührt sich erstmals wieder der seit 1924 „niedergedrückte Koloss Bergproletariat“, nachdem „das Gedinge noch einmal um einen Groschen herabgesetzt worden“ war. Über vierzig Schächte, insgesamt 80.000 Arbeiter stehen im Streik. Der sozialdemokratische Verband verweigert die Unterstützung, so dass der Arbeitskampf fast gänzlich zu einem Streik der Revolutionären Gewerkschaftsopposition (RGO) wird. Die Loyalität zur Sozialdemokratie lockert sich. Ein bisher der Sozialdemokratie ergebener Kumpel protestiert: „Im November achtzehn hoffte ich wie viele: jetzt geht es endlich aufwärts. Dann hieß es auf einmal wieder: langsam, Überlegung, Vernunft und was noch. Als sie Liebknecht und Rosa Luxemburg totschlugen, hatte ich schon das Gefühl, es trifft uns selber, aber dann wanden sich unsere lieben Genossen Noske und Scheidemann wieder geschickt heraus! Die beiden seien unvernünftig und an ihrem Ende selbst schuld gewesen. Und dann ging es immerfort. Die Demokratie, die Verfassung, die Republik müssen gestützt und geschützt werden. Wir müssen die Mehrheit der Wähler gewinnen. Wir wollen nichts mit Gewalt erreichen, der friedliche Weg ist der beste. Und keinem Unverstand und keiner Unvernunft folgen – nicht sinnlos streiken, nicht unnütze Kräfte verzetteln – und so ging es bergab, bergab, bergab.“ Der Genosse erinnert sich an die „andere Zeit“ als revolutionärer Matrose von 1918: „Er war auch mit den Kumpels im März 1920 an die Wesel gezogen und hatte ‚alles vergessen‘. ‚Vergessen, weil es unsere lieben Genossen oben so wollten.‘“ (HK 245–249)
Hans Marchwitza hat bereits 1931 in „Schlacht vor Kohle“ die Geschichte des letzten großen Ruhrbergarbeiterstreiks vor Zerschlagung der Arbeiterbewegung durch den Faschismus beschrieben.
Im November 1930 beginnen ständige Lohn- und Strafabzüge die einzelnen Partien mürbe zu machen. Es kommt zu ersten spontanen Arbeitsniederlegungen in einzelnen Rutschenfeldern. Die Ruhrkumpel bilden einen zentralen Kampfausschuss, weitere Kohlenreviere werden von der Aufstandsbewegung erfasst: „Jeder Anschlag auf den Lohn der Bergarbeiter, sei es durch Schiedsspruch oder ohne Schiedsspruch, wird mit Streik beantwortet.“ Die Bergwerksverwaltung versucht, die „gefährlichsten RGO-Nester“ durch Entlassungen, aber auch durch Betriebseinstellungen auszuräuchern. Mitte Dezember werden die Hauer bestimmter Rutschen zusammengerufen, um ihnen bekanntzumachen, „dass die Betriebsleitung gezwungen wäre, die beiden Kohlenbetriebe wegen Unrentabilität einzustellen. Da es keine Möglichkeit gäbe, die Hauer in anderen Arbeiten unterzubringen, weil alles überfüllt sei, müsse er allen kündigen.“ Es handelt sich um eine kalkulierte Drohung: „Es ist nur in dem Falle möglich, Sie länger zu beschäftigen: Wenn Sie bereit sind, die Solleistung in den Rutschen um mindestens zwanzig Wagen pro Förderschicht zu erhöhen.“ (Schlacht vor Kohle, Kapitel 28)
In den Tagen nach Weihnachten 1930 werden in den Verwaltungsbüros „fieberhaft Kündigungen für alle Kumpels“ geschrieben. Das sollte ein neues Schreckmittel sein, um sie für den Lohnabbau mürbe zu machen.
Funktionäre der RGO organisieren für die ersten Jännertage 1931 den Streikaufstand. RGO-Streikposten versuchen gegen den Widerstand der Werkpolizei die Anfahrt in die Gruben zu verhindern. Die Betriebsräte sind scharf gegen Streik: „Ein Betriebsrat war auf eine andere Bank gesprungen, warnte vor einem unüberlegten Schritt: ‚Meine Gewerkschaft kann die Verantwortung nicht übernehmen, einen wilden Streik zu billigen!‘ rief er und ermahnte die Kumpels, doch noch abzuwarten, was die Verhandlungen ergeben würden, dann wäre immer noch genug Zeit, an einen Streik zu denken.“ (Schlacht, Kapitel 31)
Von Anfang gelingt es der Bergwerksleitung Streikbrecher einzuschleusen, hinzu kommen die vielen nicht streikbereiten Kollegen: „Einer rief laut: ‚Die Gelben versauen uns ja die ganze Geschichte!‘ ‚Rausholen!‘ erhob sich Lärm. Es wurde beschlossen, Streikposten zu stehen.“ Die Zechdirektionen haben „zum Schutze der Arbeitswilligen Polizei angefordert. Die Polizei kam und trieb die Kumpels, die Streikposten standen, vom Tor fort.“ Der Werkschutz hetzt Hunde auf Streikende. Im Jänner 1931 eskalieren die Konflikte mit den Streikbrechern: „Das ist ja wie im Krieg!“ Polizeistreifen terrorisieren in den Wohnkolonien die Familien der Bergarbeiter.
Der Streik wird als eine wilde Aktion der Kommunisten denunziert, nimmt militärisch kriegerische Züge an: „Der Streik verlor seinen wirtschaftlichen Kampfcharakter, und vor den Zechen, wie überall in den Orten und Städten, sah es nach einer Mobilmachung aus. Uniformen, Wagen mit Polizei und bewaffnete Abteilungen von Zivilisten, die vom [sozialdemokratischen] Reichsbanner den Streikbrechern zum Schutz bereitgestellt waren. An den Zechentoren schwerbewaffnete Wächter mit Maschinengewehren. Alle Belegschaftsversammlungen unter Kontrolle der Polizei. Verhaftungen von streikenden Kumpels, die Flugblätter verteilen wollten, und jeden Tag Sprengung von Demonstrationen. Tag und Nacht Krieg in den Straßen und Kolonien, mit Schusswaffen, Knüppeln, Steine und Hackenstielen.“
Die Unterstützungsfonds leeren sich. Schwarze Listen kursieren: „Das Elend, die Angst zerbrechen unsern Kampf.“ Auch wenn ein sechsprozentiger Lohnabzug droht, bröckelt die Streiksolidarität nach knapp einer Woche ab: „Der Schiedsspruch, die fristlosen Entlassungen, die den Kumpels in die Häuser geschickt wurden, der mörderische Kleinkrieg, der sich Tag um Tag überall abspielte, zermürbte die Kräfte einzelner Belegschaften.“
Die Polizei erschießt im Jänner 1931 drei streikende Arbeiter, verhaftet über 200 Streikende, zumeist RGO-Angehörende. Das Parteihaus der KPD wird besetzt. Über Recklinghausen wird der kleine Belagerungszustand verhängt. Per Notverordnung wird ein Lohnabbau von sechs Prozent verkündet: „In den ersten Januartagen [1931] war von den Streikenden in Duisburg ein neuer [Roter] Einheitsverband der Bergarbeiter gegründet worden. Mehrere Tausend der aus dem Verband Ausgeschlossenen und der RGO waren zu der Feier erschienen, und die mutigen Reden erweckten bei vielen der anwesenden Kumpels neue Hoffnungen (…).“ (Schlacht, Kapitel 34)[10]
Kumiaks Kampf gegen den NS-Faschismus ab 1930
Bei der Reichstagswahl konnten im September 1930 die Nazifaschisten wenigstens von den Arbeitersiedlungen ferngehalten werden: „Ja, unter die Dreizehnhundert der Bergarbeiterkolonie hatten sich nur fünf Stimmen für die Braunen verirrt, aber unter den Kleinbürgern schienen sie gewuchert zu haben.“ (HK 238)
Vater Kumiak hatte seinen gleichnamigen Sohn Peter Ende der zwanziger Jahre als Knecht zur Arbeit ans Land geschickt. Der junge Kumiak, der einige Zeit bei einem nazistischen Großbauern arbeitet, findet zur politischen Linie seines Vaters. Der herrische Bauer schmeißt Peter raus, der findet Unterkunft beim „roten Schoht“, der gegen die Nazis agitiert. Der rote Landagitator Schoht, ein Kleinbauer, wird von den braunen Schlägertruppen terrorisiert. Peter „nahm sogar eines Abends mit Schoht an einem gefährlichen Gang teil, als sie, nur zu zweit, Plakate der Kommunistischen Partei an verschiedenen Mauern anbrachten.“ (HK 304–310)
Adam Scharrer hat der roten Landbewegung mit seinem 1934 im Prager Exil erschienenen ersten revolutionären Bauernroman „Maulwürfe“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Scharrer zeichnet die Klassenspaltung, den Kampf der Taglöhner, Landarbeiter, Kleinbauern gegen Großgrundbesitz und Großbauern am Dorf am Beispiel der Figur des Georg Brendl, der sich von den (nazistischen) Dorfhonoratioren nicht korrumpieren lässt, der 1933 in ein KZ eingeliefert werden wird. Brendl organisiert in Kontakt zu sozialistischen Industriearbeitern stehend im Fränkischen eine linke Kleinbauerngruppe. Scharrer widerspricht einem reaktionär romantischen Bauernbild, das in der faschistischen Blut- und Bodenideologie übersteigert werden sollte.[11]
In Kumiaks Siedlung nimmt Jupp Kudiatzeck den Kampf gegen die nazistische Demagogie auf: „Elend und bittere Not bringt Hitler über das Volk, denn seine rasende Eile ist die Vorbereitung zum Krieg. Die Leute, die ihn stützen, sind unsere Feinde: die Krupps und die Bankiers.“ (HK 355)
In der Hamburger „Rosenhofstraße“ entwickeln sich ab 1930 angesichts der ständigen NS-Provokationen, der SA-Überfälle, des täglichen „schleichenden Bürgerkriegs“ trotz aller antikommunistischen Aversionen der Sozialdemokratie und der kommunistischen Sozialfaschismuslosung rege Arbeitereinheitsfrontaktivitäten „von unten“ in einem „antifaschistischen“ Arbeiterkampfbund: „Die Zusammenkunft war von den Reichsbannerarbeitern, obwohl die Gauführung das ihren Mitgliedern streng verboten hatte, angeregt worden. Der angedrohte Rachezug der Nazis, die sich anhäufenden Überfälle auf Arbeiter jeder Parteirichtung, hatten die proletarischen Elemente im Reichsbanner zu der Erkenntnis gebracht, dass sie nur mit den übrigen revolutionären Arbeitern gemeinsam, Schulter an Schulter, die faschistischen Mordbuben zurückschlagen könnten.“ (Rosenhofstraße, Kapitel 6)
Jan Petersen beschreibt in „Unsere Straße“ den antifaschistischen Widerstand einer illegalen KP-Zelle in einem roten Viertel von Berlin-Charlottenburg. Unter konspirativen Bedingungen entstanden konnte Petersens Manuskript 1934 nach Prag geschmuggelt werden. Um der Gestapo keine Informationen zu liefern erschien der Roman 1936 anonym in Moskau. Die meisten Romanfiguren wurden verfremdet. Nur einige vom NS-Regime bereits ermordete Genossen – wie der im Juli 1934 in Berlin-Plötzensee hingerichtete Richard Hüttig – treten unter ihrem Klarnamen auf. In Deutschland konnte der Roman erst nach der Befreiung 1947 veröffentlicht werden.
Die Genossen der Charlottenburger Wallstraße versuchen in den ersten Februartagen 1933 den Widerstand in den Betrieben Richtung Generalstreik zu mobilisieren, schwierig, da die Sozialdemokratie passiv abwartend auf das Funktionieren „der Verfassung“ setzt und jede Einheitsfrontaktion im Sinn einer „Stillhaltetaktik“ ablehnt.
Die Berliner Genossen reagieren im März 1933 schockiert auf die Verhaftung von Ernst Thälmann, der am 7. Februar in seiner „Ziegenhals-Rede“ zum Kampf gegen den Hitler-Faschismus aufgerufen hatte. Nach dem Reichstagsbrand reißen viele Parteiverbindungen ab: „In den ersten Wochen nach dem Reichstagsbrand hatten wir keine Verbindung mit zentralen Parteistellen. Der ganze Apparat schien auseinandergefallen zu sein. Dazu kam die gerade auf unsere Gegend konzentrierte Terror- und Verhaftungswelle. Wir konnten keine Zeitung herausbringen, nur das Flugblatt zum Reichstagsbrand. (…) Vor acht Tagen ist nun in unserem Bezirk eine Stadtteilleitung gebildet worden. Zum ersten Mal bekamen wir gedruckte Zeitungen, die ‚Rote Fahne‘ geliefert.“ Die Druckerei kann in Kellerräumen und in verwinkelten Schrebergärten dem Zugriff der Gestapo entzogen werden, so auch ein „Greif-Abziehapparat“ zur Vervielfältigung der „Roten Fahne“: „‚Es muss ruck-zuck gehen. Anlegen, rüberziehn, anlegen, rüberziehn.‘ Wir prüfen den Abzug. DIE ROTE FAHNE steht groß auf der Seite. ‚Bisschen fett, schmiert.‘, sage ich.“
Zum 1. Mai 1933 schmuggeln Genossen Klebezettel in die Betriebe: „Kommunistische Parolen klebten an den Siemensmaschinen, in den Garderoben. Acht Arbeiter wurden daraufhin verhaftet. Ihre Namen standen auf einer alten Sammelliste, die den Nazis irgendwie früher in die Hände gefallen war. Es war aber kein Genosse der Betriebszelle unter den Verhafteten.“ (Unsere Straße, Teil 6)
Erste Kontakte zur sozialdemokratischen Arbeiterjugend verlaufen im Sand. Die Sozialdemokraten werfen den Jungkommunisten vor, sie würden leichtsinnig ihre Kader verbrauchen und auffliegen lassen. diese kontern: „Glaubt ihr denn, dass der Faschismus von selbst stürzt? Wollt ihr nur immer zusammenkommen, um euch zu bestätigen, dass ihr noch die alten seid?“ Ein junger Sozialdemokrat gesteht zu, dass der Faschismus viele sozialdemokratische Dogmen über den Haufen geworfen hat: „Wir wollten den Staat friedlich erobern – die Illusionen haben sie uns ausgetrieben.“ Erst über das mitgebrachte „Braunbuch“ ergibt sich eine Zusammenarbeit: „Das richtige Braunbuch -? Das im Prozess?“ Ja, jenes in Paris entstandene „Braunbuch“ über die Lage im nazistischen Deutschland, über den Hitlerterror, dessen Besitz allein einem fünfzehn Jahre Zuchthaus eintragen konnte. (Unsere Straße, Teil 10)
Wie die Kumiaks setzen auch die Genossen der Charlottenburger Wallstraße große Hoffnungen in das Auftreten von Georgi Dimitroff im Reichstagsbrandprozess Ende 1933: „Dimitroff freigesprochen! – So ein Weihnachten! – Eine größere Freude hätte uns niemand mitgeben können.“
Ein Kampfgefährte von Jan Petersen – im Roman anonym auftretend – berichtet nach seiner Haftentlassung von der Misshandlung Erich Mühsams: „Er war Erich Mühsams Nachbar auf dem Strohsacklager im KZ Brandenburg“. Wochen später wird Mühsam im Jänner 1934 in das KZ Oranienburg überstellt, wo ihn SS-Männer im Juli 1934 ermorden: „Erich Mühsam. Der alte Genosse. Er ist ein körperliches Wrack. Nur sein eiserner Wille hält ihn aufrecht, dachte er. Darin ist er hier auch noch dem Jüngsten überlegen. Einige Konzentrationslager hat er schon hinter sich. Ist überall der Jude, der verhasste ‚jüdische Hetzjournalist‘, der täglich neue Torturen ausstehen musste. Preuß kannte ihn schon viele Jahre. Er war in mancher Versammlung gewesen, in der Mühsam, der Anarchist, ihre politische Auffassung angriff. Das lag lange, lange hinter ihnen. Hier waren sie treue Kameraden geworden. Genossen in gemeinsamer Not, gemeinsamen Leid. Starr war Mühsam auch hier in seinem Widerstand geblieben. Er wollte das Wort Taktik, soweit es hier überhaupt anwendbar war, nicht hören.“
Die Charlottenburger Genossen bewundern den Widerstand der österreichischen Arbeiter gegen den Heimwehrfaschismus, den Kampf um den Karl-Marx-Hof im Februar 1934. Kurz flackert Hoffnung auf: „‚Die Proleten ham losjeschlag’n, und wir sitzen hier und könn‘ nischt mach’n. Verrückt könnt‘ man wer’n!‘ (…) Besser eine militärische Niederlage, als die Faschisten ohne Widerstand die Macht an sich reißen zu lassen.“ Sie wissen um die Gründe für die Niederlage, eine Folge jahrelangen sozialdemokratischen Zauderns: „Man kann den Arbeitern nicht immer nur sagen: die Gewehre sind für den äußersten Notfall da – wenn die Faschisten die Demokratie antasten! Die ganzen Jahre haben sie eine Errungenschaft nach der andren abgebaut. Jetzt haben die Arbeiter spontan zu den Waffen gegriffen. Weil sie sich klar waren, dass die Entscheidung kommen musste.“ (Unsere Straße, Teil 14)
An der Ruhr sieht Kumiak die Falle der herrschenden Klassen: „Die Not schlägt einander tot, und die Schuldigen, die Herren Krupp und Flick, loben: So ist es richtig, erwürgt einander, dann brauchen wir es nicht zu tun.“ (HK 357)
Selbst biedere Sozialdemokraten werden von den SA-Schergen als „Bolschewisten“, „rote Hunde“, und „Judenknechte“ malträtiert, sodass einige an ein gemeinsames Handeln der gespaltenen Arbeiterparteien denken, auch wenn sie dies gleich wieder verdrängen und naiv an der „Verfassung“, an „der Demokratie“ festhalten. Sogar auf die Reichswehr setzen manche Hoffnungen. Diese werde die verfassungsmäßigen Institutionen schon schützen.
Die KP-Genossen machen mobil, nachdem die SA ein sozialdemokratisches Reichsbanner-Lokal verwüstet hat. Alte Genossen ahnen im Herbst 1932 den bevorstehenden „Golgathaweg“. Jupp Kudiatzeck ahnt zu Weihnachten 1932: „Die Herren Aktionäre haben Hitler mit Millionen beschenkt, damit er unser Ende beschleunigen soll.“
Nach der „NS-Machtergreifung“ Ende Jänner 1933 hoffen die roten Ruhrarbeiter auf Ernst Thälmann, umso größer das Entsetzen nach dessen Verhaftung: „Kumiak sah sich in der Kolonie um; hier hing noch keine der schrecklichen Fahnen, ihre Kolonie war noch eine Festung.“ HK 367
Die Illegalität wird vorbereitet: „Kumiak hatte mit Lewandowski und Kulik alle belastenden Sachen beiseite geschafft, und sie saßen in diesen Tagen häufiger beisammen, um noch alle notwendigen Schritte für die illegale Arbeit der Partei zu besprechen.“
Die SA stürmt das Parteilokal in der Werkkolonie, zahlreiche Genossen werden verhaftet: „Lewandowski schwieg. Seit fast vierzig Jahren hatte er bei allen Kämpfen der Arbeiterklasse fest und mutig dagestanden, nun kam ihr letzter Kampf.“ (HK 366–377)
Kumiak, Lewandowski, Kudiatzeck, ein Anwalt der Roten Hilfe werden verhaftet, gefoltert. Peter Kumiak wurde in einen Keller gestoßen, „wo schon viel andere Verhaftete an den Wänden herumsaßen oder zusammengekrümmt und stöhnend lagen.“ Die SA sucht nach Parteiunterlagen, vor allem nach einem versteckten Vervielfältigungsapparat: „‚Wo steckt der Apparat? frag ich‘, schrie der Kerl.“ (HK 380–385)
Abgerissene Kontakte werden mühevoll erneuert: „In den Kolonien erschienen wieder Flugblätter der illegalen Kommunistischen Partei. Nicht verzagen! Zusammenhalten!“ Jupp Kudiatzeck wird von SA-Schergen totgeschlagen: „Die SA suchte diesen Apparat und die Hersteller der wieder auftauchenden Flugzettel. (…) Der Abziehapparat wurde in einer Nacht an eine andere Stelle geschafft.“ (HK 396–399)
Die Rote Hilfe sammelte für die hungernden Familien der Verhafteten. Erprobte Genossinnen organisieren konspirative Verbindungen. Neuer Hoffnungspunkt Georgi Dimitroff: Im Frühjahr 1934 tauchen in den Zechen, Schächten wieder illegale Parolen mit Kreide an die Wände geschrieben auf: „Kameraden, unser Dimitroff hat gegen die Hitlermeute gesiegt! Die Revolution lebt!“ (HK 437)
Die lokale KP-Gruppe hatte durch freigelassene Kumpel erfahren, dass die im Frühjahr 1933 verhafteten Genossen in das Konzentrationslager Bürgermoor deportiert waren. Ältere Genossen können dem Terror der Arbeit, dem Torfstechen und dem Strafexerzieren nicht mehr standhalten: „Es waren meistens ältere Häftlinge, frühere sozialdemokratische Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre und Beamte; auch der [Rote Hilfe Anwalt] Sally Levy war fast jedesmal dabei, ein schwerfälliger, durch seine Kurzsichtigkeit behinderter, aber merkwürdig zäher Mensch mit großem Eigen- und Lebenswillen. Während eines solchen Nachexzerzierens war gestern der alte Lewandowski umgefallen und einige der Häftlinge haben ihn heute früh in einem der immer bereitstehenden unansehnlichen Särge nach dem KZ-Friedhof getragen.“ Mit Lewandowski verlieren die Häftlinge die stützende Leitfigur, der Kampf für die KP-Sache geht weiter!
Der alte Kumiak schuftet im Moor, „stach den Spaten in die Moorerde“, vegetiert, resigniert, bleibt aber in Erinnerung an Lewandowski kämpferisch: „Es werden immer wieder Zerbrochene und Zertretene liegenbleiben, und immer werden die rohgezimmerten, unansehnlichen Särge nach dem KZ-Friedhof getragen, und immer mehr Kreuztäfelchen werden darauf stehen, aber auch noch auf diesem Totenfelde werden die Henker den gefürchteten Hauch der Partei spüren, und sie werden ihr nie gewachsen sein, die Wut der Mörder wird an unserer Beharrlichkeit ermüden und zerbrechen müssen … Die Partei wird leben bleiben … die Partei … Partei … Alle Schachanowskis und alle Hindemanns werden weichen müssen, alle diese Hitler und alle, alle Schinder. Unsere Kinder werden ein anderes Leben beginnen.“ (HK 448–451)
[1] Hans Marchwitza: Die Heimkehr der Kumiaks, Verlag Tribüne, Berlin 1952. (kurz: HK)
[2] Über den „Ruhr-Maistreik“ 1924 vgl. Michael Kittner: Arbeitskampf. Geschichte, Recht, Gegenwart, München 2005, 477–480.
[3] Über „Ruhreisenstreit“ 1928 vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 4. Von 1924 bis Januar 1933, Berlin 1966, 155–159 und Michael Schneider: Höhen, Krisen und Tiefen. Die Gewerkschaften in der Weimarer Republik 1918 bis 1933, in: Geschichte der deutschen Gewerkschaften. Von den Anfängen bis 1945, hrg. von Ulrich Borsdorf, Klaus Tenfelde u.a., Köln 1987, 279–446, hier 384–387.
[4] Über Neukrantz‘ Barrikaden-Roman Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands I. Roman, Frankfurt 1983, 161f.: „Die Brutalität, mit der die Beauftragten des Bürgertums das proletarische Recht auf den Demonstrationszug des Ersten Mai zusammenschlugen, nahm mir beim Lesen den Atem.“ Neukrantz hier nach der online-Ausgabe auf nemesis.marxists.org zitiert.
[5] Vgl. Walter Benjamin: Eine Chronik der deutschen Arbeitslosen. Zu Anna Seghers Roman ‚Die Rettung’ (1938), in derselbe: Gesammelte Schriften III, Frankfurt 1972, 531–537.
[6] Entwurf zu einem Programm des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller [1931], in: Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur I. Eine Auswahl von Dokumenten, hrg. von Alfred Klein und Thomas Rietzschel, Berlin-Weimar 1979, 424–439, hier 428.
[7] Zitiert nach Jürgen Kuczynski: Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Studien 5. 1918–1945, 232 und 257. Zur „Arbeiterkorrespondentenbewegung“ vgl. Lexikon sozialistischer deutscher Literatur, Leipzig 1964, 59–64.
[8] Zur Entwicklung der Revolutionären Gewerkschaftsopposition vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 4. Von 1924 bis Januar 1933, Berlin 1966, 159f.
[9] Willi Bredel: Maschinenfabrik N & K. Ein Roman aus dem proletarischen Alltag, Berlin 1971 (Nachdruck Oberbaum-Verlag „Reihe Proletarisch-revolutionäre Romane“), 22–26, 57f., 90, 95, 118, 128.
[10] Über den Ruhrstreik vom Jänner 1931 vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 4. Von 1924 bis Januar 1933, Berlin 1966, 270f.
[11] Vgl. Franz Leschnitzer: Adam Scharrers „Maulwürfe“ (1934), in Alfred Klein: Im Auftrag der Klasse. Weg und Leistung der deutschen Arbeiterschriftsteller 1918–1933, Berlin-Weimar 1972, 690–692.