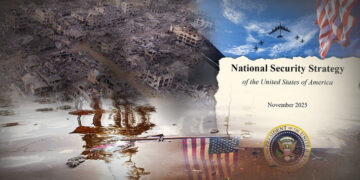Mainz. Was als Maßnahme gegen Rechtsextreme angekündigt wurde, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als gefährlicher Rückschritt in autoritäre Zeiten: In Rheinland-Pfalz sollen Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst künftig schriftlich erklären, in den letzten fünf Jahren keiner „extremistischen“ Organisation angehört zu haben. Andere Bundesländer wollen nachziehen – eine Entwicklung, die viele an den berüchtigten Radikalenerlass von 1972 erinnert.
Damals wie heute lautet die Devise: Nur wer „loyal zur Verfassung“ steht, darf dem Staat dienen. Klingt harmlos, gar vernünftig. Doch wen und was schützt die Verfassung eigentlich und wer entscheidet, was Verfassungstreue ist? Die Verfassung Das sichert das individuelle Eigentum als Grundrecht ab, so wird wer etwas gegen die ungleiche Verteilung hat schnell einmal zum Verfassungsfeind und ‑feindin. Die Verfassung und seine Schützerinnen und Schützer – Inlandsgeheimdienst – schützen die herrschenden Verhältnisse, in all ihrer Ungerechtigkeit. Das die Inlandsgeheimdienste auf dem Rechten Auge blind sind ist hier nur eine Randnotiz, wenngleich klar ist wer bei diesem neuen Gesetz eigentlich nicht in den Blick gerät, wer fällt durchs Raster? Damit wird klar als ungeeignet für den Staatsdienst werden vor allem Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Linke, Antifaschistinnen und Antifaschisten und an aller erster Stelle Kommunistinnen und Kommunisten. Staatsdienst umfasst viel, von Schulen über KiTa, Universitäten und öffentliche Verwaltung und anderes Mehr.
Obwohl die aktuelle Debatte sich offiziell gegen die AfD richtet, fällt auf: Die Listen umfassen Linke und kommunistische Gruppen und Strukturen u.a. die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), die Rote Hilfe, Marx21, die Interventionistische Linke oder das Bündnis „Ums Ganze!“, auch Mitglieder von Jugendorganisationen wie die Sozialistisch Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) sollen vom Staatsdienst ausgeschlossen werden. Eine angebliche Verteidigung der Demokratie wird hier zur Disziplinierung kritischer und antikapitalistischer Kräfte genutzt und klar ist diese Ideen will man nicht in der Bildung.
Der Bundesarbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote spricht von einer Wiederauflage des Radikalenerlasses – mit dem Unterschied, dass dieser heute entgegen internationalem Recht erneut salonfähig gemacht werden soll. Schon in denr1970er Jahren trafen 95 Prozent der Berufsverbote Linke – Briefträger-und ‑trägerinnen, Lehrer und Leherinnen, Verwaltungsangestellte, die sich in Gewerkschaften, linken und kommunistischen Parteien oder Friedensbewegungen engagierten. Betroffene berichten bis heute von Einschüchterung, finanzieller Existenzbedrohung und einer Atmosphäre des Misstrauens.
Zwar beteuert die rheinland-pfälzische Landesregierung, es gehe nicht um pauschale Zugangssperren, sondern um Einzelfallprüfungen. Doch die Richtung ist klar: Gesinnungschecks, Regelabfragen beim Verfassungsschutz, Fragebögen zu politischen Aktivitäten – in mehreren Bundesländern sind diese Maßnahmen schon Realität oder in Planung. Bayern macht es seit Jahren vor. Brandenburg hat 2024 den Verfassungstreuecheck eingeführt. Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Hessen wollen nachziehen.
Dabei ist die bloße Mitgliedschaft in einer Organisation – selbst wenn sie als „extremistisch“ eingestuft wird – bislang kein legitimer Grund für ein Berufsverbot. Das bestätigen nicht nur deutsche Gerichte, sondern auch internationale Gremien wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Die derzeitigen Entwicklungen stellen also nicht nur eine politische, sondern auch eine rechtliche Bankrotterklärung dar, wobei einen beides im Kapitalismus in dieser Phase der Fäulnis und Dysfunktionalität nicht wundern braucht. Die AfD lacht sich ins Fäustchen, während linke Strukturen zermürbt werden. Wer sich gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck stellt, gerät zunehmend selbst ins Visier des Staatsapparats.
Quelle: junge Welt/junge Welt