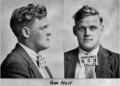Schlangen gelten seit jeher als unheimlich, ja sogar bedrohlich. Schon ihre lautlose Fortbewegung löst bei vielen Menschen Angst aus. Doch Biologinnen und Biologen mahnen, diese Furcht sei unbegründet – und schade am Ende vor allem den Tieren.
Die kulturelle Bedeutung der Schlange ist widersprüchlich. Seit der Steinzeit erscheint sie in Felszeichnungen, im antiken Griechenland schmückte sie den Stab des Heilgottes Asklepios, der bis heute Symbol der Medizin ist. Im Volksglauben gilt die Äskulapnatter als Glücksbringer, während die Bibel sie als listige Verführerin beschreibt. In China wiederum steht sie als Tierkreiszeichen für Weisheit, Scharfsinn und Eleganz.
Die Angst vor Schlangen hat oft weniger mit realer Gefahr als mit der Wahrnehmung zu tun. Studien zeigen: Ihre wellenförmigen oder raupenartigen Bewegungen wirken fremd und verstörend. Dabei sind die meisten heimischen Schlangenarten weder giftig noch aggressiv. Sie fliehen in aller Regel, bevor der Mensch sie überhaupt bemerkt.
Die Vielfalt der heimischen Arten
In Österreich leben sieben Schlangenarten, die vom Ufer der Donau bis in alpine Höhen vorkommen. Nur zwei davon – die Kreuzotter und die äußerst seltene Hornotter – sind giftig. Beide setzen ihr Gift jedoch fast ausschließlich zur Verteidigung ein.
Besonders eindrucksvoll ist die Äskulapnatter, die größte heimische Art. Männchen können bis zu 1,8 Meter lang werden. „Man muss keine Angst haben. Es soll aber auch nicht jeder hingehen, um die Schlangen anzugreifen“, betont Eva Bernhart von der steirischen Berg- und Naturwacht. Ihr olivgrüner Rücken glänzt im Sonnenlicht oft so dunkel, dass sie für eine „schwarze Schlange“ gehalten wird – ein Grund für zahlreiche Fehlalarme.
Die Schlingnatter, unsere häufigste Art, wird ihrerseits häufig mit der giftigen Kreuzotter verwechselt. Doch während die Kreuzotter vor allem in Feuchtgebieten über 700 Meter Seehöhe zu finden ist, lebt die Schlingnatter auch in Gärten, Hecken oder Waldrändern.
Nützliche Helfer im Garten
Schlangen sind für Gärtnerinnen und Landwirte wertvolle Verbündete. „Sie fressen gerne Wühlmäuse. Also alle Gartenbesitzer würden sich freuen, wenn sie so einen Mitbewohner haben“, erklärt Naturschutzbund-Präsident Johannes Gepp. Auch Amphibien, Insekten oder Nacktschnecken stehen auf dem Speiseplan, manche Arten jagen sogar kleine Fische.
Damit halten sie die Populationen vieler Kleintiere im Gleichgewicht – ein ökologisches Netz, das für gesunde Lebensräume unverzichtbar ist.
Obwohl Schlangen in vielen Landschaften Österreichs vorkommen, sind alle Arten gesetzlich geschützt – einige gelten als stark gefährdet. Die Wiesenotter, Europas kleinste Giftschlange, wurde hierzulande seit den 1970er-Jahren nicht mehr gesichtet und gilt als verschollen. Die Hornotter ist heute nur noch in wenigen südlichen Bergregionen zu finden. Hauptgefahr: Verlust und Zerstörung ihrer Lebensräume durch Straßenbau, intensive Landwirtschaft oder Bebauung.
Nachwuchs im Spätsommer
Im Spätsommer und Herbst bringen heimische Schlangen Nachwuchs zur Welt – auf ganz unterschiedliche Weise. Die Ringelnatter, die Würfelnatter und die Äskulapnatter legen Eier, meist an warmen, feuchten Orten wie Kompost- oder Sägespänehaufen. Bis zu zwei Monate dauert es, bis die Jungtiere schlüpfen.
Andere Arten wie Kreuzotter oder Hornotter sind eilebendgebärend: Die Eier bleiben im Körper der Mutter, das Junge schlüpft bei der Geburt direkt aus der dünnen Eihülle. „Das hat den Vorteil, dass die Mutter das Ei durch ihre Körpertemperatur schützen kann“, erklärt die Reptilienexpertin Helga Happ vom Reptilienzoo Happ in Klagenfurt.
Doch die Überlebenschancen sind gering. Von 30 jungen Ringelnattern überleben oft nur wenige – Feinde sind Fische, Vögel, Marder oder auch Hauskatzen. Die Zahl der Eier oder Jungtiere ist daher eine Art Überlebensstrategie: Während Ringelnattern bis zu 30 Eier legen, bringt eine Äskulapnatter sechs bis zwölf vergleichsweise große Jungtiere zur Welt.
Besonders faszinierend: Heimische Giftschlangen können die Geburt verzögern. Ist der Sommer zu kalt oder verregnet, überwintern die Jungtiere im Körper der Mutter und werden erst im warmen Frühling geboren.
Schlangen sind nützlich
Um mehr über Verbreitung und Vorkommen von Schlangen zu erfahren, setzen Forschende auch auf Mithilfe der Bevölkerung. Sichtungen können auf der Plattform herpetofauna.at mit Foto gemeldet werden. Die Daten fließen in die wissenschaftliche Datenbank des Naturhistorischen Museums Wien ein.
Zoos wie der Reptilienzoo Happ unterstützen den Schutz heimischer Schlangen durch Nachzuchtprogramme. Jungtiere werden in freier Natur ausgewildert, um Bestände zu stabilisieren. „Wir haben einen sehr genauen Überblick, wo in Kärnten welche Schlangenart vorkommt. Mit den Nachzuchten können wir abgewanderte Bestände ersetzen“, erklärt Helga Happ.
Schlangen sind weit mehr als unheimliche Kriechtiere. Sie sind stille Helfer, faszinierende Jäger und kulturell tief verwurzelte Symbole. Wer im Garten oder auf einer Wanderung eine Schlange entdeckt, sollte sich glücklich schätzen: Es ist ein Zeichen dafür, dass das Ökosystem intakt ist – und ein seltenes Naturerlebnis obendrein.