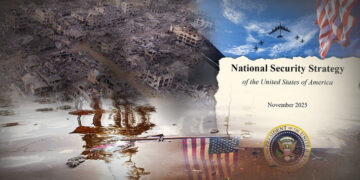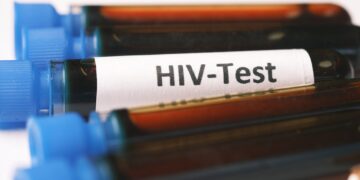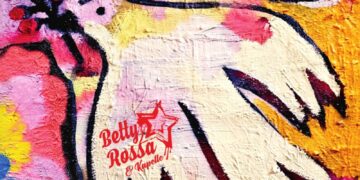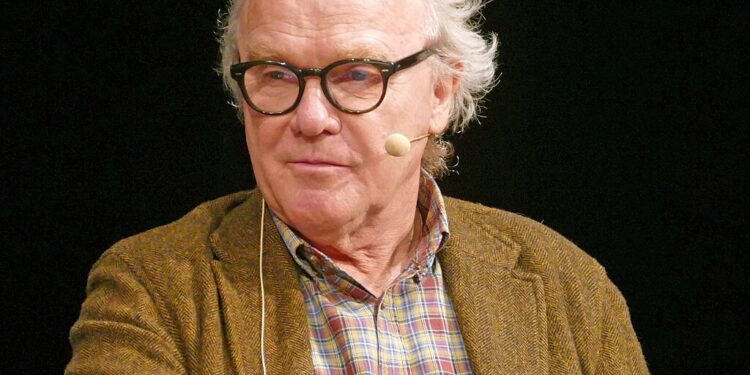Gastbeitrag von Gerhard Oberkofler, geb. 1941, Dr. phil., Universitätsprofessor i. R. für Geschichte an der Universität Innsbruck.
Einführung
Der humanistisch denkende Noam Chomsky (*1928) lebt in den USA und hat sich mit dem von der Herrschaft des Kapitals bezeichneten demokratischen Gesellschaftssystem immer wieder wissenschaftlich auseinandergesetzt. Zwei Arten von Intellektuellen des 19. und 20. Jahrhundert sind Chomsky begegnet. Der Marxismus-Leninismus könne auf eine Art von Intellektuellen deshalb eine große Anziehungskraft haben, weil diese wissenschaftliche Weltanschauung auf eine Gesellschaft orientiert, die mit der Freiheit aller die Freiheit jedes einzelnen garantiert. Chomsky stellt in diesem Kontext aber fest, „dass es für Intellektuelle ein Leichtes ist, die Seite zu wechseln. Das ist das >Phänomen des gescheiterten Gottes<. Man erkennt, dass es keine Volksrevolution geben wird: Man wird es nicht zur Avantgarde bringen, die die Massen in die Zukunft peitscht – also vollzieht man diesen Wandel und wird zum Diener des >Staatskapitalismus<“.[1]
Seit vielen Jahren ist der in Vorarlberg geborene und dort aufgewachsene Michael Köhlmeier (*1949)[2] als ein in Permanenz publizierender Literat im deutschen Sprachraum bekannt. Die in seiner Heimat von Geld und Privateigentum ausgebildete Grundmentalität wird zu Wendezeiten abrufbar. Diese hat Emil Fuchs (1874–1971), ein Zeuge christlicher Nächstenliebe, im Montafon in den Maitagen 1945 in Begleitung seines Enkels Klaus Fuchs-Kittowski (*1934) so erlebt: „Wieder einmal ging ich in diesen Tagen nach St. Gallenkirch ins Dorf, um Einkäufe zu machen. Da sah ich vor der Kirche festlich gekleidete Männer und weißgekleidete Jungfrauen mit Blumensträußen versammelt. Sie erwarteten den Einmarsch der französischen Truppen; und siehe, da kamen sie heran. Rasch ging ich meinen Weg nach Gortipohl hinaus. Das wollte ich nun gerade nicht miterleben, wie man hier feierte. – Droben aber hingen schon an den Häusern der großen Bauern die österreichischen Fahnen vom Dach bis auf die Straße – wie kurz vorher die Hakenkreuzfahnen. Der alte, ehrwürdige Pfarrer des Ortes sagte mir in diesen Tagen: >Als ich sie einst warnte, Hitler zu wählen, wollten sie mich fast totschlagen. Nun sind sie wieder begeistert! Was soll man zu diesen Leuten sagen?< – Als ich mit Klaus am anderen Morgen von unserm Berg herunterging und er die Fahnen sah, blickte er mich an und sagte: >Gelt, Opa, so etwas machen wir nicht?< – >Nein<, sagte ich. >Wir sind immer auf demselben Weg!< Nicht ich, aber er hatte unter den neuen Verhältnissen zu leiden. Die Mitschüler quälten ihn bei jeder Gelegenheit als einen >Deutschen<. Das hatte schon vorher begonnen.“[3] Nach Kriegsende hat Emil Fuchs am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik, von der nie ein Krieg ausgegangen ist, mitgewirkt.[4]
Nach seiner Matura am Bundesgymnasium in Feldkirch (1970) konnte Köhlmeier sein Studium in die Bundesrepublik Deutschland beginnen. Er lernte die schon ausklingende studentische Rebellion näher kennen. Ulrike Meinhof (1934–1976) und andere engagierte bundesdeutsche Linke haben sich in diesen Jahren vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Israels gegen Ägypten, Jordanien und Syrien und der Vertreibung des palästinensischen Volkes aus ihrer Heimat (5. Juni bis 10. Juni 1967) offen distanziert.[5] Der in London sesshaft gewordene jüdische Poet Erich Fried (1921–1988)[6] hat als Gegner des Zionismus gedichtet („Höre, Israel! Gedichte und Fußnoten“):[7]
„Ihr habt in Europa
die Hölle der Höllen erlitten
Verfolgung Vertreibung
Langsamer Hungertod
die Gewalt der Mörder
die Hilflosigkeit eurer Schwäche
die Urform des Unrechts
das nichts als die eigene Macht kennt
Ihr habt eure Henker
Beobachtet und von ihnen
den Blitzkrieg gelernt
und die wirksamen Grausamkeiten
Was ihr gelernt habt
das wollt ihr jetzt weitergeben
Kinder der Zeit des Unrechts
erzogen in seinem Bild“
Mit dem westdeutschen Fahnenträger der studentischen Rebellen Rudi Dutschke (1940–1979)[8], den Köhlmeier bei ihm passenden Gelegenheiten als Referenz nennt, ist Erich Fried bis zu dessen Ableben in Kontakt geblieben. Fried hat Dutschke wenige Wochen vor den Mordanschlag auf diesen (16. April 1968) bei einem internationalen Vietnamkongress in Westberlin (17. Und 18. Februar 1968) kennengelernt. „Antikommunismus darf nie sein“ – ist eine der Kernaussagen eines Briefes von Fried an Dutschke.[9]
Wie hat Köhlmeier seine Aufbruchjahre als Student in Westdeutschland reflektiert? Sein neues Buch „Dornhelm. Roman einer Biografie“ dokumentiert die Verantwortung von Intellektuellen für unserer barbarischen Gegenwart.[10] Die dort abgedruckten „Gespräche“ zwischen den beiden langjährigen und in ihrer Haltung sich nicht unterscheidenden Freunden Michael Köhlmeier und Robert Dornhelm (*1947)[11] dokumentieren, wie beide sich den Applaus des herrschenden Systems samt das dazu gehörende Honorar verdienen.
Robert Dornhelm ist in Timișoara (Temeswar) im westlichen Rumänien als Kind einer bis zum Sturz der mit dem deutschen Faschismus verbündeten rumänischen Diktatur reichen jüdischen Familie aufgewachsen. Die vielen Probleme der sich entwickelnden neuen volksdemokratischen Ordnung war dieser jüdischen Familie Dornhelm zutiefst zuwider, weshalb sie 1961 nach Wien übersiedelte, zumal sie aus ihrem Ansitz ausquartiert worden ist.
Zwei auserwählte Intellektuelle schauen auf Zigeunerbuben
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres (*1949) hat in seinem Grußwort zudem vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma am 2. August 2024 abgehaltenen und vom katholischen Osteuropa-Hilfswerk mitgetragenen Gedenktag an die Ermordung von 4.300 Roma durch die Nationalsozialisten in Auschwitz am 2. August 1944 verurteilt, dass Sinti und Roma in Europa immer noch dem tradierten Antiziganismus ausgesetzt sind.[12] Papst Franziskus (1936–2025) hat 2010 im rumänischen Blaj die dort lebenden Roma kennengelernt und spürte „tief im Herzen die Bürde der Diskriminierung, der Spaltung und der Misshandlungen, die man diesen Menschen auferlegt hatte“.[13]
Dornhelm zementiert dagegen bei Gelegenheit seiner Köhlmeier-Biografie rassistische Vorurteile gegenüber der insbesondere in Rumänien lebenden Roma-Bevölkerung. „Die Roma-Buben, dachte ich,“ so Dornhelm, „die haben es gut. Ich habe dir [d. i. Köhlmeier] ja schon erzählt, es hieß, die haben alle sehr lange, sehr dünne Penisse, es wird schon als Säugling daran gezogen, damit sie lang und dünn werden, hat man erzählt. Sie können einen Knoten hinein machen und so die Pisse aufhalten. Stundenlang. Man hat erzählt, das sei so, weil man einen Zigeuner nicht ins Haus lässt, auch wenn er nur die Toilette benutzen möchte, darum ginge es aber nicht, die pissen sowieso überallhin, aber am Himmelstor, da lässt der Petrus sie nicht hinein, erst müsse alle Bürokratie erledigt werden, das sei bei den Zigeunern sehr aufwendig, dauert viel länger als bei allen anderen, und draußen vor dem Himmelstor, dort darf man nicht auf den Weg pissen, dann kann man gleich umdrehen und bei der Wegkreuzung in die Hölle hinabsteigen. Dort darf man frei überallhin pissen“ (S. 93). Köhlmeier gibt mit seinem Nachfragen Dornhelm Gelegenheit, dessen rassistische Erniedrigung der Roma zu differenzieren. Während ungarische Zigeuner „im Großen und Ganzen“ als Töpfer oder Scherenschleifer „freundlich und friedlich“ seien, so seien die rumänischen Zigeuner „Killer. Das ist wahr“ (S. 97). In der Zeit der Herrschaft von Vlad II. Dracul (1431–1476), über den Dornhelm für den Österreichischen Staatsrundfunk 1971 einen Film gedreht hat, wäre die besondere Eignung der rumänischen Zigeuner als Pfähler bekannt geworden. Genüsslich erfindet Dornhelm deren spezifische Eignung: „Der Pfähler, also der Vater oder der Großvater von dem [Romabuben], der mir davon erzählte, der musste ein wahrer Könner gewesen sein, ein Spezialist auf diesem Gebiet. Der hat den Pfahl zugespitzt, aber nicht zu spitz. Es sollte ja den Darm, nicht verletzen“ (S. 98). Dazu erbat „Micki“ weitere Details und lässt sich nebstbei erzählen, dass der unter der römischen Herrschaft im Einvernehmen mit den jüdischen Pharisäern zum Tode verurteilte historische Jesus von Nazareth deshalb nur mit einem Nagel an das Kreuz geschlagen worden ist, weil ein Zigeuner den zweiten Nagel gestohlen hat (S. 116 f.). Köhlmeier sieht ein Problem (S. 117): „Die Frage, Robert, ist, ob diese Geschichte von eine Zigeunerfreund oder von einem Zigeunerfeind erfunden worden ist. Das ist nicht so eindeutig“. „Mir hat die Geschichte ein Rom erzählt“. „Ja, dann“. „Nein wirklich, ein Zigeuner hat mir die Geschichte erzählt. Stolz“. Nichts lesen wir von der historisch vermittelten Botschaft dieses Jesus, der von sich sagt: „Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagung in Freiheit setze“ (Lk 4, 18).
Wie lässt sich im Heute zu einem menschlichen Blick auf das Volk der Roma kommen? In den 1970er Jahren sind in Rumänien etwa 650.000 Roma gezählt worden.[14]Es ist die Regierungszeit von Nicolae Ceauşescu (1918–1989), der, wie die österreichische Botschaft aus Bukarest berichtete, bemüht war, den Boden für einen „neuen Menschen“ in Rumänien aufzubereiten.[15] Das ist nicht gelungen, in Rumänien ergriff die kapitalistische Klasse die Herrschaft, die Roma wurden ihre ersten, auf der Straße sichtbaren Opfer. Ihnen zur Seite stehen Organisationen wahrer Geschwisterlichkeit wie von Pater Georg Sporschill SJ (*1946)[16] aus Feldkirch, der ein glaubwürdiges Zeugnis von der Zielsetzung des Jesuitenordens in der Nachfolge von Jesus gibt, und von dessen wunderbar engagierten Mitarbeiterin Ruth Zenkert (*1962)[17] aus Schwäbisch Hall, welche die biblische Erzählung von der Beziehung von Maria zur Befreiung der Armen lebt (Mt 2, 13–23). Beide erzählen mit Herzblut, wie bereichert ihr Menschsein durch die armen und verwahrlosten Roma-Kinder ist. Nach dem Propheten für Gerechtigkeit Elijah benannten diese Christen ihr Sozialprojekt in den Roma-Siedlungen von Siebenbürgen. Das Buch „Moise“ handelt von den „Raben“ und einem ihrer Botschafter für alle Straßenkinder.[18]
Zwei moderne Intellektuelle versinken im Sumpf des Antikommunismus
In der Dornhelm-Biografie deklariert Köhlmeier „Ich bin ein Intellektueller“ (S. 150). Mit Dornhelm unterhält er sich über Augustinus (354–430) und Immanuel Kant (1724–1804), der, so Dornhelm, „doch nie die Welt gesehen“ habe. Dornhelm: „Wahrheitsfanatiker … mit solchen Leuten fängt es an! Hüte dich vor den Wahrheitsfanatikern, Micki!“ „Danke für den Tipp, Robert“ (S. 144). Nachdenken über den kategorischen Imperativ („Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“)[19] nützt diesen intellektuellen Schacherern nichts.
2008 veröffentliche Köhlmeier einen 784 Seiten starken Roman „Abendland“.[20]Fiktive Hauptfigur ist der Innsbrucker Mathematikprofessor Carl Jacob Candoris, welcher wegen des Namens und wegen des erreichten hohen Alters an den an der Innsbrucker Universität tätig gewesenen Mathematikes Leopold Vietoris (1891–2002) erinnern soll.[21] Dieser war im akademischen Leben eine Köhlmeiers „Abendland“ nicht allein als Mathematiker repräsentierende Persönlichkeit. Er hat als praktizierender Katholik die angedachte Wahl des Atheisten und weltberühmten Mathematikers Wolfgang Gröbner (1899–1908) in die Österreichische Akademie blockiert.[22] Der in Innsbruck lehrende theoretische Physiker Ferdinand Cap (1924–2016) hat dem Autor dieses Artikels geschrieben (8. November 1992): „Die Ablehnung von G[röbner]. ist nicht verwunderlich, denn die Akademie ist ja in politisch-weltanschauliche Fraktionen aufgespalten – als man mich frug, ob ich eine Wahl annehmen würde, war die zweite Frage, in welche Fraktion, die christliche, die nationale oder die rote, man mich einordnen sollte. Als ich erwiderte, >in keine dieser drei, da ich primär Wissenschaftler und Liberaler sei<, wurde mir später bedeutet, da ich angeblich Atheist und nicht einordenbar sei, käme ich eh nicht in Frage“.[23] In einem Interview in diesem Jahr sagt Köhlmeier: „Wenn ich einen Roman lese und merke, der will mich zu einer politischen Meinung hinführen, kann ich ihn gar nicht so schnell zuklappen, wie ich kein Interesse mehr daran habe“.[24] Dieser „Abendland“-Roman mit seinen vielen autofiktionalen Episoden kann in österreichischen und deutschen Seniorenheimen bei der abtretenden akademisch gebildeten, von Demenz bedrohten Generation sicher gelesen werden.
Das System der kapitalistischen Gesellschaft wird von Köhlmeier nirgends hinterfragt, alles erhält eine Fassade religiöser Mystik. Deshalb erhält dieser Bestsellerautor viele Preise wie zum Beispiel von einer deutschen Stiftung, die nach jenem Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876–1967) benannt ist, der die Bundesrepublik Deutschland im Bund mit den USA zum Aufmarsch gegen die Sozialistischen Länder wiederaufgerüstet hat und dessen engster Berater der Holocaust-Planer Hans Globke (1898–1973) war.[25] Andreas Batlogg SJ (*1962) hat als damaliger Chefredakteur der jesuitischen Kulturzeitschrift „Stimmen der Zeit“ für deren Septemberheft 2017 Köhlmeier Platz für dessen Essay zum „Finden und Erfinden“ der Passionsgeschichte eingeräumt, die diesem „die Fortführung, die Erhöhung einer Realität ins Mythische“ ist.[26] Das Kreuz, welches die unterdrückten, ausgebeuteten und vom Genozid bedrohten Völker in der Realität tragen müssen, wird durch solche reaktionären Mystiker verhüllt. Am 4. Mai 2018 richtete Köhlmeier im Zeremoniensaal der Hofburg zum Gedenktag an die Opfer von Gewalt und Rassismus politisch opportune Worte über seine Wahrnehmung der in Österreich tatsächlich latenten Gefahr der Wiederkehr des nationalsozialistischen Antisemitismus. Der Name von George Soros (*1930) werde nach seiner Meinung als „Klick“ für „Verschwörungstheorien“ verwendet.[27] Eben dieser George Soros, der als die faschistische Herrschaft in Ungarn überlebender Jude 1947 nach Großbritannien emigriert ist und dann in den USA durch geglückte Devisen- und Aktienspekulationen ein gigantisches, sich immer mehr anhäufendes Vermögen erwarb, finanziert mit seinem globalen Netzwerk in Verkleidung eines Philanthropen jene gesellschaftliche Strömungen, die für die globale Weltherrschaft des Kapitals nützlich erscheinen. Der Konflikt zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump (*1946) und George Soros, über den die Medien berichten, ändert nichts an der realen Rolle von George Soros als Repräsentant der Reichen, die in unserer Welt Hunger und Verelendung der Armen zu verantworten haben. Seine Einladung in den Zeremoniensaal wird Köhlmeier jenem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (*1956) zu danken haben, der sich in der Maske des Kämpfers gegen den Antisemitismus als Botschafter des faschistischen Weges der Regierung Benjamin Netanjahu (*1949) betätigt. Der österreichische Zeithistoriker Gerhard Botz (*1941) hat diese Rede von Köhlmeier zum Unterschied von Paul Lendvai (*1929)[28] als „daneben“ qualifiziert, auch deshalb, weil dessen Behauptung, die Nationalsozialisten hätten durchgehend versucht, Juden an Flucht und Emigration zu hindern, falsch ist.[29]
Blick auf die Russen
Kennt Michael Köhlmeier die Geschichte des russischen Volkes? In der Beilage „Freizeit“ (4. Februar 2024) der Wiener Tageszeitung Kurier gibt er aus Anlass der Veröffentlichung seines Romans „Das Philosophenschiff“[30] ein Interview, dem er das Motto „Ich strebe keine Macht an“ gibt. Dieses Köhlmeier-Buch, das von der angeblichen Deportation von Intellektuellen aus dem revolutionären Sowjetrussland handelt, ist eine Karikatur der in wenigen Zeilen lyrisch geformte „Lebensfahrt“ von Heinrich Heine (1797–1856) „Ich hab ein neue Schiff bestiegen, /Mit neuen Genossen“.[31] Dass der russische Präsident Wladimir Putin (*1952), so Köhlmeier in seinem Interview, sich „gerade am Land, so hoher Zustimmung erfreut, obwohl die Söhne im Krieg fallen, hat auch damit zu tun, dass es in Russland keine Tradition einer liberalen Gesellschaft gibt. Es ist ein Untertanenvolk. Das klingt bösartig, es ist auch nicht spottend gemeint, aber das ist ein Volk, das immer nur gewohnt war, untertan zu sein“. Für den öffentlich wirkenden Intellektuellen Michael Köhlmeier zählt die historische Wahrheit nichts, er will diese im propagandistischen Interesse der europäischen und US-amerikanischen Kriegstreiber interpretieren.
Der Autor dieses Artikels hat dazu an die Chefredaktion des „Kurier“ eine „Lesermeinung“ zur Veröffentlichung zu adressiert. Zu einer Veröffentlichung ist es nicht gekommen, die Einsendung wurde vom „Kurier“ an Köhlmeier weitergeleitet. Der Versuch, in einen Dialog einzutreten, musste scheitern. Es lässt sich letztendlich in dem sich zuspitzenden Klassenkampf eben nur auf einer Seite der Barrikade stehen.
Gerhard Oberkofler an Chefredakteurin des Kurier Marlene Auer. E‑Mail vom 3. Februar 2024.
Sehr geehrte Frau Chefredakteurin Marlene Auer,
in der heutigen Kurier-Beilage lassen Sie Ihren Interviewpartner Michael Köhlmeier sein Dogma vertreten, die russischen Menschen seien ein „Untertanenvolk“. Das russische Volk ist, so Köhlmeier, „ein Volk, das immer nur gewohnt war, untertan zu sein“.
Eine derartige offen rassistische Propaganda ist wahrlich erschreckend. Nicht anders hat der deutsche Faschismus mit seinen politischen Führern und intellektuellen Lakaien argumentiert, um den Eroberungszug im Osten zu rechtfertigen. Michael Köhlmeier sitzt nicht als fiktiver Gast in einem „Philosophenschiff“, sondern er ist ein angemessen ausgehaltener Intellektueller im „Sklavenschiff“ der Meinungsmanipulation im Interesse der Rüstungsindustrie und Kriegstreiber. Er verfälscht zudem schamlos die Geschichte. Notabene war dieses „russische Untertanenvolk“ hauptbeteiligt an der Befreiung Österreichs vom deutschen „Herrenvolk“.
Mögen Sie künftige humanistische Interviewpartner finden – das wünscht sich
mit freundlichen Grüßen
Gerhard Oberkofler
Michael Köhlmeier an Gerhard Oberkofler. E‑Mail vom 5. Februar 2024
Sehr geehrter Herr Dr. Oberkofler,
das tut mir leid, wenn ich Sie so aufgebracht habe. Tatsächlich habe ich mich nicht gut ausgedrückt, auch das tut mir leid. Ich denke nicht so, wie Sie mir unterstellen. Ich wollte sagen und aus dem Zusammenhang des Interviews könnte man das schließen, jedenfalls dann, wenn man mir nicht sofort alles Schlechte zuschreibt, dass die Menschen in Russland keine demokratische oder liberale Tradition haben, die so mächtig gewesen wäre, den Despotismus zu besiegen. Ja, ich bin der Meinung, die Russische Revolution war ein Putsch einer kleinen, straff organisierten Partei, die von Lenin geführt wurde. Der von mir verwendete Begriff „Untertanenvolk“ kann wohl nur polemisch verstanden werden, das tut mir aufrichtig leid. Wenn ich gesagt habe, „das russische Volk war immer nur gewohnt, untertan zu sein“, dann wäre mir lieb, wenn Sie ein Beispiel aus der Geschichte nennen könnten, das diese Meinung widerlegt.
Aber ich möchte Sie schon bitten, mich nicht der rassistischen Propaganda zu zeihen! Wenn Sie schreiben, ich sei ein „angemessen ausgehaltener Intellektueller“, dann bitte ich Sie weiters, mir doch zu sagen, wer mich aushält. Ich weiß niemanden.
Ich finde es bedauerlich, dass ein Diskurs so geführt wird, wie Sie es tun. Wenn man seinem Gegenüber zuvorderst alles Schlechte unterstellt, wie soll da ein Austausch der Meinungen, ein Revidieren falscher Meinungen, ein Zugehen aufeinander möglich sein?
Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Tag
Michael Köhlmeier
Gerhard Oberkofler an Michael Köhlmeier. E‑Mail vom 6. Februar 2024.
Sehr geehrter Michael Köhlmeier
ich bin wie Sie kein Kenner der russischen Geschichte und bin auch zögerlich zu sagen, dass ich die österreichische Geschichte wirklich kenne.
Kann „ein“ Beispiel aus der Geschichte Ihre Meinung widerlegen, dass „das russische Volk immer nur gewohnt war, untertan zu sein“? Wenn ich Ihnen nun schreibe, dass im Oktober 1905 ein gesamtrussischer Generalstreik unter der Losung „Nieder mit der Selbstherrschaft! Es lebe die demokratische Republik“ erfolgt ist und in Petersburg, Moskau und anderen Städten Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten entstanden sind, es im Dezember 1905 in Moskau einen von den zaristischen Truppen niedergeschlagenen Aufstand gegeben und die demokratisch revolutionäre Bewegung bis zur ihrer endgültigen Niederschlagung bis 1907 angedauert hat, so lassen sich solche Fakten, wenn man denn will, eigentlich überall nachschlagen.
Dasselbe gilt von der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution 1917 in Russland, zu einer Zeit, als Lenin noch in der Zürcher Spiegelgasse im Asyl war, und von der Oktoberrevolution 1917, die den blutigen Despotismus des zaristischen Systems beendet hat.
Lenin wird in unserer „freien Presse“ als Massenmörder dargestellt. Was aber hat den Friedensfreund Albert Einstein dazu veranlasst, zu Lenins Todestag für die Soncino Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buchs zu Berlin zu schreiben:
„Ich verehre in Lenin einen Mann, der seine ganze Kraft unter völliger Aufopferung seiner Person für die Realisierung sozialer Gerechtigkeit eingesetzt hat. Seine Methode halte ich nicht für zweckmäßig. Aber eines ist sicher: Männer wie er sind die Hüter und Erneuerer des Gewissens der Menschheit“.
In unserer multipolaren Welt, in der ein Weltkrieg sich ausbreitet, halte ich Ihr publiziertes Eintreten für die Kennzeichnung von „Untertanenvölkern“ für eine Art von Wiederbetätigung, die sich nicht allein auf einen „Führergruß“ reduzieren lässt. Ihre Publikation dient allein dem Aufmarsch gegen die „Russen“ und ist kriegstreibend.
Mit freundlichem Gruß
Gerhard Oberkofler
[1] Noam Chomsky: Demokratie und Erziehung. Hg. von Carlos Peregrín Otero. Aus dem Amerikanischen von Sven Wunderlich. Lowell Factory Books 2013, S. 453 f.; vgl. dazu Josef Schleifstein: Der Intellektuelle in der Partei. Gespäche. Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft. Marburg 1987.
[2] Kürschners Deutscher Literatur-Kalender 2018/2019. Einundsiebzigster Jahrgang. Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston 2018. Band 1, S. 498 f.
[3] EmilFuchsMeinLebenBand2.pdf; vgl.
[4] Vgl. Christentum, Marxismus und das Werk von Emil Fuchs. Beiträge des sechsten Walter-Markov-Kolloquiums. Rosa Luxemburg Stiftung Sachsen. Leipzig 1998; Gerhard Oberkofler: Vatikanideologie und Marxismus. Texte über Aspekte einer historischen Konfrontation. StudienVerlag Innsbruck / Wien / Bozen 2017, S. 11–114 („Nachdenken von Emil Fuchs über die Parteinahme von Christen für den Sozialismus“).
[5] Vgl. dazu Jutta Ditfurth: Ulrike Meinhof. Die Biografie. Ullstein Buchverlag Berlin 2017, hier S. 276 f.; zuletzt vgl. Helga Baumgarten / Norman Paech: Völkermord in Gaza. Eine politische und rechtliche Analyse. Promedia Verlag Wien 2. A. 2025.
[6] Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft. Hg. von der Österreichischen Nationalbibliothek. Redaktion Susanne Blumesberger / Michael Doppelhofer / Gabriele Mauthe. Band 1, K. g. Saur, München 2002, S. 372; Sonja Frank (Hg): Young Austria. ÖsterreicherInnen im Britischen Exil 1938 – 1947. Für ein freies, demokratisches und unabhängiges Österreich. ÖGB Verlag Wien 2012, S. 157–168 (Sonja Frank); Volker Kaukoreit: Erich Frieds Lebensdaten. In: Erich Fried. Gesammelte Werke. Hg. von Volker Kaukoreit / Klaus Wagenbach. Prosa. Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1993, S. 656–689.
[7] Verlag Association Hamburg Oktober 1974, S. 53–59, hier S. 54 und S. 55.
[8] Rudi Dutschke: Jeder hat sein Leben ganz zu leben. Die Tagebücher 1963–1979. Taschenbuchausgabe 1. A. März 2005 (2003 Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln), bes. S. 133 (London 6. Juni 1970); über Dutschke Gretchen Dutschke: Rudi Dutschke. Wir hatten ein barbarisches, schönes Leben. Eine Biographie. Kiepenheuer & Witsch Köln 1996 (3. A. 2021). Vgl. Tilman P. Fichter / Siegward Lönnendonker: Dutschkes Deutschland. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, die nationale Frage und die DDR-Kritik von links. Eine deutschlandpolitische Streitschrift mit Dokumenten von Michael Mauke bis Rudi Dutschke. Mit einem Vorwort aus östlicher Sicht von Rolf Schneider und einem Vorwort aus westlicher Sicht von Christian Semler. Klartext Verlag Essen 2011; Tilman Fichter / Siegward Lönnendonker: Geschichte der SDS. 1946–1970. Aisthesis Verlag Bielefeld 2018; Gretchen Dutschke im Interview mit Cornelia Dildei: Auf stacheligen Wegen zur Befreiung: immer wieder Aufbruch und trafo Verlag Berlin 2024.
[9] Erich Fried an Rudi Dutschke. Durchschlag eines Typoskripts o. D., abgelegt 1978. Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Herrn Martin Wedl herzlichen Dank für Recherchen und Vorlage!
[10] Paul Zsolnay Verlag Ges. m. b. H., Wien 2025.
[11] Robert Dornhelm – Wikipedia
[12] Renovabis zu EU-Holocaust-Gedenktag: „Antiziganismus überwinden“ – Vatican News
[13] Papst Franziskus mit Carlo Musso: Hoffe. Die Autobiografie. Aus dem Italienischen von Elisabeth Liebl. Kösel Verlag München 2025, S. 56.
vgl. auch Gerhard Oberkofler: „Die Wahrheit ist konkret“ – Zum Gedenken an Papst Franziskus (geb. 17. 12. 1936, verst. 21. 4. 2025). In: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 67, 2/2025 (Juni 2025), S. 149–155.
[14] Vgl. Herausgegeben von Tilman Zülch für die Gesellschaft für bedrohte Völker. Mit einem Vorwort von Ernst Tugendhat: In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt. Zur Situation der Roma (Zigeuner) in Deutschland und Europa. Rowohlt Tb Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1979, S. 59 f. Dort Seite 328 Hinweise auf deutschsprachige Literatur, u. a. auf das Buch der österreichischen Widerstandskämpferin Selma Steinmetz (1907–1979): Österreichs Zigeuner im NS-Staat. Wien Europa Verlag 1966.
[15] Z. B. Bericht der Österreichischen Botschaft vom 11. November 1975 nach Wien an das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Staatsarchiv Wien. Herrn Dieter Lautner sehr herzlichen Dank für die Vorlage!
[16] Georg Sporschill – Wikipedia
[18] Vgl. z. B. elijah. Tätigkeitsbericht 2024; Moise. Mein Freund. Die Weisheiten eines Straßenkindes. Zeichnungen von Florin Moise. Hg. von Alfred Fogarassy, Konzept: Nora Schoeller, Texte: Ruth Zenkert. 2024 im Verlag moderne Kunst Wien; Dominik Markl (Hg.): elijah & seine Raben. Wie Georg Sporschill die Bibel für das Leben liest. Amalthea Wien, 2. A. 2016; Gerhard Oberkofler; Elijah und Mohr. Eine Raben-Verbindung – Zeitung der Arbeit
[19] Vgl. z. B. Hermann Klenner: Kategorischer Imperativ bei Christen und Marxisten. In: Christentum, Marxismus und das Werk von Emil Fuchs, S. 17–20.
[20] Deutscher Tb Verlag München 1. A. 2008.
[21] Vgl. Wendelin Schmidt-Dengler: Wie das Leben gebaut ist. Bizarre Lebensläufe durchziehen Michael Köhlmeiers Roman „Abendland. Die Presse vom 25. August 2007; über Vietoris s. Gerhard Oberkofler: Zur Geschichte der Innsbrucker Mathematikerschule (seit dem 19. Jahrhundert). In: Die Fächer Mathematik, Physik und Chemie an der Philosophischen Fakultät zu Innsbruck bis 1945. Unter maßgeblicher Mitarbeit von G. Machek, G. Oberkofler und R. Steinmaurer herausgegeben von Franz Huter (= Forschungen zur Innsbrucker Universitätsgeschichte Band X). Innsbruck 1971, S. 20–51, hier S. 45 f.; für den Wiener Mathematiker Edmund Hlawka (1916–2009) war diese wissenschaftsgeschichtliche Studie Anstoß, die Habilitation des Autors zu empfehlen (Gutachten vom 4. Oktober 1977, Universitätsarchiv Innsbruck).
[22] Vgl. Peter Goller und Gerhard Oberkofler: „… daß auf der Universität für die Lehre, die dort vertreten wird, wirkliche Gründe gegeben werden!“. Wolfgang Gröbner (1899–1980). Mathematiker und Freidenker. In: Österreichische Mathematik und Physik. Wolfgang Gröbner – Richard Mises – Wolfgang Pauli. Hg. von der Zentralbibliothek für Physik in ‑Wien. Wien 1993, S. 9–49.
[23] Privat; vgl. Gerhard Oberkofler: Ferdinand Cap. Otto Hittmair. Aus den Pionierjahren der Innsbrucker Theoretischen Physik. StudienVerlag Innsbruck 2006; Ferdinand Cap. Glaube und Religion aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers. Gottesbegriffe, Evolutionsdebatte und ein Kirchenvolksbegehren. Science and Religion Naturwissenschaft und Glaube. Band 4. LIT Verlag Wien / Berlin 2006.
[24] DerStandard vom 19. September 2025: Köhlmeier und Dornhelm: „Bewunderung für das Böse nie so stark wie zurzeit“.
[25] „Über das Finden und Erfinden“ – Konrad-Adenauer-Stiftung
[26] Stimmen der Zeit 142 (2017), Heft 9, S. 634–640.
[27] Rede Michael Köhlmeier.pdf
[28] Vgl. Paul Lendvai: Vielgeprüftes Österreich. Ein kritischer Befund zur Zeitenwende. ecoWing Salzburg 2. A. 2022, S. 94–97 („Michael Köhlmeiers zeitlos gültige Warnung“).
[29] Köhlmeiers Paukenschlag ging daneben – Kommentare der anderen – derStandard.at › Diskurs
[30] Carl Hanser Verlag GmbH München 2024.
[31] Vgl. Ich hab ein neues Schiff bestiegen … Heine im Spiegel neuer Poesie und Prosa. Eine Anthologie. Herausgegeben von Uwe Berger und Dr. Werner Neubert. Mit einer Graphik von Ursula Mattheuer-Neustädt. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1. A. 1972.