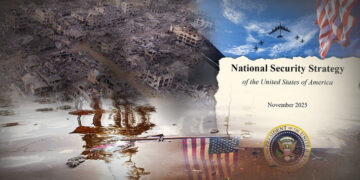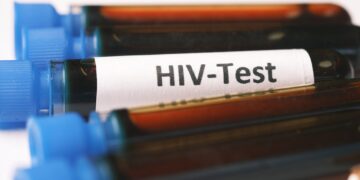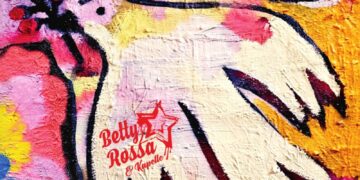Wien. Die Teuerung bleibt hoch – und für viele Menschen in Österreich wird das Leben zunehmend unbezahlbar. Laut Statistik Austria lag die Jahresinflation von September 2024 bis August 2025 bei 2,8 Prozent. Ein Wert, der auf den ersten Blick moderat wirken mag, doch die Realität sieht anders aus: Wohnen, Lebensmittel und Energie reißen tiefe Löcher in die Haushaltsbudgets. Immer mehr Menschen geraten dadurch an ihre Grenzen – ein deutliches Zeichen dafür, dass der Kapitalismus nicht funktioniert.
Löhne hinken hinterher
Gerade in der anstehenden Lohnrunde spielt die Inflation eine zentrale Rolle. Die Gewerkschaften haben zwar angekündigt, keinen Abschluss unter der rollierenden Teuerung zu akzeptieren. Doch auch wenn Löhne und Gehälter nominell steigen, bleibt die Reallohnzuwachs oft auf der Strecke.
Besonders der Handel ist betroffen: Zwar wurde hier bereits ein Zwei-Jahres-Abschluss vereinbart, doch die vereinbarte Erhöhung von 0,5 Prozent über der Inflation droht bei weiter steigenden Preisen zu verpuffen. Damit zeigt sich einmal mehr: Im kapitalistischen System wird die Last der Krise auf die Lohnabhänigen abgewälzt.
Regierung im Ankündigungsmodus
Die Bundesregierung bemüht sich, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Bei ihrer Klausur versprach sie, gegen den sogenannten „Österreich-Aufschlag“ bei Lebensmitteln vorzugehen und die Bundesgebühren im nächsten Jahr nur um zwei Prozent zu erhöhen. Es zeigt sich aber vor allem gibt es Geschenke fürs Kapital.
Doch die Kritik ist laut: Selbst die etablierten Parteien werfen einander Untätigkeit vor. Während die FPÖ die Teuerung als Folge falscher Wirtschaftspolitik darstellt und Steuersenkungen fordert, kritisieren die Grünen, dass mit höheren Gebühren und steigenden Preisen im öffentlichen Verkehr die Bevölkerung zusätzlich belastet wird. Die Menschen spüren längst: Worte füllen keine Einkaufskörbe.
Ein Systemproblem
Die Inflation ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern Symptom einer tieferliegenden Krise. In Österreich liegt sie seit Jahren über dem Durchschnitt der Euro-Zone. Auch dort stiegen die Preise zuletzt stärker als erwartet – auf 2,1 Prozent im August. Die Europäische Zentralbank versucht mit Zinspolitik gegenzusteuern, doch die Auswirkungen für Haushalte und Lohnabhänigen bleiben gering.
Das eigentliche Problem liegt im System selbst: Ein Wirtschaftssystem, das Profite über Grundbedürfnisse stellt, sorgt zwangsläufig dafür, dass die Mehrheit der Menschen immer stärker unter Druck gerät. Während Konzerne steigende Preise nutzen, um ihre Gewinnmargen zu sichern oder gar auszubauen, kämpfen Millionen Haushalte mit der Frage, wie sie am Monatsende ihre Rechnungen bezahlen sollen.
Die Inflation zeigt in aller Schärfe: Der Kapitalismus funktioniert nicht. Er verschärft Ungleichheit, treibt Menschen in Armut und überlässt die Bewältigung der Krise jenen, die sie am wenigsten verursacht haben. Was es braucht, ist nicht die nächste „Ankündigungsrunde“, sondern eine grundlegende Umgestaltung der Wirtschaftsweise – im Interesse der Menschen, nicht der Profite.