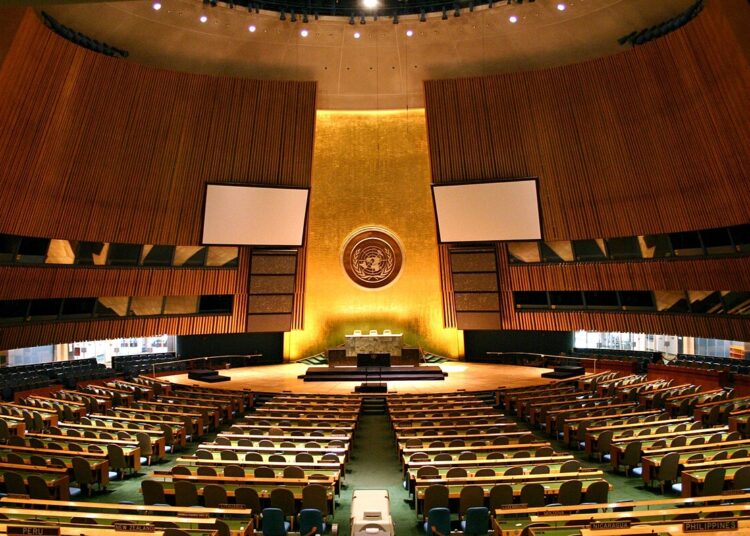Unverhoffte himmlische Beförderung: Papst Franziskus ist nicht mehr. Sein Tod offenbart den anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Einfluss der katholischen Kirche in Italien – von konservativen Parteien instrumentalisiert, von Teilen der Linken idealisiert. Doch trotz seiner sozialen Rhetorik blieb Franziskus in zentralen Fragen der Dogmatik und gesellschaftlichen Ordnung fest in der reaktionären Tradition der Kirche verankert.
Vatikanstadt. Eigentlich ist Ostern das Fest der Auferstehung. Mit dem Tod von Papst Franziskus ist aber nicht nur das spirituelle Oberhaupt von über einer Milliarde Katholikinnen und Katholiken verstorben, sondern auch eine einflussreiche politische Figur. Wie schon bei Benedikt XVI. reagierte der italienische Staat mit einem nationalen Trauertag, Halbmastbeflaggung und weitreichenden Absagen öffentlicher Veranstaltungen. Die Nachricht vom Ableben Bergoglios hatte unmittelbare Folgen für das gesellschaftliche Leben – auch dort, wo man es von einem säkularen Staat nicht erwarten würde.
Kirche und Staat: Enger verflochten, als es scheint
Italien versteht sich offiziell als säkular, doch der Einfluss der katholischen Kirche bleibt enorm. Das zeigt sich nicht nur an symbolischen Gesten, sondern an der realen Macht, die die Kirche im wirtschaftlichen und politischen Gefüge des Landes ausübt.
Da ist zum einen ihr ökonomisches Gewicht: Die katholische Kirche verfügt über ein gewaltiges Vermögen in Immobilien, Finanzanlagen und Handelsbeteiligungen. Sie ist tief verwoben mit zentralen Sektoren der italienischen Wirtschaft – von der Wohlfahrt über Bildung bis hin zum Gesundheitswesen. Dazu kommt ihr steuerpolitischer Sonderstatus, der regelmäßig für politische Debatten sorgt.
Hinzu kommen die wirtschaftlichen Erwartungen rund um das Heilige Jahr 2025: Italien bereitet sich auf bis zu 35 Millionen Pilgerinnen und Pilger vor – eine touristische Großveranstaltung mit erwarteten Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe. Auch deshalb sind religiöse Großereignisse von staatlichem Interesse – und der Tod eines Papstes mehr als nur eine innerkirchliche Angelegenheit.
Verträge mit Tradition und Wirkung
Rechtlich gestützt wird dieser Sonderstatus durch die Lateranverträge von 1929, die das Verhältnis zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl regeln – ein Abkommen mit bis heute weitreichenden Folgen. Die teils 1984 überarbeiteten, aber nie grundsätzlich infragegestellten Verträge garantieren der Kirche ein privilegiertes Mitspracherecht im öffentlichen Leben. Sie machen deutlich: Die katholische Kirche ist kein gewöhnlicher Akteur, sondern spielt eine Art institutioneller Doppelrolle zwischen Glaubensgemeinschaft und staatsnaher Organisation.
Politisches Kapital – auch für die Rechte
Diese besondere Stellung wird seit jeher auch von bürgerlich-konservativen Parteien genutzt. Ob beim Thema Abtreibung, Familie oder Gender: Die Nähe zur Kirche hilft dabei, sich als Bewahrer „traditioneller Werte“ zu profilieren – besonders für rechte Parteien ein strategischer Vorteil. Sie sichern sich damit nicht nur Wählerstimmen, sondern oft auch das wohlwollende Schweigen oder sogar die Unterstützung von Seiten kirchlicher Kreise.
Linke Faszination: Franziskus als moralischer Kompass?
Doch Franziskus war mehr als nur ein Bündnispartner der konservativen Rechten. Über Parteigrenzen hinweg fanden sich Stimmen, die in ihm eine moralische Autorität sahen – besonders im linken Lager. Führende Politikerinnen und Politiker der Grünen und der italienischen Linken verwiesen immer wieder auf seine klaren Positionen zu Umwelt, Arbeit, Migration und Frieden. Auch Vertreterinnen und Vertreter der außerparlamentarischen Linken – von selbsternannten kommunistischen Parteien bis zu sozialen Bewegungen – lobten Franziskus für seinen Einsatz gegen Krieg und soziale Ungleichheit.
Der Papst, so klang es vielerorts, sei eine Art „sozialer Gewissensträger“ – ja, mancherorts wurde er sogar mit dem Sozialismus in Verbindung gebracht. Doch wie tragfähig ist dieser Rückgriff?
Moralische Kritik statt Systemveränderung
Franziskus war ohne Zweifel ein Papst des anderen Tons. Er sprach von den „Ausgeschlossenen“, prangerte die „Wirtschaft, die tötet“ an und warnte eindringlich vor Umweltzerstörung. Doch in der Substanz blieben seine Vorschläge innerhalb des Rahmens des ethischen Kapitalismus. Statt Klassenkampf – moralische Appelle. Statt Systemkritik – ein Ruf zur Umkehr der Herzen.
Der christliche Solidarismus, den Franziskus vertrat, ist kein revolutionäres Konzept. Er zielt auf ein gerechteres Miteinander, aber nicht auf eine andere Gesellschaftsordnung. Es geht ihm nicht um die Überwindung des Kapitalismus, sondern um seine Humanisierung. In diesem Sinne blieb er dem ideologischen Erbe christlich-demokratischer Bewegungen treu.
Auch in Fragen von Inklusion und Bürgerrechten blieb Franziskus mehrheitlich der konservativen kirchlichen Lehre treu. Neben begrenzten religiösen Zugeständnissen an Geschiedene vertrat er konservative Positionen zu Abtreibung, Verhütung und Homosexualität. Zudem wurde ihm eine Nähe zur argentinischen Militärdiktatur unter Videla sowie die Vertuschung von Missbrauchsfällen innerhalb der Kirche vorgeworfen.
Seine Haltung zu Krieg und Frieden entsprach der historischen Linie der Kirche: Moralisch ablehnend, aber politisch neutral. Die Forderung nach Frieden wurde nie mit einem Bruch mit imperialistischen Strukturen oder einer materialistischen Analyse verbunden. Im Gegenteil: Der kirchliche Pazifismus dient oft als Deckmantel für den Status Quo – beruhigend für das Gewissen, aber folgenlos für die Realität.
Ein klarer Gegensatz zum Marxismus
Dass Franziskus gelegentlich den Dialog mit Linken lobte, ändert nichts an seiner klaren Ablehnung marxistischer Grundgedanken. In einem Vorwort zu einem Buch seines Vorgängers Benedikt XVI. betonte er, dass der grundlegende Unterschied zwischen Christentum und Marxismus nicht bei der Option für die Armen liege – sondern in der Frage der Erlösung: Während der Marxismus an eine weltliche Befreiung glaubt, vertraut das Christentum auf die göttliche Erlösung im Jenseits.
Dieser Unterschied ist fundamental – und politisch hochrelevant. Denn wo die marxistische und später marxistisch-leninistische Tradition auf kollektive Organisation, materielle Umwälzung und Klassenanalyse setzt, plädiert die christliche Lehre für individuelle Barmherzigkeit, moralische Einsicht und göttliches Wirken.
Kein Bezugspunkt für die Arbeiterbewegung
Angesichts dieser Gegensätze ist es ein Irrweg, in Franziskus einen Verbündeten zu sehen. Seine sozialen Appelle können durchaus menschlich berühren – doch sie stehen einer materialistischen Analyse und emanzipatorischen Politik nicht nahe, sondern quer.
Religion bleibt – trotz aller rhetorischen Öffnungen – eine ideologische Kraft, die soziale Widersprüche entschärfen, nicht zuspitzen will. Sie spricht von Leid, aber nicht von Klassenverhältnissen. Sie spricht vom Frieden, aber nicht vom Kampf. Marx, Engels, Lenin – sie alle betonten: Religion mag ein Ausdruck realer Not sein, doch sie bleibt auch ein Werkzeug zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung.
Wer also Papst Franziskus zum Vorbild erklärt, bewegt sich – bewusst oder unbewusst – weg vom revolutionären Denken. Und zurück in die moralische Komfortzone einer Ordnung, die sich nur erneuern, aber nie wirklich verändern will.
Quellen: Unità / l’OrdineNuovo