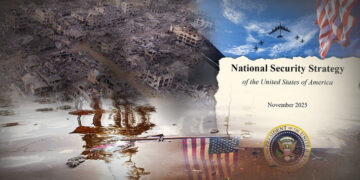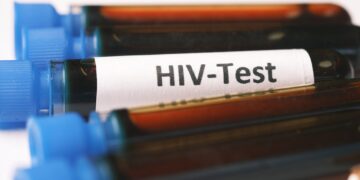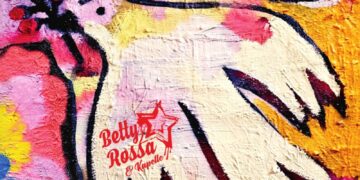Am Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers (KZ) im niederösterreichischen Leobersdorf, dem zweitgrößten Frauenlager in Österreich, werden nun bald die Bagger rollen, denn in der niederösterreichischen Ortschaft hat man eine bzw. der amtierende Bürgermeister eine interessante Auffassung von Gedenken. Schließlich ist ein guter Verdienst wichtiger als eine Gedenkstätte, die nichts einbringt. Ein fatales Zeichen im Gedenkjahr 2025, 80 Jahre nach der Befreiung von der Nazi-Herrschaft.
Leobersdorf. Ab dem Jahre 1939 wurde das KZ Leobersdorf/Hirtenberg genutzt, zunächst als Zwangsarbeits- und Kriegsgefangenenlager. Ab September 1944 wurde ein spezielles Frauen-KZ eingerichtet, das bis April 1945 bestand. Es handelte sich um ein Außenlager des KZ Mauthausen und das zweitgrößte Frauen-Konzentrationslager der NS-Zeit. In dieser relativ kurzen Zeit waren mindestens 402 Frauen, hauptsächlich aus der Sowjetunion, Polen und Italien dort inhaftiert. Genauere Angaben über die Anzahl der Inhaftierten gibt es nicht. Es ist anzunehmen, dass es noch viel mehr waren, auf einem Areal, das rd. 90.000 m² groß war.
Die Frauen wurden unter unmenschlichen Bedingungen in unbeheizten Baracken hinter elektrischem Stacheldraht gefangen gehalten. Sie mussten Zwangsarbeit in der nahegelegenen Hirtenberger Munitionsfabrik (Gustloff-Werke) leisten, wo sie Zündkappen für Patronen produzierten. Häftlinge berichteten von Hunger, Kälte, Schlägen und strengen Arbeitsbedingungen, einschließlich eines Sprechverbotes. Laut dem Lokalhistoriker Erich Strobl starben zwischen Mitte 1943 und Anfang 1945 fast 200 Menschen, darunter 59 Kinder, in den Lagern der Region. Die namentliche Erfassung ist jedoch unvollständig, aber das Schicksal von Personen wie Hulja Wala, die am 21. März 1945 starb, ist dokumentiert. Es gibt insgesamt nur wenige schriftliche Unterlagen, da das Gemeindeamt von Hirtenberg in den letzten Kriegstagen abbrannte. Das erleichterte die Forschung nicht unbedingt. Außerdem schwieg die lokale Bevölkerung lange über das Lager, was zur Tabuisierung führte. Vom Lager selbst sind nur rudimentäre Reste geblieben.
Was wäre naheliegender, als das Gelände als Gedenkstätte zu schützen und wie etliche andere ehemalige Lager aus der NS-Zeit als Mahnmal an das schwärzeste Kapitel unserer Geschichte zu erhalten. Doch die Pläne des Bürgermeisters von Leobersdorf sehen anders aus.
Umwidmung mit Mehrwert für den Bürgermeister
Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste Zukunft Leobersdorf) plant seit 2021 einen Gewerbeparkt auf diesem ehemaligen KZ-Gelände zu errichten. Die Immobilienfirma des Bürgermeisters, die Prisma Development GmbH, kaufte das Areal von der SOGIP und verkaufte es für 15,25 Millionen Euro an den Bauunternehmer Thomas Rattensperger. Durch zwei für den Bürgermeister günstige Umwidmungen, die er im Gemeinderat von Leobersdorf selbst mitentschied, erhielt seine Firma noch zusätzlich 1,34 Millionen Euro.
Diese Pläne wurden natürlich nicht kritiklos hingenommen, sobald sie bekannt wurden. So wurden von der Israelitischen Kultusgemeinde, dem Mauthausen Komitee und der SPÖ die Geschichtsvergessenheit und die mögliche Korruption angeprangert. Diesem Widerstand zum Trotz begannen im August 2025 die Bauarbeiten zur Errichtung der Gewerbehallen.
Lokale Initiativen wie „NS-Zwangsarbeit Leobersdorf“ und das Mauthausen Komitee forderten eine Gedenkstätte. Eine Stele wurde im April 2024 in Hirtenberg enthüllt, um an das Außenlager zu erinnern. Interessanterweise befindet sich diese nicht am KZ-Gelände. Ein Gedenkweg am Rand des Areals ist in Planung, aber ein umfassender Denkmalschutz wurde vom Bundesdenkmalamt abgelehnt, da die baulichen Überreste (Fundamente und Mauerreste) nicht ausreichend erhaltenswert seien.
Damit ist das KZ Hirtenberg/Leobersdorf ein Beispiel für die unzureichende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich. Die Überbauung des Geländes wird als Verlust eines historisch bedeutsamen Ortes gesehen, der für die Erinnerung an die Opfer und die Aufklärung künftiger Generationen wichtig wäre. Luftaufnahmen aus den 1940er- und 1960er-Jahren sowie archäologische Funde zeigen, dass Reste des Lagers noch vorhanden sind, aber durch die Bebauung verloren gehen.
Die Vorgänge in Leobersdorf zeigen wieder sehr deutlich, welche Prioritäten in Österreich gesetzt werden. Kleingeistige Interessen von Personen, die sich als Gemeindekaiser aufspielen, um eigene ökonomische Vorteile aus einer Position zu ziehen, werden sowohl politisch als auch juristisch unterstützt und stehen höher, als die Notwendigkeit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte.
Leider gibt es kaum mehr realistische Möglichkeiten, den Bau noch zu verhindern, dazu sind die Bauarbeiten bereits zu weit fortgeschritten. Außerdem liegen die notwendigen Genehmigungen vor und die Haltung des Bundesdenkmalamtes schränken die Chancen stark ein. Ein Baustopp wäre nur durch außergewöhnlichen politischen oder rechtlichen Druck möglich, etwa durch eine Intervention des Bundes oder neue rechtliche Erkenntnisse zu Unregelmäßigkeiten beim Grundstücksdeal. Aktuell konzentrieren sich die Bemühungen auf die Schaffung eines Gedenkweges und die archäologische Dokumentation, was darauf hindeutet, dass die Bebauung weiter voranschreitet. Eine Fortsetzung der öffentlichen Kampagne und rechtliche Schritte könnten theoretisch noch Einfluss nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges ist gering.
Quellen: Wiener Zeitung/Wiener Zeitung/Falter/Die Presse/Wiener Zeitung