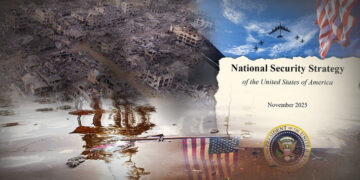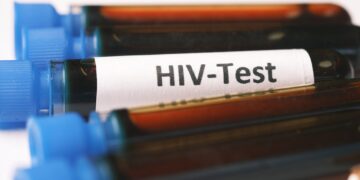Ein rechtswidriger Polizeieinsatz an der NS-Gedenkstätte Peršmanhof erschüttert Kärnten und belastet die Beziehungen zu Slowenien. Während die Kommission des Innenministeriums massives Fehlverhalten bestätigt, schweigen Polizei und Behörden weiterhin – und lassen zentrale Fragen zu Verantwortung und Sensibilität im Umgang mit einem Ort des antifaschistischen Gedenkens offen.
Der umstrittene Polizeieinsatz Ende Juli an der NS-Gedenkstätte Peršmanhof in Kärnten sorgt weiterhin für politische und diplomatische Wellen. Der Einsatz, der sich gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines antifaschistischen Bildungscamps richtete, wurde inzwischen von der Untersuchungskommission des Innenministeriums als in „vielerlei Hinsicht rechtswidrig und unverhältnismäßig“ eingestuft. Der Vorfall hat nicht nur das Verhältnis zwischen Kärnten und Slowenien belastet, sondern auch grundlegende Fragen über den Umgang der Behörden mit sensiblen Erinnerungsorten aufgeworfen.
Schweigen der Behörden
Von der Landespolizeidirektion Kärnten ist bis heute keine Erklärung zu erhalten. Auch die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, die beim Einsatz mitverantwortlich war, verweigert bisher jede substanzielle Stellungnahme. Eine Anfrage beim Innenministerium blieb ebenfalls unbeantwortet. Dieses Schweigen steht in starkem Kontrast zur Brisanz des Geschehens – und lässt viele Fragen offen: Wer ordnete den Einsatz an, auf welcher rechtlichen Grundlage, und warum wurde an einem zentralen Gedenkort der Kärntner Slowenen derart massiv vorgegangen?
Keine Anzeigen – aber schwere Vorwürfe
Laut Rudi Vouk, dem Anwalt der betroffenen jungen Erwachsenen, ist bis heute keine einzige Anzeige bei seiner Kanzlei eingelangt. Die Polizei hatte ursprünglich Verstöße gegen das Naturschutzgesetz und sogenannte „Anstandsverletzungen“ als Begründung für den Großeinsatz genannt. „Ich gehe davon aus, dass, wenn es nach drei Monaten noch nichts gibt, es wahrscheinlich auch in Zukunft nichts mehr geben wird“, sagte Vouk.
Tatsächlich wurden nur zwei Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt bekannt – beide im Zusammenhang mit dem Einsatz selbst. Damit steht der Einsatzgrund, auf den sich die Einsatzleitung berief, auf äußerst wackligem Fundament.
„Perfider Diskurs“ über Gedenken
Das antifaschistische Camp fand in Absprache mit der Gedenkstätte statt und wurde maßgeblich von Nachkommen jener Familien organisiert, deren Angehörige während des NS-Regimes verfolgt oder ermordet worden waren. Umso schärfer fiel die Kritik von Markus Gönitzer, Obmann des Vereins Društvo/Verein Peršman, aus: „Nachfahren von Widerstandskämpferinnen und NS-Opfern sind noch immer in unseren Vorständen vertreten, in unserem Museum vertreten, gestalten diesen Ort mit. Und denen jetzt vorzuschreiben, wie Gedenken auszuschauen hat in einer Gedenkstätte, das finde ich einen der perfidesten Diskurse an dieser ganzen Sache.“
Bericht bestätigt Fehlverhalten – Konsequenzen angekündigt
Der Endbericht der Untersuchungskommission, der Ende dieser Woche veröffentlicht werden soll, bestätigt die Rechtswidrigkeit des Einsatzes und kündigt Empfehlungen an Bund und Land an. Der Einsatzleiter wurde bereits versetzt. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) versprach Konsequenzen: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass alles getan wird, um entsprechende Konsequenzen für von der Analysekommission in ihrem Bericht zweifelsfrei festgestelltes Fehlverhalten der drei für den Polizeieinsatz Verantwortlichen zu ziehen.“ Die Amtsinspektion sowie die Personalabteilung der Landesregierung wurden mit der Prüfung sofortiger Maßnahmen beauftragt.
Fehlende Sensibilität gegenüber der Volksgruppe
Eva Hartmann, stellvertretende Obfrau des Vereins Peršmanhof, sieht in den Ergebnissen des Berichts eine Bestätigung: „Wir sehen uns bestätigt in unseren Annahmen und Analysen. Was für uns zentral ist, ist dass es offensichtlich bei diesem Einsatz mehrere Verfehlungen gegeben hat, die einerseits darauf fußen, dass offensichtlich Unwissenheit geherrscht hat bei den einschreitenden Organen, hinsichtlich der eigenen Befugnisse und der Zuständigkeiten. Was aber für uns noch viel schwerwiegender ist, ist eigentlich diese fehlende Sensibilität.“ Diese mangelnde Sensibilität gegenüber der Geschichte der Kärntner Slowenen sei bezeichnend für bestehende Defizite im Umgang mit der Volksgruppe. Hartmann kritisierte zudem das Ausbleiben einer Entschuldigung: „Eine Entschuldigung dazu, dass man pauschal hier junge Menschen quasi kriminalisiert hat. Also der Schaden, der hier angerichtet wurde durch diesen Einsatz, ist wirklich nicht zu unterschätzen.“
Auch Sloweniens Außenministerin Tanja Fajon sprach von einer notwendigen Entschuldigung gegenüber der Jugend und bestätigte, dass sie mittlerweile eine offizielle Entschuldigung Österreichs erhalten habe.
Drohende Wiederholung – oder Chance zur Aufarbeitung?
Bernard Sadovik, Obmann der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen, lobte die faktenbasierte Arbeit der Kommission, mahnte aber politische Konsequenzen ein: „Letztendlich ist es entscheidend, dass die Empfehlungen, die die Kommission vorschlägt, die Politik nun auch umsetzen möchte, weil wir möchten für die Zukunft verhindern, dass sich so etwas noch einmal hier in Kärnten oder sonst wo in Österreich wiederholt.“
Der Fall Peršmanhof ist damit weit mehr als ein Verwaltungsproblem oder eine Kommunikationspanne. Er berührt Grundfragen des Rechtsstaates, des Respekts vor der Erinnerungskultur und des Umgangs mit Minderheiten. Solange die Verantwortlichen schweigen und keine transparente Aufklärung erfolgt, bleibt der Eindruck bestehen, dass hier grundlos und mit Vorsatz repressiv gehandelt wurde.