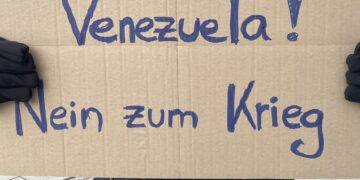Gastautor: Peter Goller, geb. 1961, Univ.-Doz. Dr. und Archivar an der Universität Innsbruck
Der Jungproletarier Wedel studiert in den Jahren knapp nach 1900 die Geschichte der Arbeiterbewegung im Rahmen sozialistischer Bildungskurse. Er „konnte sich nicht genug darin tun, die Lehrer (der Abendkurse – Anm.) zu loben, und er meinte, der ganze Geschichtsunterricht, wie man ihn in der Volksschule, in den Gymnasien und an der Universität erhalte, tauge nicht, wenn man ihn nicht durch die Geschichte der Arbeiterbewegung ergänze.“
Wedels aus Gründen der unterschiedlichen Herkunft nur begrenzt treuer Freund, der sich durch das humanistische Gymnasium schleppende Staatsanwaltssohn Hans hingegen verfügt über allerhand spießiges Bildungswissen. Die Geschichte der Arbeiterbewegung überfordert ihn allerdings völlig: „Nein, nie hatte er etwas gehört von einem gewissen Bebel, und auch das Sozialistengesetz war ihm unbekannt … ‚Proletarier aller Länder, vereinigt euch!’ – er wusste nicht, was es bedeuten sollte.“[i]
Am Ende seines Lebens gestaltete Johannes R. Becher 1957 im Erzählfragment „Wiederanders“ die Figur des jungen Arbeiters Wedel, erinnernd an den proletarischen Jugendlichen Hartinger in Bechers halb autobiographischen Roman „Abschied. Einer deutschen Tragödie erster Teil 1900–1914“ (1940 in Moskau erschienen). Hier wie dort findet sich der zwischen der autoritären „Untertanen“-Welt und der freien demokratischen Welt des Arbeitervolkes hin und her schwankende Staatsanwaltssohn Hans (Gastl), der nun heimlich und verschämt im Konversationslexikon seines Vaters Stichworte wie „Bebel“, „Sozialismus“, „Zukunftsstaat“ zu studieren beginnt.[ii]
Den jungen Proletariern Max und Lene ist die Geschichte der klassenbewussten Arbeiter hingegen schon aus ihrer Lebenswelt bekannt. Beide Figuren, Max Herse und dessen Genossin Lene, hatte Becher 1925/26 für den Roman „Levisite“ gestaltet. Mitte der zwanziger Jahre, angesichts der Krise der revolutionären Bewegung nach der Oktoberniederlage 1923 und angesichts der relativen Stabilisierung des Kapitalismus der Weimarer Republik, verlassen der Bergarbeiter Max Herse und die Trikotagenfabrik-Arbeiterin Lene die sozialdemokratische Jugendbewegung. Lene, in der „Gewaltfrage“ unsicher, zögert noch mit dem Übergang zur Kommunistischen Partei, worauf ihr Max empfiehlt, das „Kommunistische Manifest“, die Geschichte der revolutionären Kämpfe zu studieren: Die Agenten des Kapitals „legalisieren die Gewalt. … ist nicht die Arbeitsstätte heute für die weitaus meisten Menschen eine Schlachtbank?!“ Dagegen hilft nur die Gewalt des Arbeiter-Klassenkampfs: „Lene, du musst wieder einmal das ‚Kommunistische Manifest‘ lesen. Wir müssen gewaltig viel aufholen, wir sind durch die bürgerlichen Schulen und durch unsere verbürgerlichten Führer ungeheuer verdorben und verbildet worden. Wir müssen uns wieder zu uns selbst zurückfinden, zu uns, zu unserem unverfälschten instinktsicheren Klassenstandpunkt…‘“[iii]
Bechers Weg zum proletarisch-revolutionären Schriftsteller
Über seinen mit Bertolt Brecht oder Friedrich Wolf vergleichbaren Weg vom linken Flügel des Expressionismus, von ethisch antimilitaristischer Friedenssehnsucht und von einer bloß romantisch moralischen Kapitalismuskritik zum revolutionär proletarischen Schriftsteller schrieb Johannes R. Becher 1928: „Der Weg eines bürgerlichen Dichters zu einem Dichter des Proletariats ist keineswegs ein schnurgerader.“[iv]
Im „Deutschlandlied“ rechnet Becher 1934 mit der „expressionistischen Periode“, den Jahren des „sinnlosen Zeitverschwendens“ ab: „In solcherlei Sprache tat ich kund / Seltsam verworrene Träume … / Ich litt noch lang an der Krankheit der / Unreinen krächzenden Reime.“[v]
Als Kriegsgegner stand Becher dem Spartakus-Bündnis, der entstehenden Kommunistischen Partei Deutschlands, dem rätesozialistischen Flügel der „Novemberrevolution“ 1918/19 nur gefühlsmäßig nahe. So bemerkt Becher 1924 zur Neuauflage einer dramatischen Dichtung aus dem Jahr 1919: „Zur Umarbeitung des Stückes selbst wäre zu sagen: ‚Arbeiter, Bauern, Soldaten‘ ist 1919 geschrieben, aus einer Atmosphäre von Gefühlskommunismus und verworrenem ekstatischem Gottsuchertum heraus.“ An „expressionistische Schauerkrämpfe“ erinnernde Stellen habe er beseitigt![vi]
Selbst Anfang der 1920er Jahre war es für Becher noch möglich, einen Weg nach dem Vorbild von Stefan George mit seinem priesterlichen Sehergehabe oder nach Gottfried Benn zu gehen, also wie Benn „zu einem Sänger der Sintflut, des Weltuntergangs zu werden“.
Nach dem Studium von Lenins „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ – mit seiner Analyse der sich barbarisch kriegerisch verschärfenden Ausbeutung – oder von Maxim Gorkis „Zerstörung der Persönlichkeit“ (1909) – mit ihrer Kritik aller kleinbürgerlich parasitären Intellektualität – fordert Becher, der nun in die Linie von Thomas Münzer, G.W.F. Hegel, Georg Büchner zu Marx und Engels eingeschlagen hat, 1924 in einem Aufruf an die „Deutschen Intellektuellen“ eine Orientierung an den historisch materialistischen Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie: Mehrwert, Profitrate, Lohnsklaverei.[vii]
Scharf attackiert Becher, 1928 erster Vorsitzender des Bundes proletarisch revolutionärer Schriftsteller Deutschlands (BPRS) die Pseudo-Arbeiterdichter im Umfeld der Sozialdemokratie als „Feierabendlyriker“ und als „Klassenversöhnungspoeten“. Im August 1926 griff Becher in der „Roten Fahne“ die nur mehr zum „Schein sozialistischen“ SPD-Schriftsteller Heinrich Lersch, Max Barthel, die auch ideologisch zur Übernahme jeden bürgerlichen Irrationalismus, jeder religiösen Esoterik bereit sind, indem sie von „christlicher Reinheit“, von „gut und böse“, vom „Jenseits faseln“, und „statt vom Proletariat vom Volk salbadern“, also „statt vom Proleten von dem Menschen, statt vom Klassenkampf von der Arbeitsgemeinschaft von ‚Harmonie‘‚ ‚Weltglück‘, ‚Lebensfreude‘“.
Statt scheinlinker „Arme Leute-Literatur“ hat Becher die Arbeiterkorrespondenten und junge proletarische Schriftsteller unterstützt. Karl Grünbergs „Brennende Ruhr“ würdigt Becher 1929 als eine Geschichte der ersten „Roten Armee“ in Deutschland 1920: „Karl Grünberg ist ein proletarischer Dichter. Er sieht und gestaltet die Welt vom Standpunkt des Proletariats aus. Er hat nicht die gepolsterte Ruhe, um seine Sätze zu feilen und sie zu biegen, sie vibrieren und klingen zu lassen. Roh und ungeschlacht kommt er daher, haut und fetzt Worte hin, manche Gestalten sind unausgeglichen, nur leidliche Bruchstücke.“[viii]
Gleichzeitig beschreibt Becher Emil Ginkel als einen „Dichter der Arbeiterklasse“: „Ginkel ist ein Dichter der Arbeiterklasse. Er gehört zu den wenigen Dichtern, die, aus dem Proletariat stammend, dem Proletariat treu geblieben sind“. Die Gedichte von Ginkel zeigen, dass die revolutionären Schriftsteller über die „Agitations-Poesie“ hinausgelangt sind. Auch wenn allein „oberflächlich hingehauene“ Agitationslyrik, die tägliche „proletarische Literaturform“ von „Arbeiterkorrespondenten und von Zellenzeitungen“ unentbehrlich sind, gilt für Becher: „Auch ‚Losungen‘ müssen gestaltet sein. Kunst ist Waffe, desto brauchbarer für uns und desto gefährlicher für den Klassenfeind, je vollendeter sie gehandhabt wird.“[ix]
Über den Gedichtband „Fabriken, Gruben“ des jahrelang arbeitslosen oberschlesischen Jungkommunisten Wilhelm Tkaczyk notiert Becher 1932 in der „Linkskurve“: „Er lebt als proletarisch-revolutionärer Dichter innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Not und Namenlosigkeit. Seine Dichtung ist reichhaltig und kühn, das tiefe und gewaltige Thema des Klassenkampfes wird in ihr nicht schematisch heruntergeleiert, es versackt nicht in Deklamation und allgemeinem Geschwätz, die Schwierigkeiten und Widersprüche der revolutionären Bewegung werden mit dichterischen Mitteln gestaltet, Prozesse werden gezeigt und nicht nur Resultate ‚hurra-proletarisch’ hingehauen.“[x]
„Klassenschlachten“ – Deutsche und österreichische Arbeiterkämpfe 1918–1934
Becher lässt im „Deutschlandlied“, auf dem Weg in die Emigration 1933/34, die Klassenkämpfe seit 1918, den „Spartakusaufstand“ 1919, die Münchner Räterepublik 1919, die Kämpfe der Roten Ruhrarmee 1920, den mitteldeutschen Aufstand mit den Leuna-Kämpfen 1921 oder die Hamburger Barrikadenschlacht im Oktober 1923 vorbeiziehen.
Den antifaschistischen Kampf der deutschen Arbeiter sieht Becher als „Heldenlied im Gedächtnis der Völker“ eingeschrieben. Er erinnert an die Pariser Kommune von 1871: „Nicht auf Helden billig geschminkt, / Im Rampenlicht einer Bühne, / Standen sie, von Gewehren umringt, / Die Helden der Pariser Kommune. / Sie gingen wie eine leuchtende Spur / Durch die tobende Spießermasse / Und riefen: ‚Es lebe die Diktatur – / Die Diktatur der Arbeiterklasse!‘“ (DL, 248)
An Heinrich Heines Pariser Exil erinnert Becher 1933 in der französischen Hauptstadt angekommen, Heine als Freund von Marx und Engels, als ein Sympathisant der emigrierten deutschen kommunistischen Wandergesellen: „Du warst bekannt mit Karl Marx und gabst / Bestimmt grad darin dein Bestes, / Wo dein Gedicht zu donnern beginnt / Wie die Sätze des Manifestes. / Und als ich das ‚Wintermärchen’ las, / Da ist es mir gewesen, / Als hörte ich – gedichtet zwar – / Manche Stelle der Feuerbach-Thesen.“ (DL, 227)
Becher versucht Friedrich Hölderlin aus dem Griff des Faschismus zu retten: „Es war in Paris, da traf ich auch / Einen Dichter – ihr werdet staunen -, / Denn sie versuchen im Dritten Reich / Als den ihren ihn auszuposaunen. / Doch hat er über die Deutschen zuviel / Gesagt, man muss es nur lesen, / Denn Friedrich Hölderlin wär bestimmt / Kein Hakenkreuzdichter gewesen.“ (DL, 228)
Beim Abschied aus Deutschland notiert Becher über die gescheiterte „Novemberrevolution“, über den Berliner Jänner-Aufstand 1919: „Berlin. Ich sehe Karl Liebknecht hoch / Auf einem Auto unter den Linden, / Hundertausende Arbeiter folgen ihm / Mit Gewehren und roten Binden.“ (DL 179)
Bereits 1924 hatte Becher in der dramatischen Dichtung „Arbeiter, Bauern, Soldaten“ in expressionistisch stilisierter, rhythmisch von Massenchören vorgetragener Sprache an die Matrosenrevolten des Herbst 1918 erinnert. Er sieht, dass der weiße Terror schon früh die Liquidierung der Revolution vorbereitet hat. So beklagt die schattenhaft an Rosa Luxemburg erinnernde „Führerin“ den fehlenden revolutionären Terror: „O ich begreife. / Langsam begreife ich … / In die Soldatenräte eingeschlichen. / Die Bewegung gebremst … / So ist es allemal, / Wenn man nicht rechtzeitig an die Wand stellt… / Geschontes Blut bei ihnen / Blutströme bei uns …“[xi] Becher gibt die Hetzparolen des sozialdemokratischen „Vorwärts“ vom Jänner 1919 gegen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wider: „Vielhundert Tote in einer Reih. / Proletarier! / Karl, Rosa, Radek und Kumpanei / ‘s ist keiner dabei! / Proletarier!“ Der sozialdemokratische Minister Gustav Noske tritt in einer Gesellschaft von Freikorps-Offizieren, von „wohlbeleibten Herren (Börsianer, Spekulanten etc. etc.)“ und von „Arbeiterverrätern“ als „Bluthund“ auf: „Meinetwegen! Einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht.“ Später tritt ein „Chor der Sozialverräter“ auf. Er prahlt mit dem Verdienst, „den sozialistischen Klassenstaat verhindert“, den „Burgfrieden“ von 1914 neu besiegelt zu haben: „Die Bildung einer roten Garde ist einzustellen. / Ich kenne dich, du bist ein Spartakist! / Die Streiks sind Totengräber am Volk. / Neue Kurssteigerungen im Vertrauen auf Noske …“[xii]
In nicht mehr expressionistisch emotionalen, sondern nun schon in materialistischen Kategorien übt Becher 1925/26 in „Levisite“ Kritik am wenig organisierten Berliner Jänner-Aufstand. Der Jungproletarier Max Herse weiß, dass jede Mobilisierung ohne zentral disziplinierte Leitung im Chaos von Abenteurern und Polizeiagenten versinkt: „Wieviel Schutt spült eine Revolution herauf? Desperados, Hochstapler, Hasardeure. (…) Spitzel und Provokateure …!“ Was „da alles ins Zeug schießt: Utopien, Überradikalismus, Versöhnlertum, Menschenliebe, dummdreiste Gehässigkeit“. (Levisite, 244, 366–368)
Mitte Dezember 1918 waren die räterepublikanischen Fraktionen (Spartakisten, Revolutionäre Obleute, linke „Unabhängige“, Syndikalisten) auf dem allgemeinen deutschen Rätekongress der rechten sozialdemokratischen Mehrheit unterlegen. Die Truppen der Revolution, allen voran die Volksmarinedivision, fielen ohne politische Führung unter dem Druck der „Mehrheitssozialdemokratie“ auseinander.
Die an der Jahreswende 1918/19 gegründete KPD – in Widersprüche wie den Streit über die Teilnahme zu Wahlen an einer bürgerlichen Nationalversammlung verwickelt – warnte angesichts der wieder hoch gerüsteten paramilitärischen Verbände vor Berlin, angesichts der Isolation Berlins vom „flachen Land“ vor einem Aufstand gegen die Ebert-Regierung, so Karl Radek oder Rosa Luxemburg. Mit den am 5. Jänner 1919 einsetzenden Massenprotesten änderten sich aber die Voraussetzungen.[xiii]
Provokatorisch war am 4. Jänner 1919 der linkssozialistische Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn abgesetzt worden. Hunderttausende Arbeiter und Soldaten – begleitet von bewaffneten Roten Garden – verlangten am 5. Jänner nicht nur die Wiedereinsetzung Eichhorns, sondern die Steigerung der Aktion: den politischen Massenstreik, teilweise den Aufstand. Unter diesen Umständen stimmten auch die KPD-Vertreter Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck dem Aufstand zum Sturz der Ebert-Regierung und der Eroberung der Macht durch das „revolutionäre Proletariat“ zu.
Der nach den Protesten des 5. Jänner 1919 eingerichtete „Revolutionsausschuss“ schätzte nicht nur die militärischen Kräfteverhältnisse falsch ein. Er war vor allem nicht in der Lage, eine klare politische Leitung zu bieten, indem er ratlos zwischen der Generalstreik-Parole, der Aufstandslosung einerseits und hilflosen „Verhandlungs“-Lösungen schwankte. Becher beschreibt die Tage zwischen dem 4. und 11. Jänner 1919 in „Levisite“. Der Revolution fehlt jede planmäßige Organisation. Die Konterrevolution ist hochgerüstet: „Nur war es mehr eine Frage der Führung als der einzelnen Führer, es war die Partei, die fehlte. Die Konterrevolution aber arbeitete indessen nach einem einheitlichen Plan. Sie rechnete nicht nur mit Berlin, sondern mit dem ganzen Reiche. Ein Werbebüro nach dem andern wird eingerichtet, auf Lastautomobilen werden Waffen herbeigefahren. Kraftwagen aus Kasernen und Depots, ein ganzer Park von Fuhrwerken wird in Dahlem zusammengestellt, wohin inzwischen Noske und Oberst Reinhardt aus Berlin geflüchtet sind. Nach drei Tagen schon glich die Gegend einem Kriegslager.“ (Levisite, 368f.)
Münchner Räterepublik 1919: Eugen Leviné
Die Erinnerung an die Münchner Räterepublik kreist bei Becher um den im Sommer 1919 hingerichteten Eugen Leviné, den Protagonisten der zweiten roten Münchner Republik, die Anfang Mai 1919 von weißgardistischen Truppen liquidiert worden war: „München. Es spricht Eugen Leviné. / Wie einfach er spricht und entschieden! / Es stehen auf dem Odeonsplatz / Lastwagen, Gewehrpyramiden.“ (DL, 179)
Peter Friedjung, Hauptfigur in Bechers „Levisite“, 1923 aus Enttäuschung über die Hohlheit der rechten „Schlageter“-Demagogie aus der Welt der reaktionären Freikorps und der schlagenden Studentenverbindungen zu „den Roten“ übergegangen, wird Mitte der zwanziger Jahre während eines Generalstreiks schwer verletzt verhaftet: „Der Erste Mai: ein Welt-Kampftag! Aufmarsch der Vaterländischen Verbände. Rote Gegendemonstration. Provokateure an der Arbeit. Ein Blutbad – Am Abend des Ersten Mai.“
In seiner Zelle liest Peter Friedjung die letzten Gefängnis-Notizen von Eugen Leviné, die 1919 in Berlin in der Sammlung „Ahasver, Rede vor Gericht“ erschienen waren. (Levisite, 227ff.)[xiv]
Rote Ruhrarmee 1920 – Leuna 1921
Zum Kampf der Roten Ruhrarmee 1920 merkt Becher 1933 an: „Essen. Wie hast du im Kapp-Putsch dich / Erhoben und griffst nach den Waffen / Und hast mit den Städten an der Ruhr / Eine Rote Armee geschaffen.“ (DL, 179)
Becher waren die sozialrevolutionären, von weißem Terror niedergeschlagenen Arbeiterkämpfe aus „Rote Eine-Mark“-Romanen wie Carl Grünbergs „Brennender Ruhr“ oder Hans Marchwitzas „Sturm auf Essen“ bekannt.[xv]
In ähnlichen Zeilen erinnert Becher an den mitteldeutschen Arbeiteraufstand vom März 1921, an die aussichtlose Verteidigung des Leuna-Werks: „Leuna. Wie hab ich das Heldentum / Der Leuna-Kulis bewundert! / Sie hielten das Werk viele Tage lang, / Und einer stand gegen hundert!“ Becher kannte Berta Lasks „Leuna“-Drama.
An die „rote Ruhr“ hatte Becher schon in „Levisite“ erinnert. In apokalyptischen Revolutionsbildern steht der Kampf der geschlagenen Roten Ruhrarmee vor Augen: „Die Rote Armee zog damals von Stadt zu Stadt. Hals über Kopf rückte die Reichswehr ab. Das rote Banner flog – (…) Rote Soldaten stiegen aus den Gruben, warfen sich, wo noch eine Lücke war, in die Rote Front … Das ganze Bergwerksrevier marschiert. Das ganze Bergwerksrevier kämpfte seinen bewaffneten Aufstand. So war es. So wird es wieder sein. Grab an Grab, Schächte, in denen Tausende verschüttet, erstickt, zermalmt worden sind, Schlachtäcker des Bürgerkriegs, gedüngt mit proletarischem Heldenblut: das ist westfälischer Boden.“ (Levisite, 68f., 74f.)
„Roter Oktober 1923“: Hamburger Aufstand
Becher erinnert angesichts der „relativen Stabilisierung“ des Kapitalismus an das vorläufige Ende der proletarischen Revolutionshoffnung nach der Niederlage im Oktober 1923. Dem niedergeschlagenen Aufstand von Hamburg widmete Becher 1933/34 die Zeilen: „Hamburg, du Barrikadenstadt, / Wann wirst du dich strecken und dehnen, / Dann reißen die Straßen mitten entzwei, / Und es heulen Sturm die Sirenen?! …“ (DL, 179)
Der Hamburger Barrikadenkampf, Ende Oktober 1923, von der KPD ausgerufen als Generalstreik und Aufstand gegen die Unterdrückung der mitteldeutschen Arbeiterregierungen war isoliert geblieben. Seine Niederschlagung markiert nicht nur das Ende des Roten Oktober 1923, sondern auch das Ende eines Zyklus 1918 einsetzender sozialrevolutionärer Kämpfe. Er mündet in der vorübergehenden Illegalisierung der KPD, in revolutionärer Ebbe und Depression.[xvi]
Über weite Teile des Landes wird der Ausnahmezustand, ein militärdiktatorisches Regime verhängt: „Seit den Hamburger Barrikadenkämpfen … Kollegen hatten sich‘s ja erzählt. Man fühlte sich seiner eigentlich nicht mehr recht sicher …“
In der Novelle „Vorwärts, du rote Front!“ beschreibt Becher 1924 den Hass der „Extrablätter“: „Aufstand niedergeworfen … Kommunistische Haufen zerstreut … Truppen einmarschiert … Freude, Dankbarkeit der vom ‚Roten Terror befreiten Bevölkerung …“ Weißgardisten belagern Arbeiterviertel. Es herrscht Pogromstimmung gegen kommunistische Arbeiter: „Darauf erfolgt die Besetzung der Unruheherde (Volkshäuser, Gewerkschaftshäuser, sozialistische und kommunistische Parteibureaus) durch die Truppe.“
In biblischen Bildern gestaltet Becher 1924 den Befreiungskampf des Proletariats als Passion der Kreuzwegstationen, als Erlösungskampf: „So vollendet die Menschheit ihren jahrtausendelangen Weg, voll von Blutlachen, Marterpfählen und turmhoch geschichteten pestqualmenden Leichenhaufen, gespenstischen Gedenkrunen ihrer eigenen Gefangenschaft.“
Becher zeichnet das Bild von „vogelfreien Kommunisten“. Ein Arbeitermädchen namens Bärbele, ein „Seminarist“, also ein religiös sozialistischer Theologiestudent, werden bestialisch ermordet, ihre Leichen verstümmelt, „gefallen auf dem internationalen Blutacker des Bürgerkriegs, gefallen im Dienste der sozialen Revolution“, auf „den Schlachtfeldern des Klassenkampfs, so auch der „Genosse Zuckmaier“, einer „der ältesten Kämpfer der proletarischen Armee“ und weitere „im Leichenschauhaus aufgeschichtete Arbeiter“, „zu einer einzigen Leibermasse eingeschmolzen“: so der „Genosse Aloisius Grindlhuber, ein geborener Urbayer, mit vielen Gefängnisjahren dekoriert, zuletzt Leiter eines internationalen sozialistischen Korrespondenzbureaus“, die Genossinnen vom „roten Samariterdienst: die Genossin Eva Weißmantel, ‚auf der Flucht erschossen‘.“[xvii]
Max Herse fragt Peter Friedjung: Wann stopfen wir Proleten den „höchst ehrenwerten Herrschaften“ das Maul? In den Monaten der Illegalität nach dem gescheiterten Herbstaufstand 1923 gelten kommunistische Proleten als rechtloses Gesindel. Auch Peter Friedjung und Max Herse werden brutal zusammengeschlagen und verhaftet: „Auch an einer Gruppe von ‚Vaterländischen‘ kam [Max] vorbei, sie unterhielten sich angeregt und laut, da sie in größerer Anzahl beisammen standen. (…) Es waren breit aufgedunsene und verfettete Gesichter, aber auch scharf geschnittene Profile waren darunter, richtige Galgenvögel- und Mördervisagen. ‚Den Arbeiterschweinen wird jetzt gründlich der Garaus gemacht werden‘, quietschte einer. Er hatte dünne Beinchen und trug eine Gymnasiastenmütze. (…) Es waren meist, wie sich Max schnell vergewisserte, Reserveoffiziere, Studenten, Fabrikantensöhne, Angestellte, aber wenig, und hie und da auch noch ein wütiger Kleinbürger. Die gaben kein Pardon.“ (Levisite, 268f.)
Peter Friedjung, 1923 aus der Welt der völkischen Studentenkorps geflüchtet, und Max Herse, nach sozialdemokratischen Jahren auf dem Weg zur KPD, haben immer wieder Versammlungen der SPD, in denen sozialdemokratische Schicksalsergebenheit in den Kapitalismus gepredigt wird, besucht: „‘Ja, aber meine Herrschaften!‘ rief der [sozialdemokratische] Referent aus, als sich aus einer Saalecke heraus wieder Widerspruch bemerkbar machte. ‚Wir leben eben nun einmal in einer kapitalistischen Gesellschaft, und ich kann nicht, so gern ich auch möchte, sie heute auf morgen wegpusten. So heißt es also, sich so gut es geht mit dieser Tatsache abzufinden und sich so häuslich wie irgend nur möglich in dieser Gesellschaft einzurichten. … Gedulden Sie sich, warten Sie ab, bitte, alles zu seiner Zeit…‘“ (Levisite, 87f.)
Der Sozialdemokratie werfen Friedjung und Herse vor, die Einheitsfront der Arbeiterparteien zu sabotieren. Mit ein wenig antimonarchistischer Stimmungsmache und flacher Republik-Agitation gibt sich die Sozialdemokratie zufrieden. Das Absingen der Internationale kann den Opportunismus nicht verdecken. Kommunistische „Störenfriede“ antworten mit Rufen wie „Arbeiterverräter“, „Burgfriede“. Die Partei von Friedrich Ebert und Karl Kautsky hat mit ihrer „Pour le mérite“ würdigen Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 das Erbe des antiimperialistischen Kampfes von Karl Marx, Friedrich Engels, August Bebel und von Wilhelm Liebknecht aus den Jahren des preußisch-französischen Krieges 1870/71 und damit auch die Erinnerung an die internationale Solidarität mit der Pariser Kommune verraten. (Levisite, 106f.)
Der Jungarbeiter Max Herse beobachtet, wie in sozialdemokratischen Versammlungen wie selbstverständlich von der Überholtheit des Klassenkampfs, sogar von so genannten deutschen nationalen Interessen die Rede ist: „Wir Sozialdemokraten vertreten die Gesamtheit der Nation, wir vertreten die Interessen aller Bevölkerungskreise, das Wort ‚Klassenkampf‘ ist überhaupt veraltet und wissenschaftlich bereits längst überholt … Also: mit dieser kommunistischen infamierenden Klassenhetze haben wir Sozialdemokraten nichts gemein.“ (Levisite, 113)
Max Herse und seine Freundin Lene, nun am 1. Mai bei den Roten Frontkämpfer marschierend, verachten 1925 das sozialdemokratische Biedermeier: „Und morgen ist der Erste Mai … Ach, Max, wenn ich an die Maifeiern bei der SPD denke, mir wird bei der Erinnerung noch ganz übel … Die vielstimmigen schmalzigen Männerchöre und die Reigentänze … Dieses ganze ‚Jupudei, Jupudei‘. Einmal haben wir sogar aufgeführt: ‚Sah ein Knab ein Röslein stehn…‘ Und dann die Umzüge: im Gehrock, die Angströhre aufgestülpt, den Zylinder, mit roter Schärpe um, und die Blechmusik an der Spitze: Tschindarassa … Es war wirklich ein schöner, gemütlich-biederer sozialdemokratischer Bußbrüder- und Betschwesternverein.“ (Levisite, 247f.)
Der „Präsident der Republik“ wird als Tattergreis geschildert, dem Beamte Reden und Dokumente unterschieben, die er stockend verliest, so u.a. „Mein Bestreben bleibt es auch heute, die Klassengegensätze zu mildern, ich reiche darum erneut jedem Deutschen feierlich die Hand.“ (Levisite, 274)
Umgekehrt wird Max Herse von seinen ehemaligen sozialdemokratischen Genossen hart
angegriffen: „Jüngelchen in kurzen Hosen, noch nicht trocken hinter den Ohren, Novembersozialisten, Dienstzeit: insgesamt drei Jahre Arbeiterbewegung höchstens. Aber das Maul um so voller mit Phrasen, mit revolutionären Scheinparolen, und wenn es mal losgeht, ebenso die Hosen voll. … Nur ein Lastkraftwagen mit Schupo …und heidi, heida, verschwunden schon sind sie …“ (Levisite, 124)
Die Welt der „Kultur-Philister“ in ihren „Parasitennestern“ steht gegen die Hölle der „stickicht qualmenden Fabrikräume“: „Beim Granatendrehen der Proletarierfrauen, der Proletarierkinder. Beim Kartoffelstehlen und auf den Heringspolonaisen – Beim Tage- und nächtelangen Anstehen der Arbeiterfrauen vor den Lebensmittelgeschäften. Im verzweiflungsvollen Schluchzen von Millionen der ihrer Männer im imperialistischen Weltkrieg beraubten Arbeiterwitwen …“ (Levisite 327)
Becher deutet die Lenin-Motive von einer durch (koloniale) „Extraprofite“ korrumpierten (Fach-) Arbeiteraristokratie, den kapitalistischen Krisenzyklus an: „Auseinanderfallen der Weltwirtschaft. Unfähigkeit des Kapitalismus, irgendeines der großen internationalen Probleme zu lösen. Valuta-Chaos. Unlösbarkeit der Reparationsfrage. Verschärfte Krisenperiode, Einengung des Weltmarktes. Uneinheitlichkeit der Konjunktur. Unerträgliche Spannung zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften.“ (Levisite, 294)
Revolution bedeutet nicht expressionistisches Pathos und Scheinheldentum. Revolution bedeutet täglichen Kleinkram, Ankämpfen gegen Demoralisierung, gegen Desorganisation, gegen liquidatorische, opportunistisch reformistische Stimmungen, bedeutet Zettelkleben, Flugblätter verteilen, Nicht-Organisierte ansprechen, bedeutet Handeln unter legalen und illegalen Vorzeichen zugleich: „Denn Revolution bedeutet nicht nur gefühlsmäßige, begeisterungsflammende Hingabe an das revolutionäre Ideal. Damit ist bei weitem noch nicht alles getan. Revolution ist nicht nur der bewaffnete Aufstand, ist nicht nur das Stadium des Emporflammens der Massen-Empörung, Revolution bedeutet auch kleine zermürbende Parteiarbeit. Revolution ist auch die Klebekolonne. Revolution sind auch leere Versammlungen. Revolution ist Legalität und Illegalität.“ (Levisite, 353)
Wien: Februar 1934
Wie viele antifaschistische Schriftsteller – so Anna Seghers, Friedrich Wolf, Bertolt Brecht, Oskar Maria Graf, Willi Bredel oder Jura Soyfer – verfolgte Becher den Aufstandsversuch der österreichischen Arbeiter, des sozialistischen Schutzbundes am 12. Februar 1934 in Wien, mit seiner Vorgeschichte, den zaudernd kampfunwilligen „Austromarxisten“, der defensiv vor dem katholischen Dollfuß-Faschismus zurückweichenden, sich in die parlamentarische Legalität flüchtenden österreichischen Sozialdemokratie: „Der Schutzbund hatte zwar Waffen, doch / Ließ er täglich sie sich konfiszieren, / Es war nicht ermutigend, auf diese Art / Täglich den Kampf zu verlieren.“ (DL, 167)
Die Beobachtung der Exponenten der österreichischen Sozialdemokratie verlief für Becher im Herbst 1933 ernüchternd. Becher fühlt sich an die deutsche Sozialdemokratie erinnert: „Ich sprach in Wien mit Julius Deutsch, / Er schien mir ziemlich belemmert. / Er sprach vom ‚tragischen Schicksalsschlag’ / Und wie das Schicksal ihn hämmert. / Die Bauer und Renner und Luitpold Stern / Und wie sie alle heißen – / Ich merkt’s ihnen an, sie täten gern / Wie Grzesinski nach China reisen.“
Der Heimwehrfaschismus um Ernst Rüdiger Starhemberg hingegen plant gezielt das Auslöschen des Roten Wien: „Es war gerad Katholikentag. / Viele zogen einher dollfüßig. / Fürst Starhemberg auf der Lauer lag, / Er war nicht gerade müßig. / Er drohte hinauf zum Rathaus und schrie: / ‚Brecht endlich die Trutzburg der Roten!’ / Er drohte umsonst. Es hatten die / Bereits sich selber verboten …“ (DL, 239)
Zu den mutigen, aber isoliert bleibenden Schutzbundaufständen des 12. Februar 1934 hält Becher fest: „Es standen die Arbeiter auf in Wien / Mit Greisen, Frauen und Kindern. / Von Floridsdorf rief es bis Ottakring: ‚Tod den Schergen und Schindern!’ / Es standen die Arbeiter auf in Steyr, / In Bruck an der Mur und in Gmunden, / Sie hatten Gewehre, genügend an Zahl, / Noch in den Verstecken gefunden. / Der Schutzbundprolet, der Kommunist / Schlossen die Reihen fester. / Sie rissen Schienen und Straßen auf / Und bauten Scharfschützennester. / Sie stürmten in Steyr die Waffenfabrik / Und haben die Lastkraftwagen / – es flogen Starhembergs Kugeln dicht – / Mit Panzerblech ausgeschlagen. / Herr Dollfuß zog sich eilig zurück / In sein Regierungsviertel / Und umgab sich mit hohem Stacheldraht / Und einem Truppengürtel.“
Becher schildert nicht nur die militärische Gewalt gegen die Arbeiter, die Panzerzüge und Artilleriegeschütze gegen die Wiener Arbeiterwohnhäuser: „Die ‚Herren der Lage’ riefen herbei / – es waren gezählt ihre Tage – / Geschütze, Bomben, Minen und Gas / Zwecks besserer Beherrschung der Lage. / Sie unterminierten die Häuser und / Schossen hinein mit Geschützen, / Sie warfen Bomben vom Flugzeug, um / Die Häuser entzweizuschlitzen.“
Becher schildert auch die blutige Ausnahmejustiz gegen zahlreiche Schutzbündler, so die Hinrichtung des schwer verwundeten Karl Münichreiter, Schutzbundkommandant von Wien-Hietzing: „Sie richteten dutzende Galgen auf / Und beorderten Feldgerichte. / Die Hoffnung, auf den Galgen gesetzt, / Ging ebenfalls bald zunichte. / Einen schwerverwundeten Schutzbundmann / Hoben sie auf die Leiter / Und knüpften den Strick um seinen Hals – / Der Gehenkte hieß Münichreiter.“ (DL, 273–275)
Auf dem Weg in das Exil fährt Becher 1933 ein letztes Mal durch das Tiroler Inntal. Er erinnert sich an seine Jugendferien in den Tiroler Bergen: „Auf Wiedersehen, Tiroler Land! / Was sag ich: auf Wiedersehen?! / Seit meiner Kindheit kennen wir uns. / Die Liebe – sie blieb bestehen …“ Die Nazis sind auch schon in Österreich überall präsent: „Propaganda durch krachende Böller. / Mit schrecklichem Krach detonierte so / Ein Böller plötzlich im Keller.“ Becher spricht von den „Hakenkreuz-Legionären“ in Kufstein. (DL 204–208)
[i] Johannes R. Becher: Wiederanders. Romanfragment (in den 1950er Jahren entstanden, erstmals 1960 in Auszügen in „Sinn und Form“ veröffentlicht), in derselbe: Abschied. Wiederanders (Gesammelte Werke 11), Berlin-Weimar 1975, 498f. (kurz: Wiederanders). Vgl. Horst Haase: Johannes R. Becher. Leben und Werk, Berlin 1981, 323–327.
[ii] Johannes R. Becher: Abschied (1940), in derselbe: Abschied. Wiederanders (Gesammelte Werke 11), Berlin-Weimar 1975, 369 (kurz: Abschied).
[iii] Johannes R. Becher: [CHCl=CH] 3 AS [Levisite] oder der einzig gerechte Krieg (1926), in derselbe: Gesammelte Werke 10, Berlin-Weimar 1969, 169–171 (kurz: Levisite).
[iv] Johannes R. Becher: Statt einer Autobiographie (1928), in derselbe: Publizistik I 1912–1938 (Gesammelte Werke 15), Berlin-Weimar 1977, 144–158, hier 154 (kurz: Publizistik I). Vgl. Lexikon sozialistischer deutscher Schriftsteller. Von den Anfängen bis 1945, Leipzig 1964, 84–102.
[v] Johannes R. Becher: Deutschland. Ein Lied vom Köpferollen und von den „nützlichen Gliedern“ (1934), in derselbe: Epische Dichtungen (Gesammelte Werke 7), Berlin-Weimar 1968, 127–282, hier 156 (künftig kurz: DL).
[vi] Johannes R. Becher: Arbeiter, Bauern, Soldaten. Entwurf zu einem revolutionären Drama (1924), in derselbe: Dramatische Dichtungen (Gesammelte Werke 8), Berlin-Weimar 1971, 101–189, hier 104 (kurz: ABS).
[vii] Johannes R. Becher: Aufgefordert, eine Biographie zu schreiben (1926), in derselbe: Publizistik I, 107–112. Vgl. Maxim Gorki: Die Zerstörung der Persönlichkeit (1909), in derselbe: Wie ich schreibe. Literarische Porträts, Aufsätze, Reden und Briefe, München 1978, 249–301.
[viii] Johannes R. Becher: Vorwort zu „Brennende Ruhr“ von Karl Grünberg (1929), in derselbe: Publizistik I, 193–201.
[ix] Johannes R. Becher: Emil Ginkel (1929), in derselbe: Publizistik I, 207f.
[x] Johannes R. Becher: Ich weiß, Wilhelm Tkaczyk (1932), in derselbe: Publizistik I, 340.
[xi] Vgl. aus der Perspektive der Revolutionären Obleute Richard Müller: Geschichte der deutschen Revolution II: Die Novemberrevolution [Berlin 1924], Berlin 1979.
[xii] Vgl. Karl Liebknecht: Trotz alledem! (15. Jänner 1919), in derselbe: Gesammelte Reden und Schriften 9, Berlin 1971, 709–713.
[xiii] Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 3: Von 1917 bis 1923, hrg. von einem Autorenkollektiv, Berlin 1966, 182–199.
[xiv] Vgl. über Leviné Michaela Karl: Die Münchner Räterepublik. Porträts einer Revolution, Düsseldorf 2008, 210–229 oder: Literaten an die Wand. Die Münchner Räterepublik und ihre Schriftsteller, hrg. von Hansjörg Viesel, Frankfurt 1980.
[xv] Vgl. Erhard Lucas: Die Märzrevolution 1920, 3 Bände, Frankfurt 1970–1978.
[xvi] Über den Hamburger Arbeiteraufstand 1923 vgl. Dieter Dreetz – Klaus Gessner – Heinz Sperling: Bewaffnete Kämpfe in Deutschland, Berlin 1988, 261–295. Dazu auch Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 3: Von 1917 bis 1923, Berlin 1966, 429–434 und den Folgeband: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 4: Von 1924 bis Januar 1933, Berlin 1966, 9–31.
[xvii] Johannes R. Becher: Vorwärts, du rote Front! [Demonstrations-Novelle – Quo vadis …?] (1924), in derselbe: Kleine Prosa (Gesammelte Werke 9), Berlin-Weimar 1974, 315–373, hier 315, 323–325, 358–366.