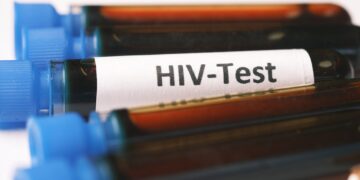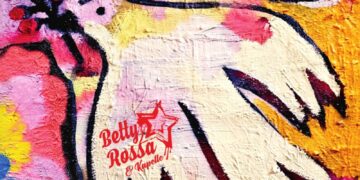Bad Eisenkappel. Die Staatsanwaltschaft Graz hat in der Causa Peršmanhof Ermittlungen eingeleitet und das Landeskriminalamt Steiermark mit den Untersuchungen beauftragt. Auslöser ist eine Sachverhaltsdarstellung des Anwalts Rudi Vouk, die sich auf den massiven Polizeieinsatz Ende Juli bei einem antifaschistischen Jugendcamp am Peršmanhof bezieht. Im Raum steht der Verdacht des Amtsmissbrauchs – gegen eine namentlich bekannte Person sowie gegen vorerst unbekannte Täterinnen und Täter.
Was geschehen ist
In der letzten Juliwoche fand an der Gedenkstätte und dem Museum Peršmanhof zum zweiten Mal ein antifaschistisches Jugendcamp statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Italien und Slowenien nahmen an Workshops und Vorträgen teil. An einem Sonntag rückten Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft und dem Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen an – offiziell wegen „illegalen Campierens und Parkens“. Der Einsatz an einem Ort, der den Widerstand der Kärntner Sloweninnen und Slowenen gegen das NS-Regime würdigt, löste umgehend breite Kritik aus.
Die politische Nachbearbeitung läuft auf mehreren Ebenen: In der Kärntner Landesregierung gab es einen runden Tisch, zudem setzte das Innenministerium eine Kommission ein, die den Einsatz prüfen soll. Auch diplomatisch knirschte es: Aus Slowenien kamen klare Forderungen nach Aufklärung.
Juristische Dimension
Rechtsanwalt Rudi Vouk, Vertreter der Volksgruppe, brachte die Causa zunächst bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein. Mittlerweile liegt sie bei der Staatsanwaltschaft Graz. Der Vorwurf: Verdacht des Amtsmissbrauchs. Die Ermittler sollen klären, ob behördliche Befugnisse überschritten wurden und ob der Eingriff in Versammlungs- und Meinungsfreiheit verhältnismäßig war – insbesondere angesichts des sensiblen Ortes und des zivilgesellschaftlichen Charakters des Camps.
Der Ort: vom Partisanenstützpunkt zum Lernort
Der Peršmanhof der Familie Sadovnik war ab 1942 ein wesentlicher Stützpunkt der Widerstandsbewegung, die von Jugoslawien aus auch in Kärnten stark wurde. Am 25. April 1945 verübten Angehörige des SS- und Polizeiregiments 13 ein Massaker am Hof: Elf Menschen aus den Familien Sadovnik und Kogoj wurden erschossen. Heute ist der Peršmanhof ein zentraler Erinnerungsort der Kärntner Sloweninnen und Slowenen – und ein musealer Lernort gegen Faschismus und ethnische Verfolgung.
Versuch einer Einordnung
Wo Erinnerung politisch unbequem ist, greift der Staat gern zur Repression – selbst bei einem antifaschistischen Jugendcamp an einem Ort dieser Geschichte. Schon bald wird man vermutlich ein paar wohlklingende Phrasen über „Verhältnismäßigkeit“ und „Lehren für die Zukunft“ hören, während intern der Einsatz längst als „ordnungsgemäß“ abgeheftet wird.
Statt echter Konsequenzen droht eine altbekannte Mischung aus politischer Amnesie und administrativer Selbstrechtfertigung: Ein Abschlussbericht, der mehr Nebel produziert als Licht, ein paar mahnende Worte – und dann zurück zum Tagesgeschäft der Ordnungssicherung. Dass es hier um einen der zentralen Orte des Widerstands der Kärntner Sloweninnen und Slowenen geht, passt nur zu gut ins Muster: Erinnerung ist willkommen, solange sie harmlos ist. Sobald sie lebendig wird, internationale Solidarität knüpft und junge Menschen politisiert, ist sie für den bürgerlichen Staat eine „Störung“, die man – notfalls mit Blaulicht und Schlagstock – beseitigt.
Der Polizeieinsatz am Peršmanhof ist damit weniger ein „bedauerlicher Einzelfall“ als vielmehr ein Symptom: Er zeigt, dass selbst im Gedenken an den antifaschistischen Widerstand die herrschende Ordnung ihre Grenzen markiert. Und wer glaubt, der Staat würde ausgerechnet an diesem Ort antifaschistischer Bildung die freie Entfaltung fördern, der glaubt vermutlich auch, dass Polizei und Ministerien irgendwann freiwillig ihre eigenen Machtmittel beschneiden.
Quelle: ORF