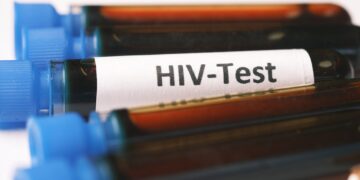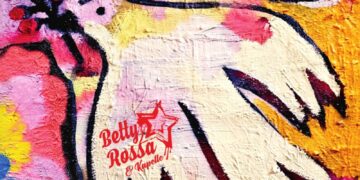In Vorarlberg und anderen Grenzregionen sehen Konsumentinnen und Konsumenten täglich, was die Statistik höflich „Preisunterschiede“ nennt und was an der Kassa wie eine Bestrafung fürs Wohnen auf der falschen Seite der Grenze wirkt. Das ORF-Wirtschaftsmagazin ECO zahlte für eine Sonnencreme bei Bipa 17,99 Euro, während dieselbe Packung bei Rewe in Deutschland 7,99 Euro kostet. Kaffee, Orangensaft, Frischkäse – viele Alltagsprodukte sind in Österreich spürbar teurer, teilweise doppelt so teuer, und es betrifft längst nicht nur Lebensmittel. Dass es einen Österreich-Aufschlag gibt, bestreitet kaum noch jemand.
Die Bundeswettbewerbsbehörde hält fest, es gebe deutliche Hinweise darauf, dass internationale Hersteller der Lebensmittelindustrie für Österreich andere, höhere Preislisten führen als für größere EU-Staaten; kleinere Märkte werden teurer bepreist, weil sie es können. Der Handel wehrt sich mit dem Hinweis, solche Vergleiche hinkten: In Österreich seien im Schnitt 37 Prozent der Preise rabattiert, in Deutschland nur 25 Prozent, also sei die reale Differenz geringer. Außerdem verweisen Handelsvertreter auf Geografie, Alpen, eine dichtere, kleinere Filialstruktur und die zehnmal größere Bevölkerungszahl Deutschlands, die Skalenvorteile ermögliche; nicht zuletzt müsse der österreichische Handel bei internationalen Konzernen bis zu 20 Prozent mehr für die gleiche Ware bezahlen. Die Industrie antwortet spiegelbildlich: höhere Standortkosten, reale Produktion und Zehntausende Arbeitsplätze im Land, von Coca-Cola in Edelstal über Mars/Food in der Tiernahrung bis zu Mondelez’ Milka-Tafeln in Bludenz. Wer nationale Verträge zugunsten einheitlicher EU-Regeln „aushebele“, gefährde als Erstes diese Standorte, so die angebliche Warnung der Industrie verbunden mit düsteren Szenarien steigender Lohn- und Energiekosten und einer bedrohten Versorgungssicherheit.
Zwischen Schuldzuweisung und Standortrhetorik steht die Bevölkerung – und zahlt. Während Konzerne entlang der Lieferkette Preisdurchsetzung als Geschäftsmodell betreiben, erklärt der Handel, Rabatte seien die eigentliche Wahrheit, und die Industrie hält das Fähnchen „Arbeitsplätze“ hoch, wenn der Profit zur Sprache kommt. Die Politik eröffnet derweil Debattenfenster: Konsumentenschutzministerin Korinna Schumann und Finanzminister Markus Marterbauer sprechen über hohe Lebensmittelpreise und mögliche Eingriffe, SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler findet Markteingriffe „denkbar“. Denkbar ist viel; entscheidend ist, was in Gesetzestexten landet und umgesetzt wird. Eine Partei, die in der Regierung sitzt und gleichzeitig die Kapitalinteressen der Industrie, des Handels und der Logistik nicht frontal konfrontieren will, wird am Ende genau jene Lösungen scheuen, die weh tun müssten: harte Transparenzpflichten bis zur Produzentenpreisliste, kartellrechtliche Regeln, Abschöpfung von Krisenextraprofiten, verpflichtende Grundversorgungs-Preisdeckel und EU-weite Entbündelung von Exklusivvertriebsrechten. Die SPÖ wird darüber reden, sie wird prüfen, sie wird mahnen – und sie wird, solange sie Koalitionsfähigkeit für sakrosankt hält, keine Politik durchsetzen, die dem Kapital tatsächlich schadet.
Wer wirklich einen Österreich-Aufschlag beseitigen will, muss Machtverhältnisse ändern: Liefer- und Exklusivverträge offengelegen, Einkaufspreise prüfbar machen, Überwälzungsketten durchbrechen, Konzentration begrenzen und Grundbedarf aus der Profitlogik herauslösen. Alles andere ist PR-Arbeit.
Quelle: ORF