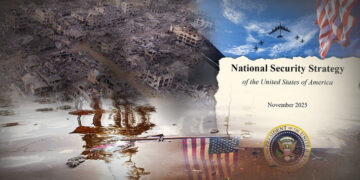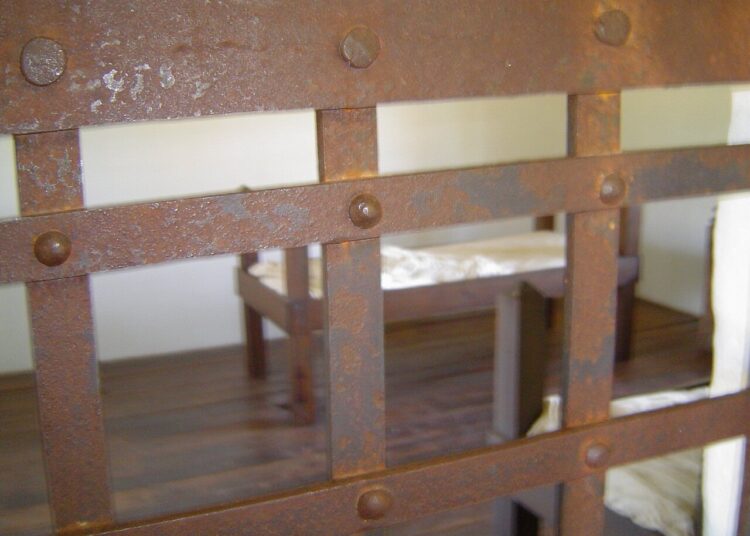Berlin/BRD. Eine kürzlich in Berlin geplante Diskussionsveranstaltung mit prominenten Referentinnen und Referenten, darunter die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, und die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Julia Duchrow, wurde zum Schauplatz eines beispiellosen Polizeieinsatzes. Ursprünglich sollte das Event zum Thema „Reclaiming the Discourse: Palestine, Justice and the Power of Truth“ an einem anderen Ort stattfinden, doch Behördenauflagen und massive politische Einflussnahme führten zur kurzfristigen Absage durch den Vermieter. Spontan erklärte sich die Tageszeitung junge Welt (jW) in der Berliner Torstraße bereit, ihre Räumlichkeiten zu öffnen.
Was folgte, war eine Demonstration staatlicher Macht: Mehr als 200 gepanzerte und bewaffnete Polizeikräfte rückten an, postierten sich rund um das Verlagsgebäude der jungen Welt und wollten sogar bewaffnete Uniformierte in den überfüllten Veranstaltungsraum – die jW-Maigalerie – entsenden. Nachdem dies von der jW-Geschäftsführung untersagt worden war, stufte der Einsatzleiter die Veranstaltung kurzerhand als „Versammlung in geschlossenen Räumen“ ein, um sich dennoch den Zutritt zu erzwingen. Offizielle Begründung: Man rechne mit „Äußerungsstraftaten“ aus dem Publikum.
Francesca Albanese zeigte sich entsetzt: „Druck, Einschüchterung und Mafia-Taktik“, so die UN-Beauftragte wörtlich. Sie kritisierte die offensichtliche Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Tatsächlich sorgten die mit Schusswaffen ausgerüsteten Polizeikräfte in und um das Haus für eine bedrohliche Einschüchterungskulisse, die nicht nur das Publikum, sondern auch die Referentinnen und Referenten im Auge behalten sollte.
Die junge Welt ist kein Neuling in Sachen staatlicher Repression: Das Verfassungsschutz-Kapitel widmet sich seit Jahren der Zeitung und versucht laut jW „ihr den Nährboden zu entziehen“. Neu ist allerdings das gewaltsame Eindringen bewaffneter Polizisten in die Redaktionsräume während einer öffentlichen Veranstaltung. So wurde hier eine weitere Grenze der Pressefreiheit überschritten: Journalistinnen und Journalisten, die über den Nahost-Konflikt kritisch berichten oder Veranstaltungen ermöglichen, werden offen unter Druck gesetzt.
Dass sich derlei Repression in ein größer werdendes Muster einfügt, zeigt auch das Vorgehen des israelischen Militärsprechers Arye Shalicar, der kurz nach dem Vorfall eine Liste „Top-10 Verbreiter von Judenhass auf X in Deutschland“ veröffentlichte. Darauf landen – neben dem Blogger Tilo Jung, der bei der Veranstaltung anwesend war – auch jW-Journalist Jakob Reimann. Das bizarre Kriterium: Zu viel Kritik an Israel und kein einziges Foto der an Israel übergebenen toten Geiseln geteilt zu haben. Hier wird deutlich, dass jegliche Abweichung von der proisraelischen Linie mit dem Stigma des Antisemitismus belegt werden soll.
Die jW kündigte an, gegen das gewaltsame Eindringen und den Zwangszutritt bis über das Ende der Veranstaltung hinaus Klage einzureichen. Für die Zeitung ist dies ein weiterer Schritt in einem langwierigen Kampf gegen die Einschränkung demokratischer Grundrechte. Trotz dieser einschüchternden Maßnahmen brachten viele Besucherinnen und Besucher dem Verlag ihre Solidarität zum Ausdruck.
Der offenbart einmal mehr die generelle Tendenz, palästinensische Solidaritätsveranstaltungen zu behindern oder zu kriminalisieren. Ob unter dem Vorwand von Sicherheitsbedenken, Antisemitismusvorwürfen oder vermeintlichen Äußerungsstraftaten – die Botschaft an alle, die Israels Kriegs- und Besatzungspolitik kritisieren, scheint klar: Staatliche Behörden sind bereit, mit Einschüchterung, Druck und Missbrauch von Definitionsmacht (Stichwort „Äußerungsstraftaten“) vorzugehen.
Genau deshalb bleibt es umso notwendiger, dass kritische Medien und Menschenrechtsorganisationen faktenbasiert die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten beleuchten und verstärkt auf das Leid der Zivilbevölkerung aufmerksam machen. Nur so kann verhindert werden, dass massive Repression und Einschüchterung letztlich einen offenen Diskurs unterdrücken.
Quelle: junge Welt