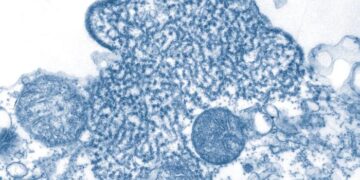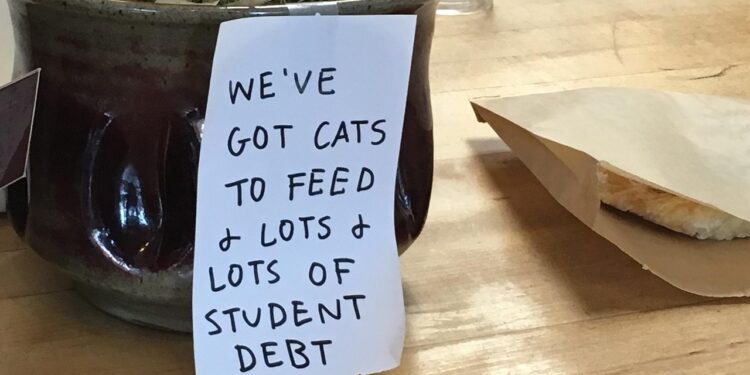In der aktuellen Debatte rund um die Besteuerung von Trinkgeldern in der Gastronomie ist viel von „Wertschätzung“, „Dankbarkeit“ und „Leistung muss sich lohnen“ die Rede. Landeshauptleute wie Mikl-Leitner, Stelzer oder Mattle überbieten sich mit Forderungen nach Steuererleichterungen – nicht für die arbeitenden Menschen, sondern für die Unternehmen, die sich allzu oft aus der Verantwortung für Löhne, die ein Leben ermöglichen, und gute Arbeitsbedingungen stehlen. Und auch wenn vereinzelt Stimmen anerkennen, dass Trinkgeld kein Ersatz für ordentliche Bezahlung sein darf, bleibt das Grundproblem unangetastet: In der Gastronomie werden Armutseinkommen durch Trinkgeld verschleiert.
Trinkgeld ist in Österreich längst nicht mehr nur ein „freiwilliger Bonus“ für besonders guten Service. Es ist de facto ein fester Bestandteil des Einkommens in der Gastronomie – auch aus purer Notwendigkeit für die Beschäftigten. Ohne Trinkgeld reicht der Lohn oft nicht zum Leben, das hat sich spätestens während Corona für viele gezeigt und die andauernde Teuerung verschärft diesen Tatbestand erneut. Vor allem in einer Branche, in der Teilzeitverträge, Split-Shift-Modelle und unplanbare Arbeitszeiten die Regel und nicht die Ausnahme sind. Wer in einem Schichtsystem arbeitet, das Pausen von mehreren Stunden zwischen Früh- und Spätdienst verlangt, kann sich schlecht für Kinder, Angehörige oder gar Freundschaften Zeit nehmen. Sozialleben, Familie, Gesundheit – all das bleibt auf der Strecke, damit andere am Samstagabend beim Candle-Light-Dinner bedient werden.
Wenn nun Politikerinnen und Politiker wie Mikl-Leitner das Trinkgeld als eine „unmittelbare Form der Leistungshonorierung“ bezeichnen, verkennen sie die Realität: Was hier romantisiert wird, ist in Wahrheit eine strukturelle Lohnsubventionierung durch die Gäste. Während die Unternehmer ihre Lohnkosten niedrig halten, füllen die Konsumentinnen und Konsumenten mit freiwilligen Zahlungen das Loch in der Brieftasche der Beschäftigten. Und die Bundesregierung soll diesen Zustand nun auch noch steuerlich belohnen? Das ist kein arbeitnehmerfreundliches Signal – das ist ein Kniefall vor der Hotellerie- und Gastronomielobby.
Selbst Tourismusstaatssekretärin Zehetner (ÖVP) stellt fest, dass sich gesetzlich nichts geändert habe, sondern lediglich die Prüfpraxis strenger geworden sei. Die eigentliche Schieflage liegt aber nicht bei der Abgabenprüfung, sondern in der Tatsache, dass Menschen in einem der reichsten Länder Europas nur dann überleben können, wenn sie auf steuerlich nicht erfasste Nebeneinkünfte angewiesen sind. Das ist kein „Signal der Wertschätzung“, das ist ein Skandal.
Wer es ernst meint mit Gerechtigkeit, darf sich nicht mit kosmetischen Maßnahmen wie steuerfreiem Trinkgeld begnügen. Was es braucht, sind flächendeckend höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten, planbare Dienste und die Abschaffung von arbeitsrechtlich fragwürdigen Modellen wie Split Shifts. Und zwar gesetzlich abgesichert – nicht als Almosen, sondern als Recht. Statt Steuererleichterungen für Betriebe, die von der Selbstausbeutung ihrer Belegschaften profitieren, braucht es endlich eine Politik im Interesse der arbeitenden Menschen. Trinkgeld mag ein freundliches Zeichen der Gäste sein – ein Ersatz für gerechte Entlohnung ist es nicht. Und Altersarmut verhindert es auch nicht.
Quelle: ORF
.