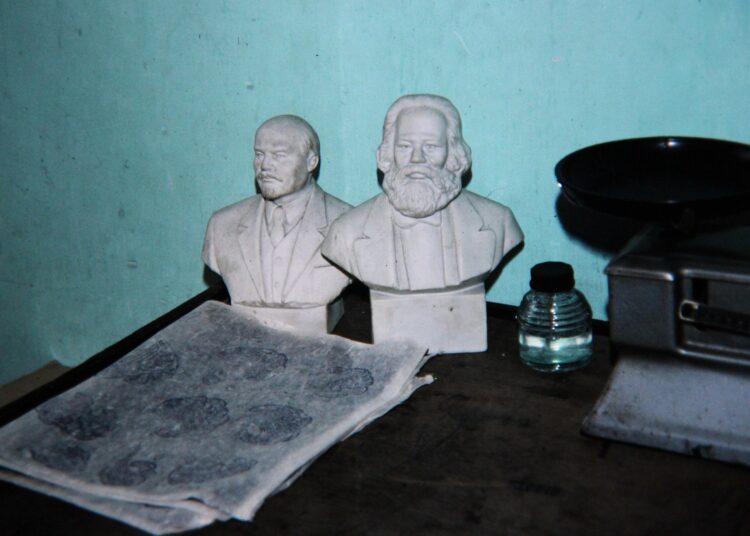Der 28. Oktober 1940 markiert den Beginn des italienisch-griechischen Krieges. Griechenland wurde damit ebenfalls in den zweiten imperialistischen Krieg hineingezogen. An diesem Tag überreichte der italienische Botschafter in Athen, Emmanuele Grazzi, dem faschistischen Diktator Ioannis Metaxas ein Schreiben seines italienischen Kollegen Benito Mussolini. Mussolini forderte darin das Recht strategisch wichtigen Punkten des Landes Militärstützpunkte zu errichten bzw. zu besetzen. Metaxas lehnte das ab und es kam in der Folge zum italienischen Angriff auf Griechenland. Für die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) markiert das Datum den Beginn einer neuen Etappe des Klassenkampfs – einer Epoche, in der die arbeitende Bevölkerung selbst zum Subjekt der Geschichte wurde. In einer Erklärung zum 85. Jahrestag spricht die KKE von einem zentralen Ereignis der griechischen Geschichte, das sowohl den imperialistischen Charakter des Zweiten Weltkriegs als auch den Beginn der heroischen Volksbewegung für Freiheit und soziale Emanzipation markierte.
Der 28. Oktober als Wendepunkt: Der Krieg des Volkes
Der italienische Angriff auf Griechenland war das Ergebnis, des vom deutschen und italienischen Faschismus begonnen Krieges um die (Neu-)Aufteilung der Welt unter dem Monopolkapital. Die griechische Bourgeoisie war stark britisch orientiert und der einer deutsch-italienischen Dominanz im Mittelmeer im Weg und zudem von strategischer Bedeutung für einen möglichen Sprung in den Nahen und Mittleren Osten.
Unter den Bedingungen der Besatzung formierte sich, geführt von der KKE, das Nationale Befreiungsfront (EAM), die Volksbefreiungsarmee ELAS und die Jugendorganisation EPON. Diese Organisationen wurden zur Grundlage eines umfassenden gesellschaftlichen Umbruchs: In den befreiten Gebieten entstanden Volksgerichte, Bildungseinrichtungen und Strukturen sozialer Selbstverwaltung.
Die Partei bezeichnet diese Phase als die Zeit, in der „die Arbeiterinnen und Arbeiter, die armen Bäuerinnen und Bauern, die Jugendlichen und Frauen der arbeitenden Familien mit Macht auf die Bühne der Geschichte traten“. Der antifaschistische Kampf war für sie nie nur militärisch – er war der Versuch, eine neue gesellschaftliche Ordnung zu schaffen.
Von EAM zu DSE: Keine nationale Einheit, sondern Klassenantagonismus
Die KKE lehnt die verbreitete Vorstellung ab, dass die 1940er-Jahre eine Phase nationaler Einheit gewesen seien, die erst durch den Bürgerkrieg zerbrach. Tatsächlich gab es nie eine gemeinsame nationale Front, sondern von Beginn an zwei entgegengesetzte Seiten: das Volk, das für seine Befreiung kämpfte, und die herrschenden Klassen, die sich mit den imperialistischen Mächten verbanden und in den Jahren der italienischen und deutschen Besatzung mit diesen kollaborierte.
Schon während der Befreiung 1944 entstanden revolutionäre Bedingungen: Der alte Staatsapparat war zusammengebrochen, in den befreiten Gebieten dominierten die Volksorgane des EAM-ELAS. Doch die Partei, wie sie später selbstkritisch festhält, „nutzte diese Bedingungen nicht für eine geplante sozialistische Revolution“. Stattdessen akzeptierte sie die Bildung einer „Nationalen Einheitsregierung“ und unterwarf ihre Streitkräfte dem britischen Kommando. Bereits im Dezember 1944 kam es zum bewaffneten Kampf der ELAS mit den britischen Truppen und Nazi-Kollaborateuren in der Schlacht um Athen. Die Schlacht endete angesichts der massiven militärischen Eingreifen der britischen Armee schließlich am 11. Jänner 1945 mit einem Einlenken von EAM und ELAS und dem Abkommen von Varkiza, das eine Entwaffnung der ELAS beinhaltete. Das Abkommen schuf zugleich die Basis für die Wiederbewaffnung faschistischer Kollaborateure und einen massenhaften Terror gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten sowie Kommunistinnen und Kommunisten.
Diese strategische Linie war beeinflusst von der Politik der Kommunistischen Internationale und den damaligen Vorstellungen einer „Volksdemokratie“. Am Ende führte sie zur Niederlage der Volksbewegung im Dezember 1944 und bereitete den Boden für den erneuten bewaffneten Kampf.
Am 28. Oktober 1946, sechs Jahre nach Mussolinis Angriff, wurde das Generalkommando der Demokratischen Armee Griechenlands (DSE) gegründet. Die KKE bezeichnet den DSE als „Volksarmee“, die aus der Erfahrung der ELAS hervorging und die „höchste Form des Klassenkampfs“ in der griechischen Geschichte darstellte.
Aris Velouchiotis: Die Verkörperung der revolutionären Kontinuität
In keiner Figur verdichten sich diese Jahre so stark wie in Aris Velouchiotis (Athanasios Klaras), dem „ersten Hauptmann“ der ELAS. Auf Beschluss der Partei organisierte er ab 1942 den bewaffneten Widerstand in den Bergen Zentralgriechenlands. Seine Einheiten führten spektakuläre Aktionen durch, darunter die Sprengung der Gorgopotamos-Brücke – ein taktischer Schlag gegen die Nachschubwege der Achsenmächte und zugleich Symbol der Möglichkeiten des Volkswiderstands.
Nach der Befreiung Griechenlands 1944 widersetzte sich Velouchiotis dem Abkommen von Varkiza, das die Entwaffnung der ELAS vorsah. Er sah darin die Unterordnung des Volkswiderstands unter die restaurierte des Kapitalismus und der bürgerlichen Ordnung, unterstützt von Großbritannien. Velouchiotis ging mit Genossinnen und Genossen erneut in die Berge, um den bewaffneten Kampf wieder aufzunehmen. Im Juni 1945 wurde seine kleine bewaffnete Gruppe in Mesounda (Arta) umzingelt und von der bürgerlichen Armee getötet. Ihre Leichen wurden entweihte und Aris und seinen Kameraden die Köpfe abgeschlagen, die auf dem zentralen Platz der Stadt Trikala aufgehängt wurden. Sein Ausschluss aus der Partei 1945 wurde in späteren Jahrzehnten als politischer Fehler anerkannt. 2011 und endgültig 2018 rehabilitierte die KKE Velouchiotis vollständig.
In ihrer Ehrung von 2015 sagte der Generalsekretär Dimitris Koutsoumpas: „Aris war Kommunist. Er blieb der Partei, ihrer Ideologie und ihren Idealen treu bis zu seinem letzten Atemzug.“ Velouchiotis gilt der Partei bis heute als Symbol jenes revolutionären Potentials, das in der Varkiza-Politik nicht eingelöst wurde.
Die Demokratische Armee: Klassenkampf mit militärischen Mitteln
Der Kampf der Demokratischen Armee Griechenlands (DSE) war Ausdruck der Interessen der arbeitenden Klassen gegen ihre Ausbeuter und Unterdrücker. Tausende Männer und Frauen kämpften unter schwierigsten Bedingungen gegen die reguläre Armee, die von Großbritannien und später den USA ausgerüstet und geführt wurde.
Die KKE hebt hervor, dass der DSE nicht nur militärisch, sondern auch politisch und gesellschaftlich organisiert war: In den von der Demokratischen Armee befreiten Gebieten wurden Volksräte, Schulen, Frauenorganisationen und sogar eigene Krankenhäuser in den Bergen von Grammos und Vitsi geschaffen. Erstmals in der griechischen Geschichte wurde auch das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Ein Viertel der Kämpfenden waren außerdem Frauen, von denen über tausend Offiziersränge erreichten – ein revolutionäres Novum in einer Zeit, in der Frauen im restlichen Griechenland noch kein Wahlrecht besaßen.
Die Partei würdigt die DSE-Kämpferinnen und ‑Kämpfer als „Armee von Heldinnen und Helden“, deren Selbstaufopferung nicht nur militärische, sondern moralische und politische Bedeutung habe.
Zugleich betont sie, dass der DSE an objektiven und subjektiven Schwächen scheiterte – vor allem an der fehlenden ideologisch-strategischen Klarheit und an der militärischen Übermacht der westlichen Mächte. Die Niederlage sei jedoch keine moralische Niederlage, sondern Beweis für den revolutionären Charakter der Bewegung: ein unvollendetes Kapitel des Klassenkampfs.
Selbstkritik und theoretische Schlussfolgerungen
Die KKE ist seit vielen Jahren eine jener wenigen Kommunistischer und Arbeiterparteien, die ihre eigene Geschichte auch im Zusammenhang mit der Geschichte der internationalen Kommunistischen Bewegung kritisch untersucht und aufarbeitet ohne dabei den Marxismus-Leninismus aufzugeben. Auch die Geschichte der Partei in den 1940er-Jahre hat sie in mehreren Kongressdokumenten und historischen Untersuchungen aufgearbeitet. Besonders die Resolutionen zum „sozialistischen Aufbau im 20. Jahrhundert“ zieht daraus grundlegende Lehren. Diese Arbeiten kommen dabei allerdings nicht aus dem nichts, so wurde beispielsweiße schon 1978 ein Gastbeitrag von Harilaos Florakis, damals erster Sekretär beim ZK der KKE, in Weg und Ziel, der Theoriezeitung der KPÖ, zur EAM und der Befreiung veröffentlicht. In diesem Beitrag legte er dar, dass die Niederlage 1944/45 im wesentlichen das Ergebnis von falschen Auffassungen in der Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften und einer falschen und naiven Einschätzung des britischen Imperialismus war, weil dieser der Anti-Hitler-Koalition angehörte.
Die Partei bekennt, „mit offenen Augen“ auf ihre Geschichte zu blicken – nach Lenins Aufforderung, „der Wahrheit nicht auszuweichen“. Heute hat die KKE ihre Kritik an der ihrer damaligen Politik noch weiter vertieft und auch in den Zusammenhang mit der Politik der internationalen kommunistischen Bewegung zur damaligen Zeit gestellt. Als eine Ursache des Scheiterns 1944 wird auch in der Strategie der Volksfront, also Bündnissen mit „demokratischen“ Teilen der Bourgeoisie, angesehen. Diese Illusion habe die Arbeiterbewegung in Griechenland wie in anderen Ländern daran gehindert, die revolutionäre Situation zu nutzen.
In Anknüpfung an diese Selbstkritik betont die KKE heute, dass die Arbeiterklasse die Macht nicht teilen könne – auch nicht mit kleinen selbständigen Schichten oder angeblich „fortschrittlichen“ Teilen des Bürgertums. Die Lehre aus dem EAM- und DSE-Erlebnis sei eindeutig: „Die Arbeiterklasse teilt die Macht mit niemandem.“
Quelle: 902.gr/KKE/KKE/KKE/KKE/Weg und Ziel