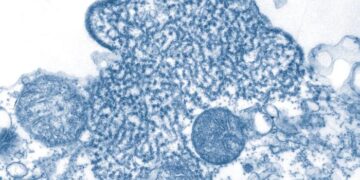Buenos Aires. Während in San Isidro das Verfahren wegen möglicher fahrlässiger Tötung gegen Diego Maradonas Ärzte- und Pflegeteam läuft, richten wir unseren Blick bewusst auf das Leben einer Fußballlegende, in dessen Biografie sich auf außergewöhnliche Weise Sport, Armut, Weltruhm, Skandale und politisches Engagement vereinen.
Vom Slum ins Rampenlicht
Geboren am 30. Oktober 1960 in Lanús, wuchs Diego Armando Maradona Franco in einer Slumsiedlung namens „Villa Fiorito“ am Rand von Buenos Aires auf. Seine Eltern, die in bitterer Armut lebten, konnten kaum Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben – wäre da nicht dieses scheinbar unvergleichliche Talent ihres Sohnes im Straßenfußball gewesen. Von Scouts der Argentinos Juniors entdeckt, schaffte Maradona früh den Sprung aus dem Slum aufs Grün. Schon als Neunjähriger erhielt er eine gezielte Ausbildung im Klub. Seine Tricks, Schnelligkeit und Spielübersicht erlernte er vor allem im harten Milieu der Elendsquartiere, wo sich niemand selbst schonen konnte. Mit 15 Jahren debütierte er in der ersten argentinischen Liga – in einer Phase, als das Land unter der Militärdiktatur Jorge Videlas litt.
Die große Bühne: Boca, Barcelona, Napoli
Rasch verließ Maradona den vergleichsweise bescheidenen Club Argentinos Juniors und unterschrieb bei Boca Juniors, dem Arbeiter- und Migrantenverein aus dem Viertel „La Boca“. Dort wurde er sofort zum Publikumsliebling. Noch während der argentinischen Diktatur führte er die „Bosteros“ zum Meistertitel und bestritt 1982 seine erste Weltmeisterschaft in Spanien. Anschließend wechselte er in die spanische Liga: Zwei Jahre beim FC Barcelona verliefen jedoch unglücklich, da Verletzungen und Hepatitis ihn ausbremsten. Seinen größten Erfolg auf Klubebene fand er dann in Italien beim SSC Napoli: Bis dahin ein eher randständiger Klub, stürmte er den Thron der Serie A, gewann gleich zwei Meistertitel und den UEFA-Cup. In diesen neapolitanischen Jahren, zwischen 1984 und 1991, wuchs Maradona zur unangefochtenen Fußballikone, die den Süden Italiens gegen die mächtigen Nordklubs (Juventus, Mailand) verteidigte. Bis heute verehrt man ihn dort fast gottgleich.
Die Krönung: Weltmeister 1986
International wurde Maradona endgültig unsterblich durch die WM 1986 in Mexiko. Als Mannschaftskapitän führte er Argentinien zum Titel, besiegte im Viertelfinale die Engländer mit zwei ikonischen Toren: die berühmte „Hand Gottes“ und einen Sololauf über fast das gesamte Spielfeld. Im Finale gegen die BRD spielte er den entscheidenden Pass zum 3:2. Trotz alledem blieb Maradona ein Spieler aus einfachen Verhältnissen, der abseits des Platzes mit Partyexzessen, Kokainmissbrauch und kriminellen Entourage-Kontakten zu kämpfen hatte.
Antiimperialist mit Che-Tattoo
Gerade aus seinen Erfahrungen mit Armut zog Maradona den Schluss, dass er sich an der Seite der Unterdrückten zu positionieren habe. Besonders seine zeitweise Entziehungskur in Kuba führte ihn in die Nähe von Fidel Castro – Maradona trug dessen Gesicht als Tattoo auf seinem Bein. Ebenso ehrte er Che Guevara, den argentinischen Revolutionär, dessen Konterfei er auf dem Oberarm tätowieren ließ. Er blieb bis zu seinem Tod ein ausgesprochener Kritiker des US-Imperialismus, bewunderte die Regierungen von Hugo Chávez in Venezuela und Evo Morales in Bolivien und ordnete sich selbst der lateinamerikanischen Linken zu. Zwar war Maradona selten ein disziplinierter Theoretiker, doch er repräsentierte authentisch jenes widerständige und klassenbewusste Element, das aus den Armensiedlungen stammte und sich weder vom Establishment noch von Konzerngiganten vereinnahmen lassen wollte.
Doping, Skandale, Comeback
Ende der 1980er begann die Karriere Maradonas zu bröckeln – 1991 flog er in Italien wegen Kokainkonsums auf. Nach einer 15-monatigen Sperre versuchte er es bei FC Sevilla, später bei den Newell’s Old Boys. Noch einmal flammt sein Fußballer-Genie bei der WM 1994 in den USA auf, bis ein weiterer positiver Dopingtest (diesmal Ephedrin) das argentinische Team ohne ihren Kapitän zurückließ. 1997 beendete Maradona seine aktive Laufbahn bei Boca Juniors. Anschließend versuchte er sich als Trainer (Argentinien, 2008–2010), blieb aber in seinen Engagements meist erfolglos. Ihm haftete zunehmend das Image des Skandalstars an, der sein Talent verschwendet.
Tod inmitten gesundheitlicher Baustellen
Am 25. November 2020 starb Maradona nach einem Herzinfarkt. Eine Vielzahl von Organschäden (u.a. Leberzirrhose, Herzschwäche) sowie eine Kette unzureichender medizinischer Eingriffe deuteten darauf hin, dass seine Ärzte und Pfleger versagt haben könnten. Der nun laufende Prozess um fahrlässige Tötung soll klären, ob dem legendären Spieler nicht die nötige Versorgung geboten wurde. Neueste Befunde aus Argentinien belegen, dass keine Drogen oder Alkohol in seinem Blut nachweisbar waren – stattdessen fand man Spuren von Antidepressiva und Epilepsie-Medikamenten.
Diego Armando Maradona Franco – presente!
Die Geschichte Maradonas ist mehr als nur ein Fußballmärchen. Sie ist das Porträt eines Genies, das sich vom armen Vorstadtkind zur Weltikone hochspielte, das aber genauso rücksichtslos an Verlockungen und Zwängen des profitorientierten Spitzensports zerbrach. Auch in der Politik verewigte sich Maradona: Er stellte sich klar gegen Imperialismus, war ein enger Freund Kubas und ihres revolutionären Erbes. So lebt „El Diez“ (Die Zehn) weiter als Symbol für das Unwahrscheinliche, das manchmal in den Gassen eines Slums heranwächst und die Welt erobert – doch auch als Beispiel dafür, wie brutal das System einen Ausnahmespieler letztlich vereinnahmt und zerstört.
Hätte es den millionenschweren Fußballstar Diego Maradona ohne den Kapitalismus der Global Player gegeben? Wahrscheinlich nicht. Aber hätte Maradona eine friedlichere Lebensgeschichte haben können, wäre er in einer Gesellschaft geboren, die nicht Slums und Ausweglosigkeit produziert, sondern alle Talente fördert, ohne sie auszuplündern und in Abhängigkeiten zu treiben? Darauf findet man bei seiner Biografie wohl eine klare Antwort. Trotz aller Tragik: Maradonas Vermächtnis lebt weiter – auf dem Rasen, in den Herzen und in seinem politischen Erbe. Er galt als einer der größten Spieler aller Zeiten, doch er wollte stets mehr sein: ein freiheitsliebender Mensch mit tiefen Wurzeln in Armut und Widerstand.
Quelle: ORF / Zeitung der Arbeit