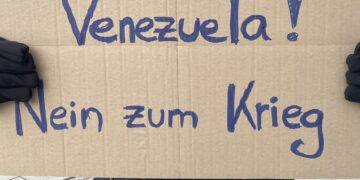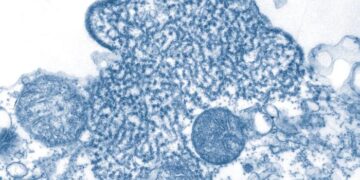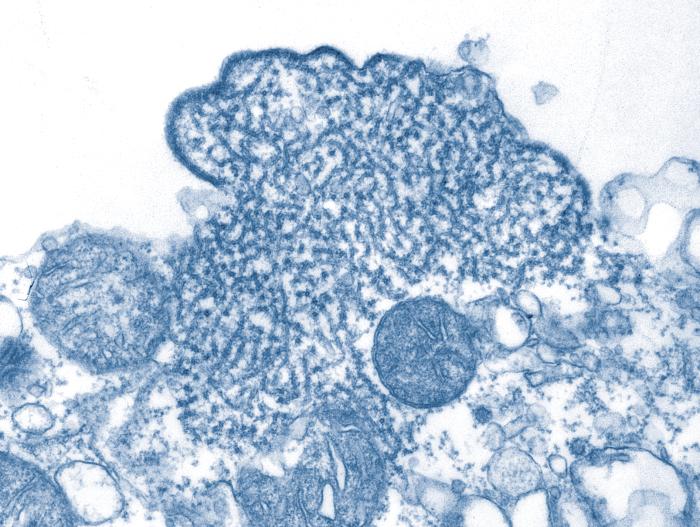Die Goldindustrie in Simbabwe ist ein besonders ausbeuterischer Wirtschaftszweig, die Profite fließen an die Kompradorenbourgeoisie und ins Ausland. Nun starben bei einem Mineneinsturz wieder mindesten 13 Arbeiter.
Harare. Beim Einsturz einer Goldmine in Simbabwe sind gemäß Regierungsangaben mindesten 13 Bergleute getötet worden. Insgesamt 34 Arbeiter befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks am vergangenen Freitag unter Tage, nur 21 davon konnten lebend gerettet werden – für neun Männer kam jede Hilfe zu spät. Dies lag auch mangelnden Ressourcen der Bergungs- und Katastrophenschutzeinheiten, wie deren Sprecher sagte.
Die betroffene Goldmine bei Chegutu, etwa 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Harare, war eigentlich bereits stillgelegt worden und somit offiziell geschlossen. Die Bergleute, die während des nunmehrigen Einsturzes bei der Arbeit waren, handelten auf eigene Faust, also „illegal“, wenn man so möchte. Dazu muss wissen, dass die Region um Chegutu von besonderer Armut und massiver Arbeitslosigkeit geprägt ist, viele Menschen sind auf kleine Subsistenzlandwirtschaft angewiesen. Die verunglückten Männer nahmen die Gefahren des eigenständigen Bergbaus also deshalb in Kauf, weil sich ihnen und ihren Familien kaum andere Erwerbs- und Überlebensalternativen bieten.
Allerdings muss man auch offiziellen Bergbauunternehmungen in Simbabwe – seien sie nun vom Staat oder von internationalen Konzernen betrieben – mangelnde Sicherheitsvorkehrungen attestieren, weil hierfür zu wenig investiert wird. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit ist jeder „Arbeitskräfteausfall“ leicht zu kompensieren. Tödliche Grubenunglücke sind insofern wiederkehrende Ereignisse in Simbabwe. Das verheerendste ereignete sich 1972, als 427 Bergleute in einem Steinkohlebergwerk bei Hwange starben.
Quelle: ORF