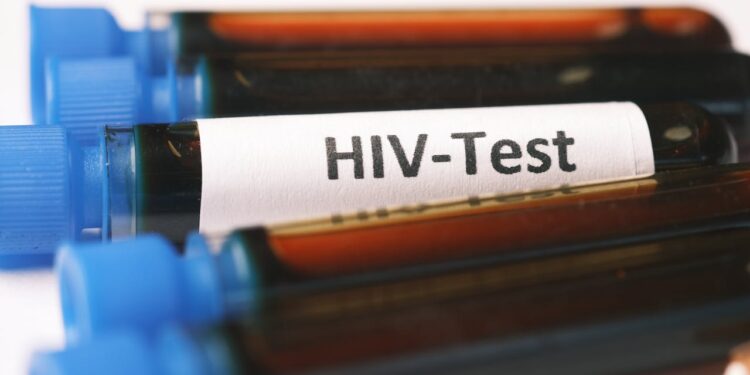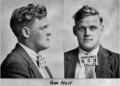In Europa wird HIV weiterhin massenhaft zu spät erkannt – laut ECDC und WHO bei 54 Prozent aller Neuinfektionen im Jahr 2024. Mehr als die Hälfte also erst dann, wenn die Krankheit längst begonnen hat, Körper zu zerstören. Knapp 106.000 neue Diagnosen in der WHO-Region Europa, über 24.000 davon allein im Europäischen Wirtschaftsraum – das ist keine medizinische Randnotiz, sondern ein systemisches Versagen mit Ansage.
Doch wer trägt die Verantwortung? Oft ist von „mangelnder Vorsorge“, „fehlendem Problembewusstsein“ oder „individuellen Risiko“ die Rede. Dass Gesundheitsversorgung aber auch im reichen Europa längst dem Spardiktat, der Profitlogik und der Klassenlage unterworfen ist, wird ausgeblendet. Frühdiagnostik kostet Geld. Prävention bringt keine Dividende. Und eine gut ausgestattete, niederschwellige Gesundheitsversorgung für alle rechnet sich schlecht in den Bilanzen.
Wer arm ist, wer keine Krankenversicherung hat, wer ohne gesicherten Aufenthaltsstatus lebt, wer sich zwischen Miete, Essen und Arztbesuch entscheiden muss, landet statistisch häufiger in der Kategorie „späte Diagnose“. Dass das Virus sich nicht an Marktlogik hält, der Zugang zur Medizin aber sehr wohl, gehört zu den unausgesprochenen Grundregeln des Systems.
Während die WHO weiterhin das Ziel ausruft, Aids bis 2030 als Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu beseitigen, arbeitet der Kapitalismus mit beeindruckender Konsequenz am Gegenteil. Die einen produzieren Unsicherheit, Armut, Ausgrenzung und prekäre Lebensverhältnisse, die anderen zählen danach die „zu späten Diagnosen“. Dass beides zusammenhängt, will man nicht hören – denn dann müsste man über Eigentumsverhältnisse reden statt über Hochglanz-Kampagnen.
Die medizinischen Möglichkeiten wären da: HIV ist heute gut behandelbar, ein langes Leben ist bei frühzeitiger Therapie möglich. Dass trotzdem über die Hälfte der Fälle zu spät erkannt wird, ist kein medizinisches Problem, sondern ein Klassenproblem. Wer früh zum Test kommt, lebt; wer zu spät kommt, verschwindet in der Statistik – oder auf der Intensivstation.
So sieht sie aus, die europäische Gesundheitsunion im Jahr 2024: Hochtechnologie für jene, die es sich leisten können, und verspätete Diagnosen für jene, die im System nur als Kostenfaktor vorkommen.
Quelle: ORF