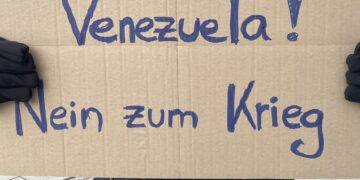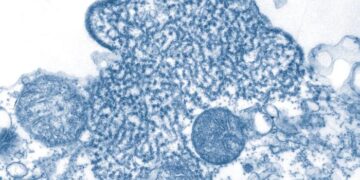Gastkommentar: Gerhard Oberkofler, geb. 1941, Dr. phil., Universitätsprofessor i.R. für Geschichte an der Universität Innsbruck.
Kindheit und Jugend einer jüdischen Revolutionärin (1910 bis ca. 1933)
In Petersburg
Ende der 1950er Jahren hat Jean Paul Sartre (1905–1980) zeitgenössischen Marxisten vorgehalten, sich nur mit Erwachsenen zu befassen. Der Hintergrund für diese existentialistische Vorhaltung war, dass es intellektuelle Mode geworden war, den „jungen“ Karl Marx (1818–1883) dem „alten“ Marx gegenüberzustellen.[1] Diese Rückerinnerung an den Existentialismus ist nicht der Anstoß zur Beschäftigung mit Kindheit und Jugend von Eva Priester, vielmehr soll die Gelegenheit wahrgenommen werden, der Frage nachzugehen, wie früh im Leben sich Optionen für einen realen Humanismus zeigen können.
Eva Priester ist als Eva Beatrice Feinstein am 15. Juli 1910 in St. Petersburg als Einzelkind von Ljuba Feinstein geborene Wolpe und Salomon Feinstein geboren. Über die Familie ist nur wenig bekannt, die Mutter hat, weil Frauen an den russischen Universitäten nicht zugelassen waren, an der Sorbonne studiert, der Vater war hochqualifizierter Techniker. Der Name Feinstein war unter Ostjuden ein verbreiteter Name. Die Petersburger Feinsteins gehörten zur säkularen jüdisch bürgerlichen Oberschicht, die mit ihrer jüdischen Religion ebenso wenig anfangen konnte, wie mit dem verordneten russischen Patriotismus oder der seit 1893 sich verbreitenden politischen und nationalen Idee, dass die Juden ein Volk seien (Zionismus). Aber das Judentum bleibt im Leben der Familie Feinstein präsent, formte die psychosomatischen Strukturen von Eva Priester und zog sie zeitlebens in die historische Realität hinein. Ihre fragmentarisch erhalten gebliebenen Kindheitserinnerungen hat Eva Priester um 1940/1941 in Großbritannien konzipiert.[2] Diese sind keine kohärente Erzählung, bringen aber Impressionen, die da und dort erhellen, wie die privilegierte jüdische Intelligenz in Petersburg lebte und war ihr wichtig war. Eva Priester beginnt mit einem Blick auf ihr Zuhause:
„Wenn meine Mutter jemandem ihre Adresse gab, vergaß sie selten hinzuzufügen: >Es ist nur fünf Minuten vom Newski-Prospekt. Und um die Ecke ist die Fontanka[3]<. Unsere Gegend war eine sogenannte gute Wohngegend und der Newski-Prospekt war Petersburgs Prunkstraße. Links vom Haus war eine Kirche und gegenüber ein Obstmarkt. So roch es im Herrenzimmer immer nach Weihrauch und im Wohnzimmer mit den roten Ledermöbeln nach Leder und nach Wassermelonen. In alten Häusern ringsum gab es Wohnungen und Souterrainwohnungen. In den Wohnungen lebten Menschen wie meine Eltern, in den Souterrainwohnungen lebten die armen Leute, Schuster, Schneider, Markthändler, Tartaren, die mit bunten Teppichen hausieren gingen. Arbeiter sah man in unserer Gegend fast nie. Sie lebten in einem anderen Teil der Stadt, jenseits der Newa. Die Fenster der Souterrainwohnungen lagen nur zu einem kleinen Stück oberhalb des Straßenpflasters. Es war dort fast immer dunkel und dumpfig, und man konnte nur die Füße der Vorübergehenden sehen. Mittags, wenn ich vom Spazierengehen zurückkam, versuchte ich immer in die Fenster hineinzuschauen. Manchmal, wenn es ein sehr heller Tag war, sah ich die Leute im Zimmer. Es waren immer sehr viele, und meistens saßen sie um diese Zeit beim Essen. Sie aßen Suppe aus Emailschüsseln und Brot dazu. Ich habe oft zur Mittagszeit hineingeschaut und hab sie niemals etwas anderes essen sehen als Suppe und Brot, auch sonntags. Noch für lange Zeit verband sich für mich der Begriff >arm sein< mit Wohnen in einem Zimmer, das nach Kraut und alten Kleidern riecht und wo man vom Fenster aus auf die Füße der Vorübergehenden sieht und damit, dass man mittags immer nur Suppe bekommt.“
St. Petersburg[4], dessen Grundstein mit der Peter-Pauls-Festung 1703 gelegt und von Architekten unterschiedlicher Herkunft planmäßig aufgebaut worden war, ist seit 1712 mit seinem Hafen Metropole des zaristischen Russlands und blieb das bis nach der Oktoberrevolution. Die historische Innenstadt ist geprägt von über 2000 Palästen, Prunkbauten und Schlössern. Im Newski-Bezirk, dessen Zentrum St. Petersburg ist, gab es zu Anfang des 19. Jahrhunderts technisch moderne Fabriken und Manufakturen wie eine Russisch-amerikanische Maschinenfabrik, ein Armaturenwerk, eine Waggonfabrik oder eine Schwellen-Imprägnierungs-Fabrik. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal, Arbeiter wurden bei Hungerlöhnen wie Tiere ausgebeutet, Fabrikskasernen mit Schlafsälen waren verbreitet, Frauen- und Kinderarbeit waren die Regel. Der russische Weltrevolutionär Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924), den Albert Einstein (1879–1955) als „Hüter und Erneuerer des Gewissens der Menschheit“ bezeichnete,[5] hat in St. Petersburg gewohnt und sich dort mit dem modernen kapitalistischen Imperialismus in einem schier vorkapitalistischen Umfeld befasst.[6] 1924 bis 1991 hat St. Petersburg mit dem Namen Leningrad an Lenin erinnert. Leningrad als Stadtname wird heute wieder in die Vergessenheit gedrängt und damit auch die ungeheuren Grausamkeiten des deutschen Aggressors, der diese sowjetische Metropole, in der etwa 3 Millionen Menschen vom Säugling bis zum Greis wohnten, von Anfang September 1941 an fast 900 Tage bis zum Jänner 1944 bombardierte, beschoss und blockierte. Leningrad sollte ausgehungert und dem Erdboden gleichgemacht werden.[7]
Maxim Gorki (1868–1936) spürte vor der Oktoberrevolution, dass es mit dem Raubkapitalismus in Russland nicht weitergehen könne. Gorki erinnert in seiner autobiographischen Erzählung „Meine Universitäten“ an die Verse von Nikolaj Berg (1823–1884): „In dem heiligen Russland krähn die Hähne schon, / In dem heiligen Russland graut der Morgen bald …“.[8] Von den Putilow Werken ausgehend kam es Anfang Jänner 1905 in Petersburg zu einem Generalstreik. Die vor der Residenz des despotisch regierenden Zaren Nikolaus II. (1868–1918) am 9. Jänner 1905 friedlich demonstrierenden Arbeiterinnen und Arbeiter wurden mit ihren Frauen und Kindern von den zaristischen Truppen mit Gewehrsalven niedergeschossen oder von den im Sold des Zaren stehenden Kosaken niedergesäbelt. Hunderte Menschen wurden an diesem Blutsonntag getötet. Bis 1907 kämpfte das russische Proletariat mit seinen revolutionären Kräften und Bauern gemeinsam für seine Befreiung.[9] Die Bourgeoisie dachte und handelte konsequent konterrevolutionär. Ihre eigenen Klagen über die wenig vornehmen Züge der zaristischen Autokratie waren keine Grundlage, sich an der Notwendigkeit der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft, die ihr Privateigentum an den Produktionsmitteln in Frage stellte, in irgendeiner Weise zu beteiligen.
Der Vater von Eva Priester Salomon Feinstein war ausgebildeter Techniker und wird wahrscheinlich im ganzen Zarenreich tätig gewesen sein. Die wissenschaftlichen Institute in Petersburg waren auf höchstem Niveau und haben den dort ansässigen wissenschaftlichen Technikern viele Anregungen gegeben haben. Die Elendsviertel dieser Stadt, wie sie Fjodor Dostojewski (1821–1881) in „Schuld und Sühne“ 1866 schildert, waren den Feinsteins außerhalb ihrer Sichtweite, es war ebenso. Dieses bewusste Wegschauen trifft auf alle reichen und parasitären Schichten der europäischen Städte zu, damals wie heute. Es ist das gesellschaftliche Sein, es sind die materiellen Verhältnisse, die, wie Karl Marx und Friedrich Engels (1820–1895) nachgewiesen haben, das Bewusstsein bestimmt. Die Feinsteins hatten, wie es sich versteht, ein Sommerhaus in der Nähe des baltischen Meerbusens, an das sich Eva Priester gerne erinnerte. Jeder Petersburger, der es sich leisten konnte, also nicht Angehörige der Arbeiterklasse, ging auf „Sommerfrische“, um dem „Sommergestank“ zu entkommen.[10] Im Sommer 1917 wurde Eva Priester auf Sommerfrische von einer Gouvernante aus Köln namens Helena Harlovna in deutscher Sprache unterrichtet. Das entsprach der Tradition der jüdischen, mit Mendelssohn verbundenen Aufklärung, die von den jüdischen Schulen den Unterricht in Französisch und Deutsch einforderte.[11] Im Salon der elterlichen Stadtwohnung empfing die schöngeistige Mutter von Eva Priester Damen aus jener Gesellschaft, der sie selbst angehörte. Einer dieser Damen machte auf das heranwachsende Mädchen Eva Priester einen bleibenden Eindruck:
„Berta rauchte und konnte rauchen. Die anderen zündeten sich manchmal eine Zigarette an, bliesen hinein, husteten und legten sie nach einigen Zügen mit tränenden Augen weg. Berta war die schönste, reichste und erfolgreichste unter den Frauen.“
Zu dieser Schlussfolgerung kommt Eva Priester, weil sie Berta über deren Ehemann identifizierte, der Fabrikant und Gutsbesitzer war und darüber hinaus auch Konsul eines osteuropäischen Staates in Petersburg. Zu den von Berta gegebenen Gesellschaften seien Balletttänzer gekommen, die jene Rolle einnahmen, die später Filmstars, Bankiers oder Duma-Abgeordneten zukam, manchmal sei auch ein Großfürst gekommen. Im Rückblick auf die Jüdin Berta beschreibt Eva Priester die Ausrichtung des im zaristischen Russland herrschenden Unterdrückungssystems mit seinen administrativen Auswirkungen auf die Masse der Juden, also den armen Juden:
„Berta stand ganz oben auf der Spitze jener Hierarchie russischer Juden, für die Judenpogrome und Numerus Clausus auf der Universität, Schikanen von Subalternbeamten und die ganze antisemitische Politik des alten Russlands nicht mehr vorhanden waren. Der zaristische Antisemitismus war ein Antisemitismus gegen die armen Leute. Von einer bestimmten Einkommensgrenze, von einer bestimmten Bildungsstufe aufwärts, hörte er auf. Es gab zwei administrative Beschränkungen, die die Juden Russlands besonders hart trafen, die Ansiedlungsverordnungen und der Numerus Clausus auf Gymnasium und Universität. Die Ansiedlungsverordnungen zwangen tausende von jüdischen Leuten, nicht dort zu wohnen, wo sie wollten, sondern dort, wo es die Polizeibehörden ihnen anwiesen. Um in einen anderen Ort zu übersiedeln, um eine größere Reise zu machen, brauchte man eine besondere Erlaubnis, die sehr schwer zu bekommen war – außer man hatte genug Geld, um einen oder mehrere Beamte zu bestechen. Durch den Numerus Clausus wurde nur eine ganz beschränkte Zahl von jüdischen Kindern auf die höheren Schulen zugelassen und auch das erst nach einer sehr strengen Prüfung, einem langen, demütigenden Instanzenweg und oft wieder mit Bestechung. Aber wenn jemand ein Universitätsstudium erreicht hatte, fielen alle Beschränkungen weg.“
Jene Juden, die es geschafft hatten, konnten, so erzählt Eva Piester, in Petersburg oder in anderen Hauptstädten gut leben, dort habe es keine organisierten Pogrome gegeben, wohl aber auffällige Zwischenfälle durch betrunkene Soldaten oder Mitglieder der „Schwarzen Hundertschaften“, wenn sie einen als Juden erkennbaren Trödler „am Bart über die Straße“ zerrten. Die jüdische Oberschicht im Zarenreich beklagte mehr als das russisch-orthodoxe Bürgertum das System des Zarenhauses mit seiner Adelskorruption, sie wollte, weil es nur an sein eigenes Wohlergehen dachte, lieber in einem kapitalistisches Kolonialsystem wie in England leben. Das alte Russland sei als Feind angesehen worden, dem alles zuzutrauen sei. Nach London seien, so erzählt Eva Priester, die Herren des jüdischen Großbürgertums mit ihren Zylindern dreimal im Jahr gefahren. Das Ghetto war überwunden, die Erinnerung daran und an die Tora war in den Hintergrund getreten. Bleibend war, dass Bildung und Wissen als Fundament des Aufstieges jüdischer Familien eingeschätzt wurden. Wegbreiter dieses Denkens war der Aufklärer Moses Mendelssohn (1729–1786). Die deutschen Offiziere, die den Vernichtungskrieg gegen die sowjetischen Völker befehligten und die systematische Ermordung von Juden und Kommunisten überwachten, waren wie diese Juden hochgebildet und haben in den Schulen Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) ebenso wie Immanuel Kant (1724–1804) gelesen und auswendig gelernt. Heinrich Himmler (1900–1945), Reichsführer SS und Befehlshaber spezieller Mordtruppen, stammt aus einer römisch-katholischen, deutsch österreichischen Akademikerfamilie und ist Absolvent eines humanistischen Gymnasiums. Bildung und Wissen allein vermögen, wie die Geschichte zeigt, nichts. Eva Priester erlebte als Kind eine ihr schier als Kult begegnende Hochachtung vor Wissen und Bildung und vor „guten Manieren“, aber auch dass das Geld nicht so wichtig ist, es war ja da. Die emanzipierten jüdischen Familien lebten wie das ganze Bürgertum von der Armut der großen Mehrheit und erteilte sich durch gelegentliche Gesten der Wohlfahrt die Selbstabsolution. Eva Priester war sehr früh mit der Welt der Bücher konfrontiert:
„Die Wände unserer Wohnung waren mit Bücherschränken bedeckt. Ein neuer Roman, ein neuer Gedichtband, eine Premiere waren Ereignisse, über die tagelang geredet wurde. Wenn mein Vater die neuen theoretischen Zeitschriften las oder an einem physikalischen Problem, von dessen Lösung er beruflich gar nichts haben würde, arbeitete, ging das ganze Haus auf Zehenspitzen. Das war Respekt vor der Wissenschaft, nicht Respekt vor dem Familienoberhaupt, denn wenn er schlief, fiel es keinem Menschen ein auf Zehenspitzen zu gehen.“
Sobald Eva Priester einigermaßen lesen konnte, griff sie selbständig und neugierig in die Bücherregale. Auch wenn das kleine Mädchen das meiste sicher nicht verstanden hat, eine Anregung für ihre Phantasie, über die Rolle eines Märchenprinzessin hinauszugehen, war es allemal:
„Das führte dazu, dass ich meine Mutter, wie sie mir später erzählte, einmal vor allen ihren Freundinnen fürchterlich blamiert hatte. Die Freundinnen waren zum Tee geladen, und eine von ihnen fragte mich gütig. >Und was, liebes Kind, hast du jetzt Schönes gelesen?< Wenn sie erwartet hatte, dass ich <Schneewittchen< oder >Dornröschen< sagen würden, wurde sie arg enttäuscht. Denn ich antwortete voll Stolz, weil es ein Buch war, über das die Erwachsenen flüsterten: >Die Lieder der Bilitis>,[12] bitte. Was ich nicht einmal ahnte, weil ich das meiste in diesem Buch nicht verstanden hatte, war, dass >Die Lieder der Bilitis<, die gerade ins Russische übersetzt worden waren und die die Damen einander sozusagen hinter vorgehaltener Hand borgten oder empfahlen, von einer Zeitgenossin und Gefährtin der griechischen Dichterin Sappho stammten und höchst offenherzig die Freuden der lesbischen Liebe behandelten. Überflüssig zu sagen, dass ein Kind von vier Jahren über derlei Passagen höchst uninteressiert hinwegliest, mir gefielen einfach die Verse. Doch in der Teerunde der Damen herrschte einziges Schweigen, dann wechselte man taktvoll das Thema. Später machte meine Mutter meinem Vater, der eher dafür war, Kinder mit einem Minimum an Eingriffen zu erziehen, bittere Vorwürfe: Das komme davon, wenn man >das Kind aufwachsen lasse wie eine Wilde<.“
Wie in allen bürgerlichen Familien üblich, ob jüdisch oder orthodox oder katholisch, ob frömmelnd oder liberal, gab die allgegenwärtige Mutter Zeichen ihrer religiösen Herkunft an ihre Kinder weiter. Im Jüdischen gehört es zur Sendung der Frau, zu beten und darauf zu sehen, dass ihre Söhne und Töchter „Fürchtige des Himmels werden“.[13] Eva Priester erinnert sich:
„Die jüdische Religion hatte aufgehört, eine Rolle zu spielen. Meine Mutter fastete einmal im Jahr – zum Versöhnungstag[14] – >weil es meine arme, tote Mutter auch getan hatte<, und zu Ostern[15] gab es gefüllten Fisch. Mein Vater aß am Versöhnungstag demonstrativ Schinken (den ihm der Arzt sonst verboten hatte), um meine Mutter zu ärgern und zu Ostern den gefüllten Fisch (der ihm auch nicht erlaubt war), weil es ihm schmeckte.“
Unmittelbar in ihrem „herrschaftlichen“ Umfeld lernte Eva Priester die andere Seite des Reichtums kennen. Köchin der Feinsteinfamilie war Ursula mit zwei Kindern, deren Mann ein Bauarbeiter, der wegen eines Unfalls nur mehr wenige Aushilfsarbeiten leisten konnte. Alle waren in einer mit einem Vorhang von der Küche mit ihrem großen Herd abgetrennten Raum untergebracht.
„Sie lebten hinter dem Vorhang, man sah sie fast nie, nur am Abend, wenn das Essen abgeräumt und das Geschirr abgewaschen war, saß Mischa manchmal am Küchentisch und machte dort seine Schularbeiten. Was sie taten, wenn sie hinter dem Vorhang waren, weiß ich nicht. Es gab dort kein Fenster und die Lampe in der Küche war so angebracht, dass hinter dem Vorhang kaum ein Lichtschimmer fiel.
Manchmal am Sonntag kam Ursulas Mann zu Besuch. Wenn ich in die Küche hereinkam, saß er fast immer am Tisch und trank Tee, ein Stück Zucker zwischen den Zähnen haltend. Wenn ich die Tür öffnete, sprang er jedes Mal auf und machte mir eine Verbeugung. Ich war damals drei, vier Jahre alt und reichte ihm kaum bis zur Hüfte. Einmal, als ich in die Küche kam, saßen Ursula und er am Tisch. Ihre Hände lagen ineinander, und sie sahen sich an. Ursula sprang rasch auf und begann den Tisch mit einem Lappen abzuwischen. Der Mann zog mit einem schwarzen, gebrochenen Nagel ziellose Striche auf dem Holz.
Manche Freundinnen meiner Mutter fanden es nicht richtig, dass meine Mutter erlaubt hatte, die Kinder bei sich zu behalten. Einmal hörte ich ein Gespräch: >Ma cherie, vous etes un ange, mais vous etes trop bonne avec les gens. Vous les gatez! Ils vont demander plus et plus, c’est tout!‘ (Meine Liebe, Sie sind ein Engel, aber Sie sind zu gut mit den Leuten. Sie verwöhnen sie. Sie werden immer mehr und mehr verlangen, das ist es.) Die Petersburger Damen sprachen untereinander sehr viel französisch, manchmal mehr als russisch. Zur Ehre meiner Mutter sei gesagt, dass sie schwieg und lächelte. Das war eine Seite. Zu dieser einen Seite gehörte es, dass Mischa mit einer weißen Schülermütze herumging. Er ging in die Mittelschule und mein Vater bezahlte das Schulgeld. Ich erfuhr es ganz zufällig von Ursula, denn bei uns zu Hause verlor man über diese Angelegenheit kein Wort. Die andere Seite aber war, dass ich mit Mischa nicht spielen durfte. Wenn ich fragte, >warum<, sagte man, >das tut man nicht<.“
Zum bediensteten Personal hielt die gute bürgerliche Gesellschaft völlige Distanz, das war im Judentum nichts anders als im deutschen Herrenvolk. Dass Salomon Feinstein das Schulgeld für den Sohn der Köchin ohne weiteres zahlte, war vielleicht mehr als eine private Mildtätigkeit, es mag auch religiöses „Guttun“ gewesen sein. Zur Köchin Ursula, die weder lesen noch schreiben konnte, gewann Eva Priester eine Zeitlang ein differenziertes Vertrauensverhältnis. Das kleine Mädchen hatte den Ehrgeiz, der Köchin Lesen und Schreiben beizubringen, was Psychologen als Ausprobieren eines Rollenspiels einschätzen werden. Das alles sah ihre Mutter nicht gerne und bemerkte einmal zu einer Freundin, dass ihre Tochter eine „Tendenz zur Inferiorität“ habe und sich immer „Niedrigstehendere“ aussuche. Das hinterließ bei Eva Priester tiefe Spuren. Die aus Frankreich kommende Erzieherin Madame Gaffiaux, die handgreiflich werden konnte, war eine gebildete Frau, Tochter eines Kommunarden, und schaute darauf, dass das ihr anvertraute Mädchen Eva Priester Schriften von Jean Jacques Rousseau (1712–1778) und Victor Hugo (1802–1885) las. Victor Hugo, in Russland durch Dostojewski verbreitet, hat Eva Priester die realistische Aneignung der Welt auf literarischem Weg ermöglicht:
„… dann gab mir Madame Gaffiaux ein Buch zu lesen, das mein Lieblingsbuch wurde, das ich jahrelang überall mit mir herumschleppte und vielleicht vierzig oder fünfzig Mal las. Das war ‚Les Misérables‘ von Victor Hugo. Ich verliebte mich sofort in die Helden des Buches. Ich litt mit dem ehemaligen Sträfling Jean Valjean, der für Liebe und Gerechtigkeit unter den Menschen eintrat; mit dem kleinen Mädchen, das er aus den Händen ihrer bösen Pflegeeltern befreite; ich hasste den Polizisten, der Jean Valjean erbarmungslos verfolgte. Doch am meisten liebte ich Gavroche, den Pariser Buben, der sich allein in den Straßen von Paris durchschlägt und im großen Denkmal, dem Elefanten, schläft. Gavroche, der schließlich auf den Barrikaden der Revolution von 1834 stirbt. Gavroche aber trug zweifellos dazu bei, dass ich Revolutionen als etwas durchaus Normales und den Kampf auf den Barrikaden als eine edle und nützliche Tat empfand.“
In den Tagen der Oktoberrevolution
Die Feinsteins hatten nach Kriegsausbruch den Ausbruch von Pogromen wie in der Ukraine befürchtet. Was „Pogrom“ bedeutet, wusste das Mädchen Eva Priester, aber sie fühlte sich in ihrer Erinnerung nicht bedroht. Die Köchin Ursula hatte die Familie Feinstein um 1916 / 1917 verlassen und eine Stelle bei einem hohen und aufgrund seiner Stellung gut versorgten Staatsbeamten angenommen. Als sich die Versorgungslage in den letzten Kriegsmonaten rapide verschlechterte und Esswaren nur noch schwer zu bekommen waren, besuchte die Köchin Ursula mit ihrem neuen Arbeitgeber entwendeten Esswaren die Feinsteins, weil sie nicht wollte, dass Eva Priester, die sie liebte, hungerte. Im Herbst 1917 waren die Feinsteins noch in Petersburg. Die jetzt siebenjährige Eva Priester begegnet Rotarmisten, die bei den Feinsteins eine Hausdurchsuchung vornahmen. Darüber schreibt Eva Priester dreißig Jahre später. Die dort genannte „Tante“ ist in ihrem Entwurf die „Mutter“. Die Damen im Umfeld der Feinsteins hatten während der letzten Kriegsmonate Einladungen für Nähzirkel und Strickzirkel gegeben. „Nur beste Gesellschaft und manchmal kommt eine von den Prinzessinnen hin!“ Sogar Fjodor Iwanowitsch Schaljapin (1873–1938), ähnlich Enrico Caruso (1873–1921) in ganz Europa berühmt, sei vorbeigekommen. Seine Lieder „Dubinuschka“, Carmagnole“ und andere sang während eines Abends der Delegierten zur Gründung der Kommunistischen Internationale (2. bis 6. März 1919) in Moskau Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924) mit.[16] Die neunjährige Eva Priester bekam Fleckfieber, der Hausarzt, der aus dem Krieg mit einem amputierten Arm zurückgekehrt war, behandelte sie. Sascha, so hieß der Freund der Familie, fiel an der Front: „der erste Verehrer meiner Mutter, den sie – obwohl sie ihn nicht geheiratet hatte – mehr geliebt hatte als meinen Vater“.
Eva Priester über ihre Begegnung mit Rotarmisten [17]
„Große Ereignisse setzen sich für Leute, die sie nicht handelnd, sondern passiv miterleben, aus einer Reihe kleiner Ereignisse zusammen. Von einem sehr großen Ereignis, das gerade jetzt in den Gedanken vieler Menschen lebendig ist, erinnere ich mich nur an ein kleines Ereignis, eine kleine Geschichte. Aber vielleicht sagt sie Ihnen doch etwas.
Es war im Herbst 1917. Ich war sieben Jahre alt. Ich lag im Bett und war im Einschlafen. Es klingelte im Wohnzimmer und ich hörte die Dielen knarren unter dem Tritt vieler schwerer Soldatenstiefel. Es war eine nächtliche Hausdurchsuchung, eine jener vielen, die damals in Petrograd stattfanden und bei denen die junge rote Garde (später wurde aus ihr die Rote Armee) nach versteckten Lebensmitteln und gehamsterten Devisen suchte. (Sie fand viel, denn viele Leute, die nicht zugeben wollten, dass die Macht nun wirklich in die Hände der abgerissenen Arbeiter und barfüßigen Bauern übergegangen war, kämpften auf ihre Weise durch Lebensmittel und Devisenhorten gegen die neue Regierung.)
Ich hörte die Stimme meiner Tante, entsetzt, empört. „Dafür haben wir im Februar die Revolution gemacht!“ sagte sie am nächsten Tag. Die Schritte nährten sich meine Tür. Die Stimme meiner Tante drang durch das Holz: „Sie können nicht herein! Sie ist so ein zartes Kind – sie wird erschrecken, in Ohnmacht fallen – sie fällt so oft in Ohnmacht!“ Eine andere Stimme, farblos, todmüde von langen Nächten unterwegs, vom ewigen Wiederholen derselben Sätze, sagte geduldig, ein wenig gequält: „Bürgerin, wir müssen überall nachschauen. Wir werden so ruhig sein als möglich.“ Ich dachte gekränkt: Was erzählt sie für Geschichten, noch nie in meinem Leben bin ich in Ohnmacht gefallen. Die Tür ging auf, das Licht wurde angeknipst. Durch die Tür kamen drei Rotgardisten in langen, schäbigen Soldatenmänteln, müde und unrasiert. Einer trug statt Schuhen nur die geflochtenen bäuerlichen Strohsandalen. Dann kam meine Tante, blass, im Morgenrock und mit herunterhängendem Haar. Die Rotgardisten begannen die Schubläden und die Schränke durchzusehen. Ich fragte freundschaftlich: „Was macht Ihr in meinem Kasten?“ Meine Tante sah mich an, als erwartete sie, dass ich nun zu weinen und zu schreien anfangen würde. Der älteste der Soldaten sagte griesgrämig: „Die Kinder sollen um diese Zeit schlafen und nicht Fragen stellen!“ Ich dachte: Wieder einer von den Erwachsenen und drehte mich beleidigt zur Wand. Die Soldaten verließen das Zimmer. Einer, ein ganz junger Bursche mit rundem Gesicht, blieb drinnen. Er stand sehr unglücklich da und betrachtete mich nachdenklich. Wahrscheinlich wartete er darauf, dass ich, wie angekündigt, in Ohnmacht fallen würde, und überlegte sich unbehaglich, was er in diesem Falle tun sollte. Offenbar hatte er mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Ich drehte mich um und sah ihn auch an. Das Schweigen wurde ihm anscheinend unangenehm. Er räusperte sich und fragte: „Gehst du … gehst du zur Schule?“
„Nein, ich geh noch nicht zur Schule.“
„Spielst du gern mit Puppen?“
„Nein, aber ich habe einen Teddybären.“
„Das ist gut. Spiel nur, spiel brav!“
Schweigen. Mein Gesprächspartner schien sein Hirn nach einer neuen Frage zu zermartern. Wahrscheinlich dachte er, wenn wir fortwährend reden, fällt sie vielleicht doch nicht in Ohnmacht. Nach einer Weile: „Kannst du Lapta (eine Art Schlagball) spielen?“ Ich (mit der ganzen Arroganz, deren Kinder zuweilen fähig sind): „Bei uns in Petrograd spielen Mädchen nicht Lapta.“
Er (etwas kläglich): „Ja so!“
Ich schwöre, ich hatte nichts gegen ihn, aber bei uns zu Hause nannte man die Rotgardisten grundsätzlich nur „diese Räuber und Banditen“. Ich hatte mir daher vorgestellt, dass er eine schwarze Maske über dem Gesicht und einen Dolch im Gürtel tragen würde, Tabak kauen und wunderbar fluchen konnte. Und nun stellte er die gleichen idiotischen Fragen wie alle Erwachsenen. Das allein war der Grund, warum ich so ekelhaft war.
Und wieder Schweigen. Mein Besucher wurde immer nervöser. Schließlich aber fiel es mir ein, dass man mir beigebracht hatte: Mit Fremden und mit Gästen muss man Konversation machen, damit sie sich nicht unbehaglich fühlen – auch wenn sie einem nicht gefallen. Sonst ist man keine Dame. Ich sagte: „Heute war Nebel.“
Mein Besucher schien erleichtert. „Ja. Und jetzt friert es draußen.“
Ich sagte: „Ich habe eine Eisenbahnlokomotive. Wenn man sie aufzieht, fährt sie. Aber heute ist sie kaputt gegangen.“
Der Rotgardist strahlte mich geradezu an. Er schien erlöst. Er bat: „Lass einmal sehen. Weißt du … ich verstehe mich auf so etwas.“
Ich zog die Lokomotive aus dem Spielzeugkasten hinter meinem Bett hervor. Der Rotgardist kam näher.
Als meine Tante und die Mannschaft zehn Minuten später nach beendeter (und erfolgloser) Hausdurchsuchung ins Zimmer kamen, saß der Soldat am Bettrand, bastelte an der Lokomotive herum und erklärte mir den Mechanismus. Ich saß im Bett, zu ihm gebeugt, und sah gespannt zu.
Der Rotgardist trennte sich nur ungern von der Lokomotive. Ich trennte mich nur ungern von dem Rotgardisten. An der Tür blieb meine Tante stehen und sah mich nachdenklich an. Sie schien enttäuscht, weil ich nicht einmal geweint hatte.
Aber Erwachsene lassen sich nicht so leicht beirren. Drei Tage später hörte ich folgendes: „Und wie diese Menschen ins Kinderzimmer dringen, erschrickt das arme Kind so, dass es zu weinen beginnt und fast ohnmächtig wird.“
Ich mischte mich ein: „Aber Tante, das ist doch nicht wahr!“
Ein strafender Blick: „Willst du sagen, dass deine Tante lügt?“
„Nein, aber …“
„Du hast selbst nicht gemerkt, wie du geschrien hast. Du warst viel zu erschrocken.“
Ich glaube nicht, dass politische Antipathie die Hauptschuld an der Entstehung dieser Geschichte trug. Aber die Pointe mit meinem „fast in Ohnmacht-Fallen“ war zu gut, um nicht erzählt zu werden.
Zehn Jahre später – wir hatten Russland verlassen, aber noch immer trafen sich Damen und Herren bei Tees, die erklärten: „Meine Liebe, selbstverständlich bin ich fortgegangen, unter diesen Barbaren kann man nicht leben, sie verlangen, dass alle arbeiten, als ob wir Bauernfrauen wären“, und sprachen von der „guten alten Zeit, die vor dieser schrecklichen Revolution war“, – lautete die Geschichte folgendermaßen:
„Das Kind war krank. Ich bin vor ihnen auf den Knien gelegen und habe sie angefleht, nicht ins Kinderzimmer zu gehen. Sie haben gar nicht hingehört. Als sie hereingebrochen sind, ist das arme Kind vor Schreck bewusstlos geworden. Acht Tage lang hat sie zwischen Leben und Tod geschwebt.“ (Ein tiefer Seufzer.) „Deswegen ist sie heut noch so nervös.“
Meine Tante glaubte selbst fest an ihre Geschichte.
Was mich betraf, so war ich auch damals noch nicht erwachsen, aber ich war trotzdem klüger geworden. Ich wusste etwas Besseres, als Erwachsenen in solchen Fragen zu widersprechen.
Etwas allerdings ist mir von diesem Erlebnis wirklich übriggeblieben. Ich glaube nicht mehr an gewisse Geschichten – solche, wie sie meine Tante erzählte, und einige andere. Und ich weiß jetzt, dass Rotgardisten lieber Lokomotiven reparieren und Lokomotiven bauen, als Hausdurchsuchungen zu machen und Krieg zu führen – wenn man ihnen die Möglichkeit dazu lässt.“
Die Familie Feinstein flieht vor den Bolschewiken und übersiedelt nach Berlin. Die Jahre von Eva Priester bis zur Machtübernahme durch die deutschen Faschisten (1933)
Die Feinsteins emigrierten wie so viele Angehörige der „besseren Gesellschaft“ nach Berlin, wo die revolutionäre Bewegung nach der bürgerlich demokratischen Revolution 1918/1919 blutig niedergeschlagen worden waren. Karl Liebknecht (1871–1919) und Rosa Luxemburg (1871–1919), die auf dem Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) das Referat zum Parteiprogramm gehalten hatte, wurden ermordet. Eva Priester hörte, wie sich die russischen Emigranten gerne mit der adeligen französischen Emigration des Jahres 1793 vergleichen wollten: „Sie vergaßen die Gefangenen der Bastille und das hungernde Volk von Paris. Das war begreiflich, denn diese Dinge hatten niemals für sie existiert. Die weiße russische Emigration, die zum größten Teil nicht aus Großfürsten und Industriekapitänen bestand, sondern aus Rechtsanwälten und Berufspolitikern, Schuldirektoren und mittleren Kaufleuten, brachte ein weit größeres Kunststück zustande, in ihrem Bestreben, das Bild des verlorenen Paradieses recht farbenglühend und harmonisch darzustellen, vergaßen die exilierten Mittelständler, wie sie selbst in der guten alten Zeit ihr Arkadien dreimal täglich als >Völkerkerker<, >Hort der Reaktion<, >absolutistische Hölle< bezeichnet hatten, wie die jungen Mädchen in die Baden-Baden Sanatorien kamen, um die Depressionszustände, verursacht durch die >fürchterliche Finsternis unseres Landes und unseres Dorfes<, auszukurieren und wie sie mit Tränen in den Augen den ausländischen Freunden erklärten: >Bei euch ist Leben Licht, Kultur. Bei uns ist Finsternis, Dreck, Despotismus. Bei euch lebt man. Bei uns kann man vegetieren<. Die Beschlagnahme einiger Bankkonten, die Gesetze gegen Nahrungsmittelhamstern und der Anblick bewaffneter Arbeitergarden vor den Petrograder Adelspalästen genügte, um das Land, in dem man >nur vegetieren< konnte, auf immer in ein verlorenes Paradies zu verwandeln. Wie ich schon sagte, habe ich in dieser Umgebung die Jahre verbracht, in denen ein Mensch am leichtesten zu beeinflussen ist. Gleichzeitig habe ich schon als Kind diese Umgebung und ihre Atmosphäre aus einem unterlassenen Oppositionsgefühl heraus gehasst. Ich muss deshalb bei der Wiedergabe meiner Erinnerung an das alte Russland nach zwei Seiten hin aufpassen, um nicht zu fälschen. Ich muss versuchen, den Marzipantraum vom rosigen Arkadien draußen zu halten, ebenso wie das aus Wut und Protest geschaffene Bild einer schwarzen Hölle aus einem Hollywood-Film. Das heißt, ich muss versuchen, mich nicht an ein Russland zu >erinnern<, das ich Jahre später bei der Lektüre von Tschechows >Kirschgarten<[18] entdeckte, ebensowenig, wie ich mich genau >erinnern< darf, dass ein entfernter Verwandter zwei Arbeiter seiner Fabrik eigenhändig zu Tode geprügelt hat.“
In Berlin organisierten die Feinsteins für ihre Tochter noch einige Zeit Privatunterricht, dann sollte sie in das „Städtische Cecilien-Lyzeum zu Berlin Lichtenberg“ gehen. Das verließ die mosaisch bleibende Eva Priester schon nach dem Schuljahr 1920/21, sie wird mit ihrem Wissensstand und ihrer Lebenserfahrung die großen und kleinen Sekkaturen des Schulalltages nicht ertragen haben. Über ihr Lyzealzeit hat Eva Priester nichts geschrieben. Missachtung wegen ihrer Herkunft wird sie wegen ihres Umfelds keine direkt erfahren haben, ihre Abstammung konnte ihr nicht angesehen werden und die finanziellen Verhältnisse waren gut. Eva Priester begann als Volontärin im bürgerlichen „Berliner Tageblatt“, dessen Chefredakteur Theodor Wolff (1868–1943) war. Wolff war selbst ein sehr vermögender Mann, der noch vor der Inflation und der Zuspitzung der revolutionären Nachkriegskrise (1923) sein Geld in die Schweiz transferiert hat.[19] Wolff war kein Antifaschist, er fühlte sich als „guter Deutscher“ und die von ihm mit begründete bürgerlich liberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) kooperierte zeitweise mit der Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), tat aber nichts konkretes gegen den schrittweisen Abbau des bürgerlich demokratischen Systems.[20] Das „Berliner Tageblatt“ galt als ein einflussreiches Blatt. Der „Völkische Beobachter“ mit dem deutschnationalistischen Alfred Rosenberg (1893–1946) kommentierte das „alljüdisch-börsianische Berliner Tageblatt“ öfters radikal antisemitisch.[21]
Als neunzehnjährige junge Frau hat Eva Priester den Wirtschaftsredakteur des „Berliner Tageblattes“ Hans Erich Priester (*1901) geheiratet und dessen Namen angenommen. Eine Ehevermittlung durch einen Schadchan wie unter Juden da und dort noch üblich wird es keine gewesen sein, aber eine passende „Partie“ allemal. Hans Erich Priester galt als Spezialist für das Spekulationsgeschehen an der Börse. Seine 1932 veröffentlichte Broschüre „Das Geheimnis des 13. Juli. Ein Tatsachenbericht von der Bankenkrise“[22] zeigt viel Insiderwissen. Jürgen Kuczynski (1904–1997), dessen Vater die „Finanzpolitische Korrespondenz“ herausgab und der die Funktion von den diversen Berliner Medien gut gekannt hat, erinnert sich, dass Hans Erich Priester „bei den Leitern der Großbanken aus- und einging, wenn es Wichtiges für das Bankenkapital in der Presse zu propagieren oder zu vertuschen galt“.[23] Schon im Exil veröffentlichte Hans Erich Priester 1936 in Amsterdam in dem vom jüdisch portugiesischen Niederländer Emanuel Querido (1871–1943) gegründeten Verlag die Schrift „Das deutsche Wirtschaftswunder“. Dort weist er mit Zahlen nach, dass seit 1933 die Abermilliarden für das Arbeitsbeschaffungs- und Aufrüstungsprogramm nur dadurch aufzubringen waren, weil die Deutsche Reichsbank sich in den Dienst der Staatsfinanzierung stellte. Hans Erich Priester prognostizierte, es werde früher oder später zu einer Entladung aller dieser Widersprüche nach innen oder außen kommen.
Eva Priester hat sich von ihrem Partner, über dessen weiteres Schicksal vorerst nichts bekannt ist, spätestens 1935 getrennt. Die Entfremdung zwischen beiden war durch den von Eva Priester eingeschlagenen Weg bestimmt. Ende der 1920er Jahre war der gewalttätige Antisemitismus in den Städten der Weimarer Republik schon überall sicht- und spürbar. Klaus Mann (1906–1949) erlebte beim Münchner Oktoberfest 1929, wie über die „Saujuden“ gegrölt wurde.[24] Eva Priester näherte sich über die sozialistische Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Deutschlands an. KPD und SPD sollten sich gemeinsam gegen die vormarschierenden Nationalsozialisten verbünden, war der Wunsch von Albert Einstein, Heinrich Mann (1871–1950) und Käthe Kollwitz (1867–1945) und anderer bekannter Persönlichkeiten. Am 18. Juli 1932 unterzeichneten sie einen Aufruf zu einer öffentlichen Kundgebung aller „Geistesarbeiter und freien Berufe“ aus Anlass der Reichstagswahlen am 31. Juli 1932. Die Wahlen brachten dank ihrer nationalistischen und sozialen Demagogie der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) erhebliche Zuwächse. Sie wurde stärkste Partei im Reichstag. „Die Rote Fahne“ als Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands (Sektion der Kommunistischen Internationale) hat am Sonntag, 1. Januar 1933, aufgerufen „Bahnt den sozialistischen Auweg“. Am 4. Januar 1933 begann das „Kampfjahr 1933“ mit einem Marsch „Jetzt gilt’s, rotes Berlin!“. Am 30. Januar 1933 trat der deutsche Faschismus mit Adolf Hitler (1889–1945) die von der deutschen „Wirtschaft“ unterstützte Regierung an, im Februar 1933 folgten Massenverhaftungen von Kommunisten und erste Konzentrationslager wurden eingerichtet. Noch in der Ausgabe vom Sonntag/Montag 26. und 27. Februar 1933 titelt „Die Rote Fahne“ „Es lebe der Kommunismus“. In dieser Situation wird Eva Priester 23jahrig von der „kommunistischen Idee“ ergriffen. Eva Priester tritt jener Partei bei, die für die Idee der Befreiung der Unterdrückten und Armen in der Realität zu kämpfen bereit war. Eva Priester war etwa im gleichen Alter wie Karl Marx, der als damaliger Redakteur der „Rheinischen Zeitung“ 1842 über solche „Ideen“ geschrieben hat, „die unsere Intelligenz besiegt, die unsere Gesinnung erobert, an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, das sind Ketten, denen man sich nicht entreißt, ohne sein Herz zu zerreißen, das sind Dämonen, welche der Mensch nur besiegen kann, indem er sich ihnen unterwirft“.[25] Eva Priester geb. Eva Maria Feinstein ist ihrem Herzen treu geblieben.
[1] Vgl. Teodor Iljitsch Oiserman: Der „junge“ Marx im ideologischen Kampf der Gegenwart (= Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie 70). Verlag Marxistische Blätter GMBH Frankfurt / Mai 1976.
[2] Heide Königshofer herzlichen Dank! Heide Holzknecht hat die grundlegende Diplomarbeit „Eva Priester. Journalistin. Schriftstellerin. Historikerin“ verfasst, eingereicht bei Gerhard Oberkofler in Innsbruck. Innsbruck 1986. Von Manfred Mugrauer wird Eva Priester, die nach 1945 eine bedeutende Rolle bes. in der außenpolitischen Berichterstattung der KPÖ eingenommen hat, in seiner Arbeit „Die Politik der KPÖ 1945–1955. Von der Regierungsbank in die innenpolitische Isolation“ (V & R unipress 2020) nicht genannt (jedenfalls nicht im Namenregister), dagegen wird sie von Georg Friesenbichler öfters erwähnt („Verdrängung. Österreichs Linke im Kalten Krieg 1945–1955. StudienVerlag Innsbruck / Wien 2021).
[3] Linker Arm der Newa in Petersburg.
[4] Vgl. Michail P. Iroschnikow / Juri B. Schelajew / Ljudmila A. Protstai: Vor der Revolution: Das alte St. Petersburg. Vorwort von James H. Billington, Librarian of Congress, Washington. Einführung von Dmitri S. Lichatschow, Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Dumont Buchverlag, Köln / Harry N. Abrams Inc., Publishers, New York / Nauka Publishers, Leningrad / JV Smart, Leningrad 1991.
[5] Siegfried Grundmann: Einsteins Akte. Einsteins Jahre in Deutschland aus der Sicht der deutschen Politik. Springer Verlag 1998, S. 331.
[6] Insbesondere Lenin, Werke 3 (1975): Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Der Prozeß der Bildung des inneren Marktes für die Großindustrie.
[7] N. Kislizyn / W. Subakow: … die Stadt dem Erdboden gleichmachen. Leningrad ergibt sich nicht. Verlag Progress Moskau 1984.
[8] Maxim Gorki: Ausgewählte Werke. Erzählungen. Skizzen. Erinnerungen. Globus Verlag Wien 1947, S. 478.
[9] G. M. Derenkowski et al.: Die Revolution 1905–1907 in Rußland. Dietz Verlag Berlin 1980.
[10] Fjodor Dostojewski: Schuld und Sühne. Aus dem Russischen von Hermann Röhl. Anaconda München 2020, S. 7.
[11] Vgl. Norman Solomon: Das Judentum. Eine kleine Einführung. Aus dem Englischen übersetzt von Ekkehard Schöller. Reclam Universal Bibliothek Dietzingen 1996, S. 71.
[12] Die Lieder gehören zur erotischen Literatur des Pierre Louÿs (1870–1925).
[13] Ein Jüdisches Lesebuch. Sendung und Schicksal. Aus dem Schrifttum des Nachbiblischen Judentums. Mitgeteilt von Nahum Norbert Glatzer und Ludwig Strauss. Schocken Verlag Berlin 1931, S. 214.
[14] Jom Kippur („Tag der Sühne, der Sühnungen“).
[15] So im Text, es wird das Pessach Fest sein.
[16] Wladimir Iljitsch Lenin – Dokumente seines Lebens. 1870–1924. Band 2. Ausgewählt und erläutert von Arnold Reisberg. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, Band 2. 1980, S. 216.
[17] Die Spielzeuglokomotive. Aus: Die Woche 1947, Nr. 45
[18] Anton Pawlowitsch Tschechow (1860–1904) publizierte 1903 „Der Kirschgarten“.
[19] Theodor Wolff – Wikipedia
[20] Die bürgerlichen Parteien in Deutschland. Handbuch der Geschichte der bürgerlichen Parteien und anderer bürgerlichen Interessenorganisationen vom Vormärz bis zum Jahre 1945. Band I. VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1968, betr. Wolff bes. S. 304–306.
[21] Alfred Rosenberg: Kampf um die Macht. Aufsätze von 1921–1932. Hg. von Thilo von Trotha. Zentralverlag der NSDAP. München 1938, öfters.
[22] Verlag von Georg Stilke Berlin 1932.
[23] Jürgen Kuczynski: Studien zur Geschichte der zyklischen Überproduktionskrisen in Deutschland 1918 bis 1945(= Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. Band 15). Akademie Verlag Berlin 1963, S. 118.
[24] Klaus Mann: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. S. Fischer Verlag 1952, S. 255.
[25] MEW 1 (1972), S. 108 (S. 105–108: Der Kommunismus und die Augsburger „Allgemeine Zeitung“).