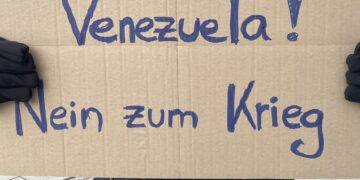Der 5. Juni 2023 markiert den 140. Geburtstag des britischen Ökonomen John Maynard Keynes (1883–1946). Sein Hauptwerk, „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ (1936) und der daraus abgeleitete Keynesianismus waren mitbestimmend für den Kapitalismus des 20. Jahrhunderts sowie den wirtschaftspolitischen Antisozialismus. – Wir bringen eine Betrachtung von Tibor Zenker, Vorsitzender der Partei der Arbeit Österreichs (PdA), die dieser 2016 anlässlich des 70. Todestages von Keynes verfasst hat.
Im Rahmen der bürgerlichen Makroökonomie nimmt Keynes’ Werk zunächst eine oppositionelle Haltung gegenüber den im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts vorherrschenden klassischen und neoklassischen Vorstellungen ein. Mit ihnen wird dem „freien Markt“ der Ausgleich von Angebot und Nachfrage nicht nur in der Güterproduktion und im Warenabsatz, sondern auch in Bezug auf das Preisniveau und insbesondere auf die Arbeitslosigkeit zugeschrieben. Es wird somit eine Tendenz zur Vollbeschäftigung unterstellt. Keynes hingegen vertrat den Gedanken einer Tendenz zum Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung und attestierte der neoklassischen Theorie Wunschdenken und unzutreffende Annahmen, wenn er festhält, dass „die Postulate der klassischen Theorie nur in einem Sonderfall, aber nicht im allgemeinen gültig sind, weil der Zustand, den sie voraussetzt, nur ein Grenzpunkt der möglichen Gleichgewichtslagen ist.“1
Unfreiwillige Arbeitslosigkeit, im neoklassischen System logisch ausgeschlossen, ist für Keynes das Ergebnis ausbleibender Investitionen aufgrund geringer Profiterwartungen des Kapitals, wobei er bezüglich der Investitionsbereitschaft neben objektiven auch subjektive, psychologische Entscheidungskriterien einkalkuliert. Keynes schreibt: „Das Verhältnis zwischen dem voraussichtlichen Erträgnis eines Kapitalwertes und seinem Angebotspreis oder seinen Ersatzkosten, das heißt das Verhältnis zwischen dem voraussichtlichen Erträgnis einer weiteren Einheit jener Art Kapital und den Erzeugungskosten jener Einheit liefert uns die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals“.2 Die geringen Profiterwartungen basieren auf unattraktiv hohen Zinssätzen für Kredite, vor allem aber auf zu geringem privaten Konsum. Dieser Konsumrückgang führt eben keineswegs in Form von Ersparnissen zu mehr Angebot am Kapitalmarkt, niedrigeren Zinsen und größeren Investitionen. Fehlende Investitionen bedeuten Rückgang der Produktion, Arbeitslosigkeit, niedrigere Löhne, Verarmung der Haushalte, abermals Konsumrückgang – eine Wirtschaftskrise. So weit Keynes’ Kausalitäten.
Was sind Keynes’ Ansätze ansgesichts seiner Grundannahmen? Um es kurz zu machen: Nachdem der „laissez-faire“-Kapitalismus zur Krise und Massenarbeitslosigkeit führt, bleibt als Alternative der staatliche Eingriff. Keynes kommt zum Schluss, dass „eine ziemlich umfassende Verstaatlichung der Investitionen sich als das einzige Mittel zur Erreichung einer Annäherung an Vollbeschäftigung erweisen wird; obschon dies nicht alle Arten von Zwischenlösungen und Verfahren ausschließen muß, durch welche die öffentliche Behörde mit der privaten Initiative zusammenarbeiten wird.“3
Es geht im Kern um eine antizyklische Wirtschafts- und Finanzpolitik. Einerseits, vor allem in der Rezession, um das berühmte „deficit spending“, d. h. dass sich der Staat verschuldet, um eine verstärkte Nachfrage zu generieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Konkret bedeutet dies, dass der Staat ausgabenseitig und kreditfinanziert selbst als Investor und Auftraggeber agiert, etwa Infrastrukturprojekte initiiert und außerdem durch Steuersenkungen und Transferleistungen ein „investions-“ und „konsumfreundliches“ Klima schafft. Andererseits impliziert eine antizyklische Politik auch, dass in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs und der Hochkonjunktur die Steuern wiederum erhöht werden müss(t)en.
Antimarxistisch, antisozialistisch
Keynes’ Ansätze wurden vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise ab 1929 entwickelt. Insofern ist die generelle Anwendbarkeit im Imperialismus umstritten, kann aber theorieimmanent abgeleitet werden. Aus der historischen Verortung heraus ist erkennbar, wo und wann wesentliche keynesianistische Punkte wirtschaftspolitischer Staatsintervention zuerst umgesetzt wurden: Dies betrifft – mit Abstrichen – einerseits den „Second New Deal“ in den USA zwischen 1935 und 1938, andererseits die Wirtschaftspolitik des deutschen Faschismus. Nach 1945 ist der Keynesianismus für mehrere Jahrzehnte zum wirtschaftspolitischen Standard in Westeuropa und Nordamerika geworden. Der Keynesianismus war die Hauptvariante des staatsmonopolistischen Kapitalismus (SMK) in Zeiten der realen Systemkonkurrenz.
Zuvor einen Schritt zurück. Die offenkundige Übereinstimmung einer Keynesschen „Theorie der Produktion als Ganzes“ und der wirtschaftlichen Kriegsvorbereitung des deutschen Faschismus zeugt nicht nur davon, welches Ideal dem SMK innewohnt, sondern auch davon, worauf diese Wirtschafts- und Finanzpolitik hinausläuft. Es gibt keine tatsächlichen Lösungen, sondern ein Aufschieben. Früher oder später sind die Rechnungen zu begleichen, in einer noch größeren Krise – etwa in der heutigen – und bzw. oder in großen imperialistischen Kriegen. Letzteres möge man in Bezug auf die gegenwärtige Situation der USA bedenken. Der US-Dollar ist in Wirklichkeit so viel wert wie damals die Reichsmark, nämlich gar nichts.
Der Keynesianismus bestimmte also die Wirtschafts- und Sozialpolitik des „Kalten Krieges“ gegen die UdSSR und den europäischen Sozialismus. Keynes war ja ein kapitalistischer Ökonom und Wirtschaftspolitiker, ein Gegner der revolutionären Arbeiterbewegung und des Sozialismus. Seine Anschauungen haben theoretisch antimarxistischen Inhalt und praktisch, strategisch antisozialistische Zielsetzungen. Es geht um ein Instrumentarium zur Rettung des Kapitalismus. Ihm ging es nie aus sozialen Motiven um die Hebung des Lebensstandards der Arbeiterklasse, sondern – bestenfalls – um deren Ruhigstellung. Keynes sah, wie die Weltwirtschaftskrise von 1929 zu massiven Verwerfungen in Nordamerika und Europa führte, während die Sowjetunion, wenngleich mit anderen Problemen behaftet, für diese unanfällig war. Was Keynes daher anstrebte, war ein gut verwalteter, organisierter und „funktionierender“ Kapitalismus, wie er selbst schreibt: „Ich für meinen Teil bin der Ansicht, daß ein klug geleiteter Kapitalismus die wirtschaftlichen Aufgaben wahrscheinlich besser erfüllen wird als irgend ein anderes, vorläufig in Sicht befindliches System (…) Diese Gedankengänge zielen auf mögliche Verbesserungen der Technik des modernen Kapitalismus durch das Mittel kollektiver Betätigung ab.“4 Der Keynesianismus nach dem Tod des Ökonomen hat genau das versucht. Denn ab 1945 hatte der Kapitalismus nichts anderes zu beweisen, als dass er weitgehend krisenresistent sein könne und zu Wohlstand für alle führe. Andernfalls wäre er kaum noch zu rechtfertigen und vor dem Sozialismus und den arbeitenden Menschen des Westens zum Offenbarungseid und zur Kapitulation gezwungen gewesen. Und da kommt die Sozialdemokratie ins Spiel.
Sozialdemokratisch und „links“
Die europäische Sozialdemokratie hatte den Kapitalismus schon am Ende und im Gefolge des Ersten Weltkrieges gerettet und machte sich nach dem Zweiten, bereinigt von jedem ernsthaften Marxismus, den Keynesianismus zum selben Zweck zu eigen. Der inszenierte Wohlfahrtsstaat v.a. der 1970er Jahre – auf die Spitze getrieben von der schwedischen Sozialdemokratie oder auch vom österreichischen SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky – gilt bis heute als Heiligtum linker Sozialdemokraten und nichtsozialdemokratischer Reformlinker. Diese „soziale Demokratie“, „solidarische Gesellschaft“ oder – wenn man gar keine Ahnung mehr von Klassengesellschaften hat – dieser „demokratische Sozialismus“ spielen sich im bürgerlich-demokratischen Parlamentarismus ab. Aber eben auch in der „sozialen Marktwirtschaft“, im Kapitalismus keynesianistischer Prägung, im Wettstreit mit dem sogenannten Neoliberalismus. Und der setzt sich umfassend durch, seit in Europa der sozialistische Widerpart beseitigt und kapitalistisch-imperialistisch einverleibt wurde. Ein Ergebnis dessen ist die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise. Da erscheint es auf den ersten Blick logisch, wieder zurück zu Keynes zu wollen. Doch werden damit welthistorische und globale Zusammenhänge übersehen, vom marxistischen Kapitalismusverständnis gar nicht zu sprechen.
Der relative Wohlstand in Westeuropa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war politstrategisch ein Resultat der Angst des Kapitals vor dem Sozialismus, wirtschaftlich war er aber nur der Anteil relevanter Kreise auch der Arbeiterklasse an den Monopol- und imperialistischen Extraprofiten. Lenin schreibt: „Dadurch, dass die Kapitalisten (…) hohe Monopolprofite herausschlagen, bekommen sie ökonomisch die Möglichkeit, einzelne Schichten der Arbeiter, vorübergehend sogar eine ziemlich bedeutende Minderheit der Arbeiter zu bestechen und sie auf die Seite der Bourgeoisie (…) hinüberzuziehen. Diese Tendenz wird durch den verschärften Antagonismus zwischen den imperialistischen Nationen wegen der Aufteilung der Welt noch verstärkt.“5 Die Unterdrückung und Ausbeutung der abhängigen Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika ermöglicht eine relative Wohlstandsverteilung in den imperialistischen Zentren – mit politischen Folgen: „Der Imperialismus, der die Aufteilung der Welt (…) bedeutet, der monopolistisch hohe Profite für eine Handvoll der reichsten Länder bedeutet, schafft die ökonomische Möglichkeit zur Bestechung der Oberschichten des Proletariats und nährt, formt und festigt dadurch den Opportunismus“.6
Heute in Westeuropa für die neuerliche Umverteilung zugunsten der arbeitenden Menschen zu streiten, ohne dabei aber die Ausbeutung der osteuropäischen Semiperipherie und des Trikonts zu beenden, ohne den eigenen Imperialisten und Kapitalisten das Handwerk legen zu wollen, ist in der Hauptsache Opportunismus. Und somit ist auch in einer wechselseitigen Beziehung festzuhalten, „dass der Kampf gegen den Imperialismus eine hohle, verlogene Phrase ist, wenn er nicht unlöslich verknüpft ist mit dem Kampf gegen den Opportunismus.“7 Sonst ist man wieder nur da, wo Keynes hinwollte: Bei der Rettung des europäischen und nordamerikanischen Kapitalismus, mit ein paar Abfallprodukten für die westliche Arbeiterklasse. Wer in der Linken nur Arzt am Krankenbett des Kapitalismus sein möchte anstatt sein Totengräber, dem möge das genügen. Fortschritt und Emanzipation liegen aber woanders.
Keynes versus Marx
Kommen wir nun zur Berichtigung der Keynesschen Ansichten über Arbeitslosigkeit, Krisen und Konsum. „Die größere Produktivität der Arbeit drückt sich darin aus, dass das Kapital weniger notwendige Arbeit zu kaufen hat, um denselben Wert und größere Mengen von Gebrauchswerten zu schaffen, oder dass geringere notwendige Arbeit denselben Tauschwert schafft, mehr Material verwertet, und eine größere Masse Gebrauchswerte (…) Es erscheint dies zugleich so, dass eine geringere Menge Arbeit eine größere Menge Kapital in Bewegung setzt“8, heißt es bei Karl Marx. Die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus führen zum Anstieg und zur Allgegenwärtigkeit der Arbeitslosigkeit. Durch verbesserte Fertigkeiten, durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt, durch bessere Werkzeuge, (mehr) Maschinen und Computer ist es der Menschheit möglich, in geringerer Zeit mehr zu produzieren. Normalerweise müsste dies dazu führen, dass die Arbeiter dementsprechend weniger arbeiten müssen – ihre existenziellen Lebensbedürfnisse und jene der Gesellschaft sind schneller und früher gestillt. Diese Tatsache zeugt von den Voraussetzungen des Übergangs zum Sozialismus, wie Friedrich Engels schreibt: „Erst die durch die große Industrie erreichte ungeheure Steigerung der Produktivkräfte erlaubt, die Arbeit auf alle Gesellschaftsmitglieder ohne Ausnahme zu verteilen und dadurch die Arbeitszeit eines jeden so zu beschränken, daß für alle hinreichend freie Zeit bleibt, um sich an den allgemeinen Angelegenheiten der Gesellschaft – theoretischen wie praktischen – zu beteiligen. Erst jetzt also ist jede herrschende und ausbeutende Klasse überflüssig, ja ein Hindernis der gesellschaftlichen Entwicklung geworden“.9 Das gilt heute noch viel mehr. Da wir aber im Kapitalismus leben, bedeuten Verbesserungen und Fortschritte der Arbeitsprozesse nicht, dass alle Arbeiter weniger, also kürzer arbeiten müssen, sondern dass ein Teil von ihnen ausgestoßen und arbeitslos wird, während der andere Teil länger arbeiten muss als nötig. Hier sehen wir, dass entgegen Keynes’ Annahme staatliche Investitionen und die Förderung privatunternehmerischer Investitionen keineswegs zwingend zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen, sondern geradezu gegenteilig zu deren „Ersatz“, wenngleich zu Lasten der Profitrate.
Im Kapitalismus – egal, ob jener von Keynes oder seinem neoliberalen Vertreter Friedrich August Hayek – besteht der Zweck der Wirtschaft darin, den Profit der Unternehmen zu maximieren. Den größten Profit macht ein Unternehmen, wenn es eine geringe Zahl Arbeiter beschäftigt, diese möglichst lange und zu einem möglichst niedrigen Lohn arbeiten lässt. An tatsächlicher Vollbeschäftigung kann der Kapitalismus kein Interesse haben. Möchte man im keynesianistischen Sinne für Vollbeschäftigung sorgen, so stößt man an die realen Grenzen des Kapitalismus. Kein staatliches Eingreifen wird die Kapitalisten dazu zwingen, wider ihre ureigensten Lebensbedürfnisse zu agieren, woran der Klassenstaat als ideeller Gesamtkapitalist sowieso kein Interesse hat. Jede Beschäftigungsinitiative staatlicherseits wird zeitlich begrenzt sein – und bestenfalls begünstigt durch Exportüberschüsse (BRD) oder durch massive Militärgüterproduktion (NS-Staat) Erfolg haben.
Kojunkturschwankungen und schließlich Krisen sind für Keynes ein Ergebnis ausbleibender Investitionen. Diese sind jedoch bereits Auswirkung, nicht Ursache. Tatsächlich liegt ein kapitalistisches Profitrealisierungsproblem vor. Die Masse der Bevölkerung stellen die Arbeiter – sie haben allerdings nicht nur ihre Arbeiterfunktion, sondern sie sind auch die Masse der Konsumenten. Wenn man ihnen einen möglichst niedrigen Lohn zahlt – in jedem Fall einen niedrigeren, als dem Wert ihrer Produktionstätigkeit entspricht, also exklusiv des Mehrwerts –, dann können sie sich auch nicht allzu viele Güter leisten. Die Kapitalisten bleiben auf ihren Waren sitzen, die Produktion wird zurückgefahren oder eingestellt, Arbeiter werden entlassen – die regelmäßigen Höhepunkte solcher Entwicklung sind Krisen.
Die Ausweitung der Produktion stößt an jene Grenze, die sich der Kapitalismus mit dem möglichst geringen Lohnniveau der Arbeiterklasse schaffen muss, was wiederum deren mangelnde Kaufkraft gegenüber der gestiegenen Produktivität bedeutet. Auch liegen hier Überakkumulation und Fall der Profitrate zugrunde. Letzteres versuchen die Kapitalisten vor allem dadurch auszugleichen, indem sie die Gesamtprofitmasse vergrößern und daher die Gesamtproduktion erweitern. Doch relativ wird immer noch weniger Arbeitskraft gekauft und bezahlt als in das fixe Kapital investiert. Die verlangte Markterweiterung findet nicht statt und die gestiegene, ausgedehnte und verbesserte Produktion mangels eines entsprechenden Konsumwachstums keinen Absatz. Kurz: Es werden mehr Waren produziert als verkauft. Diese Überproduktion ist jedoch eine relative. Keineswegs handelt es sich um ein Zuviel für die Bedürfnisse der Menschen, lediglich um ein Zuviel für deren Geldbörsen, damit aber auch um ein Zuviel, um dieses Kapital in Profit zu verwandeln. Die Überproduktion bedeutet „zu viel nicht für den Konsum, sondern um das richtige Verhältnis zwischen Konsum und Verwertung festzuhalten; zu viel für die Verwertung.“10 Es ist festzustellen, schreibt Marx, „daß die bürgerliche Produktionsweise Schranke für die freie Entwicklung der Produktivkräfte einschließe, eine Schranke, die in den Krisen und unter anderem in der Überproduktion – dem Grundphänomen der Krisen – zutage tritt.“11
Der Kapitalismus stockt, weil sich die Produktivkraft entwickelt. Dies ist die Basis jeder kapitalistischen Krise, die lediglich durch massive Kapitalentwertung und ‑vernichtung zu „überwinden“ ist – um sodann den fehlerhaften Kreislauf neu zu beginnen. Keynes meint aber, man könne durch Investions‑, Zins- und Steuerpolitik die Zügel in der Hand behalten. Doch die Grundgesetze des Kapitalismus, insbesondere jene der Produktionssphäre kann Keynes eben nicht unwirksam machen.
„Falscher Prophet“
Es ist kein Zufall, dass der Keynesianismus zur Zeit der Konsolidierung der UdSSR und im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von 1929 eine dominierende Position erlangte und während der Jahrzehnte des Systemgegensatzes ausübte. Ebenso wenig, dass dieser Zyklus mit dem Ende der sozialistischen Staaten in Europa abgeschlossen wurde und der „Neoliberalismus“ als ungehemmte Neuentfaltung des Imperialismus das Kommando übernommen hat. Als Werkzeug der Kapitalismusrettung und des Antisozialismus hat der Keynesianismus seine Aufgaben erfüllt. Als oberflächliche Abmilderungsmethode und Verzögerungsstrategie gegenüber kapitalistischen und imperialistischen Gesetzmäßigkeiten hat er letztlich jene Welt vorbereitet, in der wir heute leben: In einer Welt mit desaströsen sozialen, politischen und gesellschaftlichen Folgeerscheinungen der Weltwirtschaftskrise seit 2007; in einer Welt mit einer imperialistischen Hegemonialmacht, deren Schulden‑, Finanz- und Wirtschaftssituation nach militärischen Ausfällen globaler Bedeutung drängt; und in einer Welt mit schwach entwickelten Gegenkräften.
Eines steht damit jedoch auch fest: Für jegliche revolutionäre Arbeiterbewegung und auch für eine ernsthaft emanzipatorische Linke eignet sich der Keynesianismus nicht als Bezugspunkt der politischen Ausrichtung.12 John M. Keynes wäre in diesem Sinne, wie George Siskind seine immer noch lesenswerte Analyse treffend überschrieb, „ein falscher Prophet“13, der auf Abwege und in Sackgassen führt.
Anmerkungen
1 John M. Keynes: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, München/Leipzig 1936, S. 3
2 ebd., S. 114
3 ebd., S. 318
4 John M. Keynes: Das Ende des laissez-faire, München 1926, S. 116
5 W. I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW 22, S. 306 f.
6 ebd., S. 286
7 ebd., S. 307
8 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, MEW 42, S. 292 f.
9 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, MEW 20, S. 169
10 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, MEW 42, S. 356
11 Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, MEW 26.2, S. 528
12 vgl. Kurt Gossweiler: John Maynard Keynes – ein Ratgeber für uns und unsere Probleme?, in: Topos – Internationale Beiträge zur dialektischen Theorie, Heft 9 (Aspekte der Ökonomie), 1997, S. 45–57
13 George Siskind: John Maynard Keynes – ein falscher Prophet, Berlin 1959
Quelle: junge Welt, Berlin, 29. April 2016