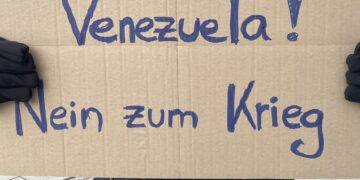Gastautor: Peter Goller, geb. 1961, Univ.-Doz. Dr. und Archivar an der Universität Innsbruck
Unser Gastautor Peter Goller widmet sich in einer fünfteiligen Artikelserie der Arbeiterliteratur. Im Mittelpunkt steht dabei das Leben und Wirken von Adam Scharrer und Hans Marchwitza. Peter Goller hat sich bereits in früheren Beiträgen für die Zeitung der Arbeit mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befasst.
Heinrich Sperber war im jugendlichem Alter von fünfzehn Jahren in die Elendswelt der Walzbrüder gestoßen worden. Im schlesischen Scharley müssen sich Hans Thomek und seine Schulfreunde mit 14 Jahren zu fast gleicher Zeit als Kohlenschlepper verdingen. Knecht wollte Hans auf gar keinen Fall werden. Er sieht die vielen Taglöhner, die sich auf den Feldern abrackern: „Es war Frühling. Die Kastanienbäume trugen ihre Blütenhüte. Ich war seit mehreren Tagen Bergmann – Kohlenzuschmeisser auf der Buchatzgrube, in einem vier Meter hohen, staubwallenden und nur von einigen Lampen erleuchteten Raum. Meine Hände brannten von dem ungewohnten Schaufeln. (…) ‚Allen brannten mal die Hände, Piss drauf, Bengel das hilft!‘ (…) Das Tageslicht belebte mich wieder.“ J87f.
Die jungen Bergleute werden von einem roh unflätigen Oberhauer, ihrem „Teufel“, schikaniert:
„Ich bekam nur fünfundsiebzig Pfennig für die Schicht. (…) Es wurden oft sechzehn Stunden, und ich taumelte schlafend die sieben Kilometer zurück. (…) Valentin Matzeck sagte mir: ‚Mensch, du schleichst wie eine Leiche daher!‘ Ich besah ihn mir und sagte: ‚Du auch!‘ Die ‚Knochenmühle‘ mahlte alle Tage das hinabfahrende Menschenfleisch. (…) Die Kohle wälzte sich schwarz und dampfend aus dem Schacht. Schwarz und dreckig und wie ausgesogen und aufgewrungen krochen wir wieder hervor.“
Eine Arbeitergruppe wird von einer noch ärmlicheren unterboten. Zum Lohndrücken werden „aus den Karpathen“ ruthenische Halbsklaven geholt. Sie konnten nicht einmal den Kontrakt lesen und „unterkritzelten mit drei Kreuzchen“. Der Arbeitsvertrag wird für die „karpatischen Leidensgenossen zu einer Kette“. Zu Hause in Hütten lebend hofften sie, sich von der Bergarbeit einige Kühe zulegen zu können. Ein Aufseher, ein ganz stumpfer Kerl, schlug die Ruthenen mit einem Ochsenziemer. Ein Ruthene wird von einer Tonnenladung erschlagen, der junge Mischa zu Hans: „‚Brüderchen, Bruder, die Preußen sind nicht gut, nicht gut!‘ (…) Ich wurde endlich aus der Totenpartie weggeholt. Klotz spannte mich in einer Förderstrecke zum Schleppen ein.“ (J 90–99)
Hans zeigt in einer Erzwäscherei menschliche Solidarität mit einem elfjährigen polnischen Kindersklaven, der als siebzehn galt. Das kam beim Aufseher gar nicht gut an: „Das geht auf keinen Fall, mein Lieber, diese Freundschaft macht mir die Bande noch nachlässiger. Du sollst sie aufschwänzen, dass die Canaillen nicht aus dem Schweiß kommen. Du bist hier der Unterwaschmeister und hast die Würde eines solchen zu wahren.“
Fast täglich kassieren die jungen Bergmänner Lohnstrafen. Ein Kollege schlägt vor, „den Lohnverlust mit Überstunden herauszuholen. Ein hartes Unternehmen, das ich aber trotz aller Martern, die dabei wieder winkten, den Betrügereien auf dem Lohnzettel vorzog.“
Nach jeder Entlassung ist Hans durch Einträge im Arbeitsbuch noch mehr belastet: „Der Oberingenieur hatte uns natürlich einen ‚Vertragsbruch‘ in die Papiere hinein geschmiert. Wir wanderten alle erreichbaren Gruben ab, stießen aber überall auf Schwierigkeiten. ‚Solche Vögel haben wir genug! Warum habt ihr die Arbeitsstelle so Knall auf Fall verlassen?‘“ Bei jedem Arbeitswechsel studiert Hans sein Buch ganz genau, „ob da nicht irgendwo ein Sonderzeichen eingraviert“ ist? (J 123–125)
Nach längerer Arbeitslosigkeit wiedereingestellt trifft Hans Thomek erstmals auf einen Sozialisten und damit auf eine bisher verschlossene Welt: „Seit einiger Zeit schaffte in unserer Arbeitspartie der Häuer Schneider, ein geborener Sachse. Schneider stand angeblich mit Freimaurern, Sozialisten und anderen Teufelsgesellschaften im Bündnis. (…) Zu uns Jungen sagte er: ‚Hunger- und Schwindsuchthaufen‘, was wir ihm nicht krumm nahmen, denn damit hatte er wohl recht. Nur als er Bismarck und andere hohe Persönlichkeiten angriff, da fand er Widerstand und auch viele Feinde. Sogar Bismarck habe sich mit ‚blutendem Herzen‘ dazu entscheiden müssen, uns von der chronischen Schwindsucht durch Knappschaftsgesetze zu retten. Mit diesem armseligsten aller Gesetze. Bismarck hätte es aber nur getan, um unsere Militärtauglichkeit zu erhalten, weil der Kaiser gelegentlich Schlachtvieh für den kommenden Krieg brauche.“ Die alten Kumpel warnen, Schneider werde noch im Zuchthaus landen: „Schneider sei ohne seine Familie hergekommen. Kein anständiger Mensch lasse seine Familie irgendwo in der Welt sitzen und vielleicht zugrunde gehen.“
Die Freundesgruppe sehnt sich um 1910 aus Scharley weg: „Verruchtes, hoffnungsloses Scharley! Brutstätte allen Unglücks, werden wir deiner Fetzenarmut, deinen Knochenmühlen einmal Ade winken können?“ Hans Thomek weiß, dass sich in Beuthen „alle paar Wochen ein Agent von der Ruhr einfindet, der nicht viel zu locken brauchte. Hunderte Unzufriedene wie wir umlagerten das schmutzige Hotel. Der Agent betrog die Angeworbenen, das wusste man.“ Und doch unterschrieben alle: „Kontrakt ist Kontrakt!“ Rund hundert Kumpel lassen sich anwerben: „Ade, Oberschlesien, altes Jammertal!‘ Wir fuhren an die Ruhr. Ein neues Traumland, ein ‚Kap der guten Hoffnung‘ für viele Absinkende.“ Weg von den „fluchbeladenen Schleppgruben, stinkenden Kneipen“, elenden Wohnvierteln und doch schon ahnend, dass sie das alles bald wieder einholen wird. (J 129–137)
Der „rote Schneider“ sitzt mit im Zug. Er steht als „roter Wühler“ seit langem auf jeder „schwarzen Liste“ der „Kohlenbarone“. Er warnt Hans vor den gelben, von den Ruhrmagnaten gelenkten Werkvereinen: „Was ich dir raten möchte, lass dich drüben ja nicht von den Gelben missbrauchen, denn dann gehst du sofort einen schiefen Weg. (…) Schneider legte mir ans Herz, wenn wir unten an der Ruhr wären, dann soll ich mich sofort dem Verband anschließen.“ (J 141–144)
Hans und seine Freunde – sie sehnen sich kaum in Essen angekommen wieder in das Schlesische zurück – werden in einer verrußten Wohnkaserne, in einem riesigen Schlafsaal untergebracht. Proletarisches Klassenbewusstsein haben sie noch immer keines. Sie wissen nicht einmal, dass sie selber Proletarier sein sollen: Pellmann, ein sozialdemokratischer Agitator, „hatte sich zwischen uns gesetzt und schlang erst seine Kartoffelsuppe. Ich kannte einige seiner Reden bereits; er sprach unten in seiner Stube mit einer Wucht, dass es bis zu uns hinaufschallte: der bewusste Proletarier – Klassenstaat – das Bollwerk unserer Klassenkämpfe ist die Organisation. ‚Was ist das, Proletarier …?‘ hatten wir Schletz gefragt. ‚Das sind wir, ihr Dummköpfe‘, hatte Schlez uns nachdenklich erklärt.“ Pellmann stößt mit seiner Frage, ob die Neuankömmlinge aus Oberschlesien schon organisiert sind, auf taube Ohren: „Kümmert euch die Organisation so gering? Dann fressen uns die Ausbeuter bestimmt …“ (J 153f.)
Hans wird auch von adventistischen, apostolischen Sekten, von katholischen Jünglingsvereinen bedrängt. Hans lässt sich vom Bruder seiner Frau Anna überrumpeln und tritt einem christlichen Gewerkverein bei. Erst auf Drängen von Schneider kehrt er zum sozialdemokratischen Bergarbeiterverband zurück. (J 227f.)
Hans Thomek kann sich nur schwer von seiner verbohrt schlichten Weltsicht lösen. Wilhelm Kaiser, deshalb „Kaiser Wilhelm“ gerufen, aktiv im Ruhrbergarbeiterstreik von 1912, fragt Hans Thomek, ob er Dostojewskij oder Zola gelesen hat, immerhin ist Zolas „Germinal“ auch ein Bergarbeiterroman. Hans hat die Namen nie gehört: „Herrgott, was lest ihr denn, ihr jungen Banditen? (…) Keinen Dostojewski? So hast du auch noch keinen Marx gelesen.“
Hans Thomek, der erst nach und nach einiges aus der Geschichte des Sozialismus erfährt, besucht Schneider. In dessen Stube hängt ein „Bild mit einem breiten, grauen Mähnenkopf“. Hans meint, es sei Schneiders Vater, es ist aber Karl Marx: „Da schrie Schneider hinter mir: ‚Was, den kennst du nicht? Karl Marx? (…) Unser Karl Marx, der uns den Weg aus der Misere gewiesen hat …‘“ Schneider gibt Hans einige politische Hefte mit auf den Weg, auch wenn dieser nur trivialen Schund, der Aufbruch in eine bessere Welt zu bieten scheint, lesen will. (J 234)
Wie soll man in diesem Sumpf, angesichts der elenden Schufterei an eine sozialistische Befreiung denken können? „Ich hörte missmutig Schneiders leidenschaftlichen Reden von der Menschenbefreiung zu. Ich hatte eine Riesenwut in mir. ‚Mit unseren Ochsen kannst du darüber nicht reden. Ich hab ein paar Versuche gemacht, vergebliche Mühe‘ ‚Man darf nicht gleich die Flinte ins Korn werfen‘, sagte er, ‚man muss immer wieder anpacken.‘“ (J 239)
Hans ist erst Kohlenschlepper, später Lehrhauer. Das Aufsichtsregime ist gnadenlos, ständig Lohnabzüge: „Jede Schicht werden Wagen wegen ‚unreiner Kohle‘ gestrichen“.
Im März 1912 wird an der Ruhr für die achtstündige statt zehn- bis zwölfstündige Schicht, für die Beseitigung der Arbeitsnachweise der Unternehmer, für die Beschränkung der Geldstrafen, für Lohnerhöhungen bis zu 15 Prozent und für höhere Leistungen aus der Knappschaftskassa gestreikt. Der Christliche Verband lehnt die Streikteilnahme ab. Trotzdem beteiligen sich viele „Christen“ gegen den Willen ihrer Gewerkschaft: „Auch die ‚Christen‘ und die ‚Hirsch-Duncker‘ und die ‚Polen‘ seien sich diesmal einig, der Ausbeutung eine Schranke zu setzen.“
Bis zu 250.000 Bergkumpel stehen im großen Ruhrmontanstreik von 1912. Militär wird in das Streikgebiet verlegt. Bei Zusammenstößen werden vier Arbeiter getötet, viele verwundet. Nach dem verlorenen Arbeitskampf werden über 2000 Streikende – zumeist wegen „Beleidigung und Drohung“ angeklagt: 299 Männer und 84 Frauen erhalten Gefängnisstrafen, 247 Männer und 148 Frauen Geldstrafen.[1]
Die Streikunterstützungen sind knapp, die Frauen fürchten ums Essen. Aussperrung und endgültige Entlassung drohen. Der rote Schneider ist unter den ersten Entlassenen: „Die anderen alle hatten die Aufforderung bekommen, sofort zur Arbeit zurückzukehren, oder sie kämen auf die Entlassungsliste. ‚Unsere Kämpfe kosten Opfer‘, versuchte Schneider meine Angst zu besänftigen. ‚Der Verband wird die Gemaßregelten natürlich nicht allein lassen‘, versprach er mir und legte mir ans Herz, ich solle nur nicht gleich bei dem ersten Schlag ins Wanken geraten. (…) ‚Man wird uns wie Ratten aushungern, wie Bettler, so demütig, ziehen wir zum Schacht, wenn sie uns zerbrochen haben.‘“, fürchtet ein weiterer Kollege.
Noch einmal wurde unter vagen Versprechen, „Missstände zu prüfen“ oder beim „Wagenstreichen“ mäßiger vorzugehen, zur Anfahrt aufgefordert. Schneider wehrt sich verzweifelt, wenngleich vergeblich: „Glaubst du, ich mache meinen Nacken vor den Herren krumm? Und wenn wir Bretter fressen müssen, ich nehme nicht die Mütze unter den Arm!“
Hans Thomek wird auf die „schwarze Liste“ gesetzt, und die Strafe war zumindest sechsmonatiger Ausschluss von jeder Bergarbeit: „Am vierten oder fünften Morgen rannten Zechenboten durch die Häuser und gaben in jeder Familie die gleiche Karte ab. Ich bekam ein größeres Kuvert. Mir wurde kalt. Ich riss es zögernd auf und fand darin, wie geahnt, mein Arbeitsbuch und einen Zettel dabei – ‚wegen Kontraktbruch entlassen‘.“
Trotzdem rückt Hans Thomek nach Streikabbruch an. Erst wird er scharf abgewiesen, schlussendlich folgt die totale Demütigung, er wird auf Gnade eingestellt. Er beugt sich dem Arbeitsdruck, schiebt brav Überschichten, verfällt in eine private Krise: „Schneider gab sich neue Mühe, meine Seele aus den Klauen der Finsternis und der Versumpfung zu retten. ‚Versteh doch‘, drang er in mich, ‚unser Weg ist ein langes, opfervolles Auf und Ab. So leicht wird der Arbeiterklasse der Sieg nicht gemacht. Aber einmal muss es gelingen, die menschenunwürdige Zuchthausordnung abzuschütteln.‘“ (J 241–246)
Sozialistischer Kriegswiderstand 1914
Schneider stößt auf allgemeine Apathie, seine antimilitaristische Agitation findet nur wenige Zuhörer. Schneider schimpft kurz vor Kriegsbeginn auf Hans: „Lies nicht immer die verdammten hurrapatriotischen Schmöker, die verwirren euch allen die Schädel. Hör doch, was der liebe Herr, euer Kaiser, in Marokko der Menschheit angekündigt hat; wie Hunnen will er unser Volk losjagen …“ Immerhin gelingt es Schneider, Hans zur Teilnahme an der 1. Mai-Demonstration zu bewegen. Nach Reden gegen die „Kriegsbestie“ und Appellen an die internationale Solidarität wird die Versammlung von einem massiven Polizeiaufgebot aufgelöst.
Hans gleitet in resignierende Stimmungen ab, nur selten flackert sozialistische Hoffnung auf: „In meiner Arbeit – es war ein drei Fuß hohes Bruchfeld – hingen die Sargdeckel hauchschwach. Die Schwaden zogen nicht ab, und die Gefahr bestand, dass man uns, wenn sich der Dreck entzündete, in Fetzen vom Kohlenflöz ablesen würde. (…) Ich versuchte manchmal in den mir von Schneider geliehenen Büchern über den Sozialismus zu lesen, ich wog die Unzulänglichkeit aller aber nach der eigenen Ohnmacht, und es fehlte mir die Kraft, zu glauben, der einfache Menschenwille könne an der bestehenden Ordnung etwas ändern. (…) Ich griff wieder nach den Zehnpfennigheften. Sie entführten mich als Held, Räuber oder Goldsucher aus der Öde unserer Mietskaserne in eine Welt der Revolver, Messer, der rasenden Kämpfe mit tausend Gefahren, einer wilden bestialischen Freiheit, die mir gerade zu meinem Gemütszustand passte.“
Insgeheim denken viele daran, sich freiwillig zu melden, um aus dem schnöden Arbeitsleben, aus der Grubenschlepperei ausbrechen zu können. Schneider sieht die „Wacht am Rhein“-Stimmung unter jüngeren Kollegen, er schimpft: „Ich seh’s euch auf den ersten Blick an, ihr steht schon alle auf dem Kopf.“
Schneider selbst schwankt nur für einen kurzen Moment. Einen Augenblick lang scheint auch er auf die Propaganda vom „deutschen Verteidigungskrieg“ hineingefallen zu sein, zu Hans: „Wir müssen mitmachen, wir sind angegriffen worden.“ Aber sehr rasch wendet sich Schneider angesichts des Zerfalls des Arbeiterinternationalismus und des „Burgfriedens“ verzweifelt ab. J 262f.
Hans bleibt vorläufig im Schacht. Das auf Kriegsproduktion umgestellte Arbeitsleben wird militärisch verschärft: „Es wurde zweimal wöchentlich eine Anderthalbschicht angesetzt, und wir Gebliebenen kamen danach jedesmal fahl, wie abgehetzte Gespenster, wieder über Tag.“ (J 251–263, 268)[2]
Endlich 1915 ist auch Hans „auf dem Weg nach Verdun“. Längst hat sich die euphorische Kriegshysterie verzogen. Die Siegesfanfaren finden keinen Glauben mehr, an der Westfront angekommen: „Es gab keinen Vormarsch mehr. Viele von uns Neuen begriffen dieses erstarrte Kriegsleben nicht. In uns rauschten noch die Klänge der Siegesglocken.“ In Wirklichkeit finden sie aber „ein Totenfeld“ vor: „Die Toten starrten uns an, und ich kehrte mich schüttelnd um.“ J 303/319
Hans wird ein kurzer Heimaturlaub gewährt. Seine Frau Anna arbeitet in einer Pulverfabrik. In den Ruhrgruben werden französische Zwangsarbeiter malträtiert. Anna zu Hans: „Wir schuften uns hier zuschanden. Alles wird mit dem Schützengraben stumm und klein gehalten.“ Wer schimpft, wird einrückend gemacht.
Auch Schneider will raschen Frieden, Völkerversöhnung. Welcher Gruppe Schneider angehört – den Spartakisten oder den Unabhängigen Sozialisten – wird nicht präzisiert: „Wir Sozialisten torkelten wie besoffen in den Strudel. Die Wiederaussöhnung der Völker muss unsere nächste Aufgabe sein. (…) Was geht uns Hungerleider die Eroberungswut der Oberen an.“ (J 339–342)
1917 kommt Hans an die Ostfront: „Die Siegesfahnen hingen noch in Mengen, aber alt, vom Regen verwaschen, müde und unbeachtet. Die Bahnhöfe voll drängelnder Frauen. Trübe, besorgt, mager und blass. Weiber wie Männer. Schwer abgewetzt.“ Der Militärzug fährt nach Ostpreußen. In einer baltischen Stadt hören die Soldaten vom Sturz des Zaren. Hans sieht barfüßige, verhungerte Gespenster, es sind zum Arbeiten verfrachtete polnische Juden. (J 364–366)
Es gibt erste Fraternisierungen mit herumirrenden gefangenen französischen Zwangsarbeitern, mit russischen Soldaten, die verliehenen E.K’s wurden „zum Gespött“, die militärische Disziplin verfällt.
Die Soldaten erhalten im Sommer 1917 Nachricht von der Marinerevolte in Kiel und Wilhelmshaven
Ohne die Namen von Albin Köbis und Max Reichpietsch zu nennen ruft ein Soldat: „Die zwei Kulis sind wegen der Kieler Meuterei abgeknallt worden!“
Auch Hans hat genug vom Krieg, noch einmal kurzer Urlaub, die Heimat noch befremdlicher: „Deutschland, wo ist dein Siegesjubel, deine Begeisterung? Alles bleich, geisterhaft, gehetzt; fremd – fremd.“ Noch immer lügt die Kriegspropaganda etwas von deutschen Offensiven vor, in zunehmend surrealer Weise wird zum Zeichnen von Kriegsanleihen aufgerufen.
Hans Thomek trifft einen schwer verwundeten Jugendfreund aus Scharleyer Tagen. Dieser arbeitet wieder im Schacht. Er hat die gewerkschaftliche Kassierarbeit von Schneider übernommen, da dieser nach einem Warnstreik „einrückend gemacht“ worden war. Der Freund spricht im Schneider‘schen Tonfall zu Hans: „‚Ihr müsstet die Knarre umdrehen und nicht noch so närrisch aufgeputzt umherlaufen.‘ (…) Wir stritten lange, erbittert. Er kam jetzt mit Ideen, die ich schon bei Schneider verrückt gefunden hatte. Die ganze Kriegsgeschichte durch Generalstreik, durch Gehorsamsverweigerung abzubrechen.“ Hans wird nur langsam im Denken klarer: „Meine Einfalt war bei Arras, Verdun und in Flandern geblieben.“ Zu Kriegsende wird Hans degradiert! (J 397–400, 411)
Antimilitarismus in Adam Scharrers „Vaterlandslosen Gesellen“
Die Rolle, die Hans Thomek in Marchwitzas „Meine Jugend“ einnimmt, ist in Adam Scharrers „Vaterlandslosen Gesellen“ dem Metallarbeiter Hans Betzoldt zugeordnet. Thomek denkt daran, sich freiwillig zu melden, um der Arbeit im Schacht zu entkommen. Betzoldt hingegen entzieht sich der Stellung. Er will desertieren. Seit vielen Jahren locker der Sozialdemokratie verbunden sieht Hans Betzoldt im August 1914 die Schwäche der Sozialdemokratie: „Ich glaubte, dass dieser Zusammenschluss der unterdrücken Proletarier stark genug sei, den Panzer des verlogenen Patriotismus zu durchlöchern, der die Menschheit in den Abgrund reißt. – Ich habe mich geirrt! Die Sozialdemokratie und ihre Organisationen waren noch keine Gemeinschaft, die diesem Anprall standhielten. Der erste Stoß schon riss den trügerischen Schein fort.“ Keinen Moment glaubt er an die Rede vom „Burgfrieden“, an die Kriegshetze der Extrablätter: „Lüttich im Sturm genommen!“
Im Hamburger Gewerkschaftshaus findet Hans B. noch ein paar verstreute Antimilitaristen: „Klaus? Das ist der Steinträger mit der gedrungenen Figur, der als aktiver Soldat einem Unteroffizier mit der Faust ins Gesicht schlug, dass man ihn vom Platz tragen musste, und dem sie deswegen zwei Jahre Zuchthaus aufbrummten.“ Klaus reagiert zynisch, man hätte sich nie auf den Parteiapparat verlassen dürfen, auch die Massen sieht er überfordert: „Dass die dummen Proleten sich auf die Führer verlassen haben, das war der Fehler. Sie sind alle feige. Für die Geldsäcke lassen sie sich umbringen, für sich haben sie keine Courage.“
Der auf eigene Faust handelnde Betzoldt will mit gefälschten Papieren in die Illegalität abtauchen. Er findet im Milieu subproletarischer Randexistenzen Unterschlupf. Er legt sich eine zweite Biographie zu: „… dass ich fürderhin Hans Kiefernholz heiße, letzter Aufenthaltsort Zuchthaus“, aus dem Heer mit Schimpf und Schande ausgeschlossen! (VG 18–24)
Fünf linke Hamburger Genossen treffen sich im Spätsommer 1914: „Die Opposition in der Partei gewinnt Fühlung untereinander. Die besten Genossen werden sich wiederfinden.“ Unter ihnen der Former Alfred Maußner, ein erprobter Genosse mit riesigem Wissen zur Tradition der Arbeiterbewegung, er ist kämpferisch, wenngleich auch desillusioniert: „Wo ist jetzt die Internationale? Die deutsche Sozialdemokratie hat ihr den Krieg erklärt. Sie ist tot. Wir müssen wieder ganz von vorn anfangen.“ Die „Kleinbürger“ in der Partei fürchten die Illegalität, das Verbot der Organisation bei Widerstand gegen die Kriegsmobilisierung. Ja sie fürchten sogar die Revolution mehr als den Krieg, deshalb bewilligen sie die Kriegskredite. (VG 48–53)
Die kleine proletarische Oppositionsgruppe diskutiert im Herbst 1914 über die Ursachen des Kriegs, über Imperialismus, Kolonialismus und kapitalistische Profitgier, die „die Welt zum Kampfobjekt von Räubern, die Menschen zu Knechten dieser Räuber“ machen. Längst ist klar, dass dieser „Hexensabbat“ in nicht einmal zwei Monaten zehntausende Tote, Verwundete, Vermisste gefordert hat. In Hans Betzoldt macht sich Hoffnungslosigkeit über die Schwäche der Kriegsgegner breit: „Was nützt es, wenn der eine oder der andere die Wahrheit über diesen Krieg erfährt und zum Schweigen gezwungen wird? Was nützt es? In spätestens vier Wochen sind wir draußen, neue kommen – und gehen wieder, und wieder kommen neue. Wo bleibt die Tat? Irgendetwas, ein Signal, ein erlösender Schrei.“ Nach und nach wird die Gruppe durch Einberufungen an die Front zerschlagen: „Alfred wühlt in seinen Taschen. Dann gibt er jedem einige mit Schreibmaschine geschriebene Flugblätter, dasselbe, das Klaus mir zusandte. ‚Ihr müsst versuchen, das Material an den Mann zu bringen. Das wird mehr nützen als unser Rätselraten. Die Frauen müssen einspringen, wenn die Männer nicht mehr da sind.‘ (…) Er hat den Gestellungsbefehl in der Tasche, und unten sitzt seine Frau bei dem Säugling und wartet auf ihn.“
Der Krieg endet nicht so rasch, wie von Hans Betzoldt erhofft. Er kann das Leben im Untergrund nicht durchhalten. Er stellt sich. Der Gang zum Kasernenhof kommt ihm vor, „wie die freiwillige Kapitulation eines flüchtenden Todeskandidaten“. Viele der eingezogenen Arbeiter nehmen alles passiv hin: „Einige Proletarier sind darunter, die meinen, ‚man macht den Stumpfsinn eben mit, weil es keinen Zweck hat, sich dagegen aufzulehnen‘.“ Manche glauben noch an die Kriegspropaganda, an die „Greueltaten der belgischen Franktireure“, manche treibt sogar die Sorge um, dass sie den „Einzug in Paris“ versäumen könnten. Wirksame Antikriegsagitation ist schwierig, die sozialdemokratische Rede vom „Verteidigungskrieg“ demoralisiert die Arbeitergenossen. (VG 50, 62, 70–77)
Hans Betzoldt landet Ende 1914 an der Front bei Metz. Er sieht die Schrecken des „Stellungskrieges“, apokalyptische Szenen, Massengräber, überall bestialischer Leichengestank: „Fürs Vaterland gefallen!“ Nur eine winzige Hoffnung: „Der Schrei Karl Liebknechts am 2. Dezember war unser Schrei!“ Scharrer hat keinen Roman über das Frontgeschehen geschrieben. Er stellt den Bürgerkrieg nach innen, die Ausbeutung hinter den Frontlinien, die Kriegsgewinnler, die Repression in den militarisierten Rüstungsbetrieben und den Kriegswiderstand in den Mittelpunkt. Der „Burgkrieg“ ist Scharrers eigentliches Thema.
Das französische Hinterland wird von der korrumpierten deutschen Offizierskaste ausgebeutet: „Die Herren hinter der Front wollen sich hier scheinbar auf Lebenszeit einrichten. Ganze Dörfer werden ausgeplündert, alles nur Denkbare herangeschleppt, Offizierskasinos entstehen, hübsche Schwestern nehmen der Etappe das männliche Einerlei.“ Eine verängstigte französische Arbeiterfrau stammelt: „Internationaler Kapitalismus ist schuld! Internationale der Arbeiter kaputt. Alle verraten, nur einer nicht in Allemagne: Liebknecht.“
Ein alter Franzose wird von einem Offizier misshandelt, da er eine vorbeimarschierende deutsche Kompanie missachtet. Die unter den brutalen Einquartierungen leidende „Zivilbevölkerung steht stumm an der Straße und weicht schüchtern den Offizieren aus. Ein alter Mann behält seine Mütze auf dem Kopf, der junge Oberleutnant bleibt vor ihm stehen und schaut ihn an. Der Alte rührt sich nicht, ist ganz verblüfft, weiß nicht, was der junge Offizier von ihm will. Da schlägt ihm der junge Held mit der Reitpeitsche links und rechts und mit aller Kraft ins Gesicht. Der Alte taumelt, (…). ‚Gesindel!‘ knirscht der junge Held mit dem EK erster und zweiter Klasse.“
1915 kehrt Hans Betzold auf dem Weg zu einem Arbeitseinsatz bei Krupp in Essen für einige Tage nach Hamburg zu seiner Frau Sophie zurück: „Der Kriegsrausch ist ja auch längst verflogen, die Lüge vom ‚Verteidigungskrieg‘ brutal entlarvt. Deutschlands Grenzen sind frei, und doch bleibt die Faust in der Tasche. Sie tappen im Dunkeln, die Millionen Frontsoldaten. Sie sind weiter untertan der Obrigkeit, die Gewalt über sie hat. (…) Die Menschen scheinen alles als selbstverständlich hinzunehmen: den Hunger, die verlogene Kriegsberichtserstattung.“ (VG 90, 101–111)
Die Soldaten verrecken am „Feld der Ehre“, die Kriegsgewinnler drücken sich „in warmen Betten an ihre Weiber“: „Die Hunde der der oberen Zehntausend verzichten nicht auf ihre Milch und ihre Semmeln. Kriegsdichter streuen ihr Gift in die korrumpierte Presse, um die Millionen zu betäuben, deren Hunger mit den Aktien der Kriegslieferanten steigt. Arbeiterführer essen als kaiserliche Gäste im Hauptquartier, und Rosa Luxemburg und Genossen sitzen hinter den Gittern um der Wahrheit willen. Liebknecht wird als ‚irrsinnig‘ und als ‚ehrlos‘ erklärt, und Spitzel aller Grade lassen sich durch Orden und Ehrenzeichen ihre Ehre bescheinigen.“
Die linke Widerstandszelle ist weiter dezimiert, in alle Richtungen zerstreut, einige sind in „Schutzhaft“. Alfred Maußner „berichtet von den Mühseligkeiten und Schwierigkeiten der geheimen Agitation, dem Kampf mit den Schnüfflern“. Sophie Betzoldt und eine fünfzehnjährige Junggenossin verteilen getarnte Flugblätter, indem sie mit ihnen Lebensmittel einwickeln. Einzelne Arbeiter und Arbeiterinnen reichen Hans fordernd die Hand: ‚Betzoldt! Hans! Macht ihr nicht bald Schluss?‘“
Die Arbeit bei Krupp empfindet Hans als extrem ausbeuterisch: „Ich werde zur Firma Krupp in Essen beurlaubt. (…) ‚Neunte mechanische Werkstatt!‘ Man führt mich an eine Riesendrehbank, auf der Kurbelwellen schwersten Kalibers vorgeschruppt werden Diese Arbeit ist lebensgefährlich. (…) Hier kann man auch den Heldentod fürs Vaterland sterben.“ (VG 116–122)
Die Krupp-Arbeiter sind vorsichtig, politische Spitzel sind gezielt angesetzt. Trotz der schweren Arbeit fürchten sie auf einen ersten Verdacht hin an die Front geschickt zu werden: „Die Zehntausend, die morgens und abends aus Dutzenden von Fabriktoren hinein- und herausströmen – das ist das Antlitz des Krieges in Zivil. Das Gespenst des Schützengrabens verfolgt sie bei Tag und Nacht. Sie sind vom Hunger gezeichnet. (…) Auf ihren Gesichtern liegt es wie Kohlenstaub. Sie gehen stumm, nur hier und da murrt einer, aber so, dass es kein Unbefugter hört. ‚Besser, als im Schützengraben!‘“ Sie wollen sich nicht verdächtig machen, sind vorsichtig. Wie die Bewohner des besetzten Gebiets. Vor der Kantine stehen sie wie Bettler, wollen Marken haben, (…).“ (VG 126)
Vorübergehend an die Ostfront abgezogen erlebt Hans 1915/16 nicht nur zahllose Plünderungen durch deutsche Soldateska, sondern auch eine militärische Zweiklassengesellschaft: Sie marschieren „vorbei an dem Stab mit Pfaffen und Kriegsberichterstattern. Sie essen Weißbrot und trinken Kaffee aus sauberen Tassen, die Regimentskapelle spielt ihnen schneidige Märsche vor. Uns fallen die Brocken vom Leibe, in die zerrissenen Schuhe dringt Sand und Wasser.“ Bei Kowno und Grodno sieht Hans viele gefallene Russen. Sie „schauen in den Mond, silbern glänzt ihr totes Gesicht. Ein Buch liegt neben einem, mit Bildern von Tolstoi, Gorki, Zola, Heine, Dostojewski, eine Photographie von Frau und Kind ist drin.“
Hans Betzoldt trifft im Ostpolnischen auf die um Brot bettelnde Zivilbevölkerung. Hans begegnet auch der jüdischen Zivilbevölkerung: „Man führt uns die Treppe empor in eine ‚gute‘ Stube. An der Wand hängen Bilder der jüdischen Zionisten, unter ihnen das Bild von Oskar Kohn. Daneben ein Bild von Karl Marx. Wir zeigen auf die Bilder, wollen fragen, ob wir bei Genossen sind. Sie scheinen nicht ganz zu verstehen. ‚Ein großer Mann!‘ sagt die alte Mutter und deutet auf das Bild von Karl Marx. Wir bestätigen lebhaft, und verstehen, wer sie sind.“ (VG 136, 142)
Hans wird für eine Berliner Metallfabrik reklamiert. „Dreher sind knapp.“ Für einige Stunden kann er seine Frau sehen. Sophie Betzoldt arbeitet mittlerweile bei Blohm & Voss in Hamburg. Sie berichtet von den zur Zwangsarbeit verpflichteten französischen Gefangenen. Diese werden von den deutschen Arbeitern isoliert. Hans Betzoldt sieht sich selbst als einen „proletarischen Krüppel an der Heimatfront“: „Ich drehe die Kupferringe an Granatkörpern ab. Stück für Stück fünf Pfennige.“ Der „Betrieb ist militarisiert“.
Schnell tritt er in Verbindung zu einer illegalen sozialistischen Zelle: „Ein mir unbekannter Genosse in Soldatenuniform spricht. Er spricht von der Forderung der deutschen Kapitalisten, Belgien und Frankreich zu annektieren, Teile der französischen Schwerindustrie zu enteignen. Von der Forderung der Grenzerweiterung im Osten, von dem Schrei nach neuen Kolonien. Wenn das Proletariat nicht aufsteht, sagt er, wird der Krieg bis zum Weißbluten geführt werden.“ Hans verteilt Flugblätter. Plakate warnen vor einer „verbrecherischen“, „offenbar im Dienste einer feindlichen Macht“ stehenden Kriegsopposition. Die Verdächtigen werden „ausgesiebt“, zur Nachmusterung eingezogen: „Die Untersuchung dauert höchstens zwei Minuten. Urteil: K.v. Feldartillerie!“ (VG 150–155)
Hans verinnerlicht Karl Liebknechts Losung von „Der Feind steht im eigenen Land!“ Im Mai 1916 gibt es neue Hoffnung. Langsam sickern Nachrichten von der Antikriegskundgebung am Potsdamer Platz durch: „In Berlin haben Arbeiter die rote Fahne gehisst, am ersten Mai demonstriert, um durch alle Lüge, durch alle Not, durch alle Gemeinheit hindurchzuschreien: Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! Karl Liebknecht, der Armierungssoldat ist wieder auf die Schanzen gesprungen. Die proletarische Jugend hat mit ihm das Banner des revolutionären Klassenkampfes gehisst.“ VG 219
Wieder im Osten eingesetzt liest Hans Betzoldt 1916 erstmals die Spartakus-Nachrichten. Der Prozess gegen Karl Liebknecht wird zum Desaster für die deutsche Kriegspropaganda. Rückkehrende Urlauber bringen die Nachrichten „noch vorne“: „Die Sozialdemokratie fällt auseinander. Liebknecht verteidigt sich heldenmütig und mit unglaublicher Zähigkeit. Demonstrationen, Streik der Berliner und Braunschweiger Arbeiter sind die Antwort auf das Zuchthausurteil.“ (VG 228)
Hans sieht täglich, wie sich die kriegseuphorische bourgeoise Jugend an der Front lächerlich macht.
Hans pendelt zwischen Front und Einsatz in kriegswichtigen Betrieben. Die opportunistischen Gewerkschaftsblätter malen im Sommer 1916 noch immer das Bild vom „Kriegssozialismus“:
„Mir spukt ein Zeitungsartikel, den ich in irgendeiner Gewerkschaftszeitung gelesen habe, im Kopf herum: ‚Sozialismus, wohin wir blicken!‘ Er verherrlichte die ideale Verteilung der Lebensmittel in Deutschland. Für jedes Kind ist gesorgt, amtlich registriert, auf welche Menge Milch, Fleisch, Brot usw. es Anspruch hat. Nur der kleine ‚Schönheitsfehler‘, dass der Vater bei vierzehnstündiger Schufterei die amtlich garantierten Sachen nicht kaufen kann, ist nicht berücksichtigt.“ Es ist ein ärmlicher „Kohlrübensozialismus“.
1917 für ein paar Tage bei seiner schwangeren Frau Sophie in Hamburg beobachtet Hans, dass selbst linke Aktivisten resignieren. Sophie erzählt von dem Brotstreik, der im April 1917 viele Fabriken lahmgelegt hat: „Die Soldaten im Felde dürfen nichts davon erfahren, dürfen nicht wissen, dass sich ihre Frauen und Kinder und Väter, vom Hunger gepeitscht, gegen den Mordspatriotismus auflehnen. Sie dürfen nur erfahren, dass der ‚Verbrecher‘ Karl Liebknecht mit einigen ‚unlauteren Elementen‘, ‚meist jugendlichen Burschen und Mädels‘, unschädlich gemacht ist.“ (VG 250–255)
Zu seinem Schrecken erfährt Hans, dass die Kriegsopposition durch innere Spannungen geschwächt ist. Genossen aus dem Umfeld der „Unabhängigen Sozialisten“ attackieren Karl Liebknecht und die Spartakisten als „Spalter“: „Was hat die Faktion Liebknecht bisher erreicht? Sie hat sich von den Massen isoliert, hat die Kräfte zersplittert. Jetzt, wo die Arbeitsgemeinschaft die Massen zum Kampf um den Frieden führen will, sitzt ihr in der Ecke und spielt die gekränkte Leberwurst.“ Ein Anhänger Liebknechts reagiert empört: „Eure Stellung zum Krieg und Frieden ist keine proletarisch-revolutionäre, sondern eine bürgerlich-pazifistische.“ Eine weitere Genossin ruft ein Hoch auf die „Zuchthäusler“ Liebknecht und Luxemburg. (VG 265–267)
In den Betrieben wird ein System der Selbsterniedrigung, der Bespitzelung, des Misstrauens und der Angst aufgebaut: „Die Betriebe sind gesäubert von ‚Hoch‘- und ‚Landesverrätern‘. Ein raffiniertes System gegenseitiger Selbstzerfleischung, von der Angst zum Heldentum in Bewegung gehalten, hält die hungernden Sklaven nieder. (…) Sie werden durch Angst und Hunger in immer größere Angst und größeren Hunger gezwungen, und die Rebellen werden ins Feld geschickt.“ (VG 275f.)[3]
Im vierten Kriegswinter 1917/18 werden die Brotrationen neuerlich gekürzt. Auch das „Rot der russischen Revolution“ lässt sich nicht mehr verheimlichen. In den Berliner Betrieben nimmt die Unruhe wieder zu. Das zum Streik aufrufende Spartakus-Flugblatt „Stunde der Entscheidung“ zirkuliert.[4]
Sozialdemokratische Vertrauensleute versuchen zu beruhigen. Ein Arbeiter schimpft: „Diese Schleimscheißer! Sind reklamiert, damit sie das ‚Durchhalten‘ predigen und quatschen von Idealen. Da bleibt einem ja die Spucke weg!“ Das seien jene „Hindenburg-Knechte“, die schon im April 1917 den „Brotstreik“ sabotiert haben. (VG 285–289)
Die Vertrauensleute versuchen es mit einer „Filzlatschentaktik“ des Ausweichens. Man will einige Arbeiterkader mit ein paar Gramm Lebensmittel mehr bestechen. Es gärt in den Betrieben, die Betriebsräte vermuten radikale „Wühler“ unter der Belegschaft. Der sozialdemokratische „Vorwärts“ ruft im Dezember 1917 immer noch zur Kriegswohlfahrt: „Sammelt Wollsachen und Winterkleidung für unsere tapferen Feldgrauen. Der vierte Winterfeldzug steht bevor!“ Ein sozialdemokratischer Vertrauensmann schimpft: „Immer im Dunkeln hetzen, anonyme Zettel in den Betrieb schmuggeln, die berufenen Vertreter der Arbeiterschaft herunterreißen, – das kann jeder dumme Junge. Damit muss Schluss gemacht werden.“ Er wird unterbrochen: „Du Lump, hast kein Recht, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zu verhöhnen.“ (VG 309–313)
Hans Betzoldt verbreitet gemeinsam mit revolutionären Obleuten Flugblätter: „Arbeiter, Arbeiterinnen! Wollt ihr weiter dulden, dass Millionen hingeschlachtet werden: eure Väter, Brüder, Söhne! Wollt ihr euch weiter mitschuldig machen an dem langsamen Hungertod eurer Kinder? Wollt ihr noch länger dulden, dass die ‚Durchhalter‘ jeden in den Schützengraben, ins Gefängnis schleppen können? Sollen Karl Liebknecht und Genossen noch länger von jedem Kriegsgewinnler als Spion beschimpft werden können? Rafft euch auf‘!“
Militärstreifen gehen hart gegen die Linken vor, immer wieder müssen Genossen untertauchen: „Die Repressalien gegen die ‚Miesmacher‘ werden immer rücksichtsloser. Langsam sickert durch, dass es unter den Matrosen gärt, man statuiert ein Exempel. Mit Zuchthaus und Standrecht will man die ‚Manneszucht‘ retten.“
In vielen Betriebsversammlungen kommt es zu wilden Auseinandersetzungen. Ein linker Genosse schreit, was soll diese „Versöhnlerei“ angesichts der „im Dreck liegenden“ verblutenden Arbeitersoldaten: Der zurückkehrende Soldat „sieht seine Kinder, krumme Beine, Falten wie Greise, in Papierfetzen gewickelt, verhungern. Und er sieht die Kriegsschieber, das Pack in den Fress- und Saufpalästen, wie sie Deutschland, Deutschland über alles singen. (…) Geht euch das nicht an, wenn Reichpietsch und Köbis an die Wand gestellt werden? Wenn in unserer Zeitung [Vorwärts] jeder infame Schwindel noch unterstützt wird? Wenn eure Frauen in den Munitionsfabriken zusammenbrechen?“
Die allgemeine gesellschaftliche Erschöpfung schwächt den politischen Widerstand. Viele versuchen sich auf eigene Faust aus dem Hungerelend zu befreien: „Sie schuften Tag und Nacht, sind ununterbrochen auf der Jagd nach dem Fressen. Wollen sich auf diese Art über die große Zeit retten. Abenteurer tauchen auf, Spitzel lauern überall. Die Massen der Arbeiter bleiben stumm, nur in den Tiefen treibt die Strömung, gelegentlich ein Ausbruch in den Versammlungen, aber nichts organisatorisch Greifbares. Und doch immer wieder dieses Echo. Es fehlt der Anstoß – nur der Anstoß!“
Mitte Jänner 1918 brechen in Österreich-Ungarn Massenstreiks aus, die Rüstungsarbeiter von Wiener Neustadt bilden Arbeiterräte. Die Berliner Arbeiter folgen diesem Beispiel. Sie rufen am 28. Jänner unter den Losungen „Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung“ den politischen Generalstreik aus. Rund 400.000 Arbeiter folgen. Viele Betriebe sammeln sich trotz Demonstrationsverbot zu Protestzügen: „Fallt nicht auf die Schwindeleien herein, die nicht ausbleiben werden. … jetzt heißt es durchhalten – für uns! Jetzt gilt es zu zeigen, dass wir zu kämpfen verstehen!“
Die Arbeiter ziehen durch den Treptower Park, Polizeiprovokateure in Zivil tauchen auf. Demonstranten werden niedergeritten. Das Bürgertum ist erschrocken, eine Dame in elegantem Pelz: „Schöne Zustände! Sind wir hier denn in Russland?“ Die Zeitungen „sind voll von verlogener Hetze gegen die Streikenden. Was liegt näher als eine Denunziation?“ Militärpatrouillen schießen scharf „über die lange gerade Chaussee“. Arbeiterinnen werden misshandelt, blutig geschlagen.
Die Einschüchterungsversuche beginnen: „Die Drohung mit dem Heldentod soll wieder schrecken.“ Täglich werden hunderte Arbeiter zum Kriegsdienst einberufen. Außerordentliche Kriegsgerichte verhängen drakonische Strafe: „Es hagelt Gestellungsbefehle, die Betriebe werden militarisiert, die beurlaubten Soldaten erhalten durch militärische Bekanntmachungen Befehl, die Arbeit aufzunehmen oder sich ihrem Truppenteil zu stellen. Werden sie sich schrecken lassen vor der Drohung mit der Strafe? Sie fühlen, wie sich die Krallen des Militarismus über ihnen krampfen. Wenn sie geholt werden, einzeln, mit aufgepflanztem Gewehr, was dann?“
Revolutionäre Vertrauensleute rufen zum Durchhalten auf: „Arbeiter, lasst euch nicht einschüchtern! Werdet nicht zu Streikbrechern! Legt die Arbeit nieder! (…) Lasst euch nicht von Ebert und Scheidemann einwickeln.“ Am 4. Februar 1918 gelingt es die Streikbewegung mit Hilfe der Sozialdemokratie einzudämmen, nun werden die Betriebe „gesäubert“: „Die meisten schleppen sich bereits wieder stumm in die Granatfabriken, der Krieg geht weiter, der Hunger bleibt. Massenweise wandern die andern hinaus auf das Feld der Ehre, von den Betrieben gezeichnet, bestimmt für die Kugel. Sie auszurotten ist eine vaterländische Pflicht.“[5]
Auch Hans Betzoldt droht die militärische Rekrutierung: „Ich bin noch nicht unter denen, die hinaus befördert wurden. (…) Ich versuche langsam zu erfassen, dass die Niederlage keine Niederlage war. Genosse Kerr setzt das ausführlich auseinander. ‚Das Auf und Ab der zersplitterten Streiks in Deutschland, in Österreich, in Ungarn‘, sagt er, ‚sind das Wetterleuchten des großen revolutionären Gewitters.‘“ (VG 343–353)
Hans Betzoldt wird im Sommer 1918 noch einmal eingezogen, er kommt aber nicht mehr an die Front. In den Hinterland-Kasernen bröckelt die militärische Disziplin: „Wir werden zum letzten Mal aufgerufen. Fünf von vierzig Mann fehlen. Es fällt nicht mehr besonders auf.“ Herrische Offiziere kämpfen noch gegen den Autoritätsverlust an, die Soldaten rufen „Hunger“: „‚Die Kerls müssen um jeden Preis in Raison gehalten werden!‘ Ein Leutnant kommt mit. Doch was ist seine schmucke Uniform gegen den Hunger? (…) Die Siegesberichte von der letzten großen Offensive sind verstummt. Die Arbeiter in den Betrieben rühren sich wieder. Spartakus ist an der Arbeit!“
Die Soldaten lachen die Offiziere aus. Ein Offizier „flüchtet, als fühle er den Boden wanken. Der Posten ruft ihm nach: ‚Ihr Hosenscheißer! Packt ein, alles ist futsch, ist ja nur noch Krampf.‘“
Die Nachricht vom Kieler Matrosenaufstand erreicht Berlin, noch einmal formen sich die Berittenen zu Attacken gegen die Arbeiter: „Die Blauen schultern wieder die Karabiner. Die Spitzel treten in Funktion. Es nützt nichts mehr. Die Lawine springt nach Hamburg über, nach Bremen, nach Hannover. Der Riese Proletariat zerschlägt seine Fesseln, tritt auf die politische Bühne.“
Die Gefangenen sind befreit. Liebknecht und Luxemburg warnen die Aufständischen vor revolutionärer Leichtgläubigkeit: „Solange die Arbeiter nicht eine Ordnung zertrümmern, in der von dem gescheffelten Gold aller Hass von Menschen gegen Menschen mobilisiert werden kann, solange watet ihr durch Grauen und Schande, mit oder ohne Krieg. Ihr seid dieser Ordnung über den Kopf gewachsen. Ihr müsst sie zertrümmern, – oder ihr erstickt.“ (VG 367–374)
Im November 1918 proklamieren die revolutionären Obleute auch in Berlin den Generalstreik. Die rote Fahne wird gehisst. Aus verschiedenen Berliner Betrieben strömen Arbeitermassen zusammen: „Unser nächstes Ziel ist die AEG in der Voltastraße. Dort überwiegen die Frauen. Vor dem Demonstrationszug gehen bewaffnete Arbeiter und Soldaten mit roten Kokarden. Kleinere und mittlere Betriebe schließen sich an. (…) Ruf: ‚Generalstreik!‘“ Die Kasernen werden gestürmt. „Die Offiziere werden entwaffnet. Die Rangabzeichen werden ihnen abgenommen. Die Soldaten verbrüdern sich mit uns.“ MGs werden requiriert. „Matrosen auf Lastautos, Matrosen mit Gewehren. (…) Immer neue Nachrichten: ‚Der Kaiser ist geflohen.‘ ‚Auch die Gefangenen in Moabit sind frei!‘“
Scharrers „Vaterlandslose Gesellen“ endet mit dem Marsch zum Berliner Schloss: „Alles ist schwarz von Menschen. Auch im Westen und Süden waren die Arbeiterbataillone siegreich. Ganz Berlin ist zusammengeströmt. (…) Aus den Seitenstraßen kommt Gesang. ‚Rot ist das Tuch, das wir entrollen!‘ Karl Liebknecht spricht. Auf dem Schloss weht die rote Fahne.“ (VG 382)
[1] Vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 2. Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1917, Berlin 1966, 178f.
[2] Vgl. Georg Fülberth: Die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg 1914–1918, in: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1863–1975, mit einem Vorwort von Wolfgang Abendroth, hrg. von Jutta Freyberg u.a., Köln 1975, 51–64.
[3] Vgl. zur Gründung der „zentristischen“ USPD und zu den Berliner „Brotstreiks“ vom Frühjahr 1917 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 2. Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1917, 307–316.
[4] Vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 3. Von 1917 bis 1923, Berlin 1966, 26–35, 447–459.
[5] Vgl. zum „Jännerstreik 1918“ Karl Liebknecht: Gesammelte Reden und Schriften IX, Berlin 1971, 416–427 oder Richard Müller: Geschichte der deutschen Revolution. Band 1. Vom Kaiserreich zur Republik (1924), Nachdruck, Berlin 1974, 137–148 und 237–246.