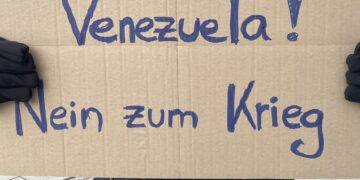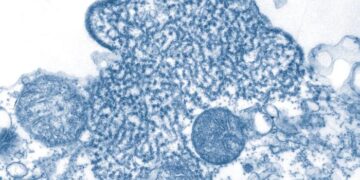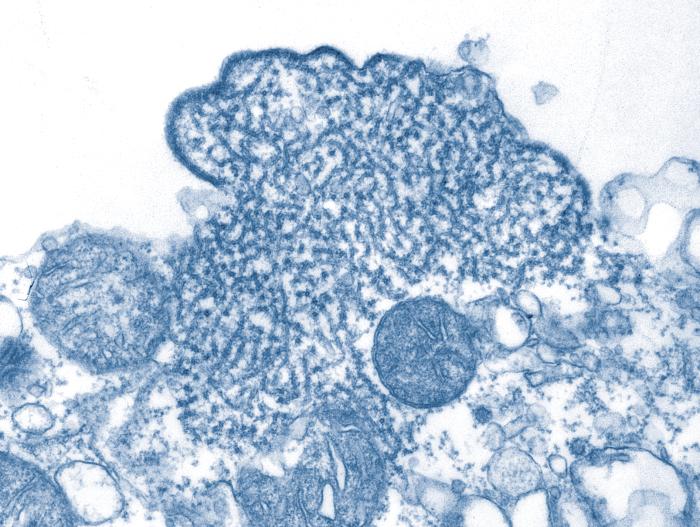Im Jahr 2015 beschlossen die Vereinten Nationen Ziele für eine nachhaltigere und gerechtere Welt. Eines dieser Ziele, das damals als erreichbar galt: Bis 2030 sollte niemand mehr gezwungen sein, von weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag zu leben. Doch nun, gut neun Jahre später, zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab. Eine aktuelle Weltbank-Studie zeigt, dass etwa 40 Prozent der Menschen in den 26 ärmsten Ländern der Welt weiterhin unter dieser Armutsgrenze leben.
Die betroffenen Länder, überwiegend in Afrika und Asien, sind ärmer als vor der Corona-Pandemie. Während sich reichere Staaten weitgehend von den ökonomischen Auswirkungen der Krise erholt haben, stecken diese sogenannten „Low-income countries“ (LICs) in einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale. Die Staatsverschuldung dieser Länder liegt durchschnittlich bei 72 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ein 18-Jahres-Hoch. Fast die Hälfte dieser Länder befindet sich entweder in einer Schuldenkrise oder steht kurz davor – eine Verdoppelung im Vergleich zu 2015.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig. Die LICs sind weitgehend auf den Export von Rohstoffen angewiesen, was sie anfällig für die zyklischen Schwankungen der Rohstoffmärkte macht. Boom-and-Bust-Zyklen, also Phasen von plötzlichem Wachstum gefolgt von Einbrüchen, prägen die Wirtschaft dieser Länder und lassen eine nachhaltige Entwicklung kaum zu. Hinzu kommt, dass zwei Drittel dieser Staaten in Kriege oder Konflikte verwickelt sind, was die ohnehin schwachen Strukturen weiter destabilisiert.
Ein weiteres Problem ist der Rückgang internationaler Finanzströme. Ausländische Direktinvestitionen und offizielle Hilfe sind auf einem 14-Jahres-Tiefpunkt angelangt, wie die Studie für das Jahr 2022 festhält. Das wenige Geld, das noch in diese Länder fließt, wird überwiegend für unmittelbare Verpflichtungen wie die Bezahlung von Staatsangestellten, Schuldenzinsen und Subventionen verwendet. Investitionen in langfristige Entwicklungsziele wie Bildung oder Gesundheit werden kaum noch getätigt.
Dabei verfügen viele dieser Länder über ein enormes Potenzial. Ihre natürlichen Ressourcen sind reichlich vorhanden, und ihre Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wächst rasch. Doch diese Ressourcen bleiben oft ungenutzt oder werden zu ungünstigen Bedingungen exportiert, was die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten weiter verstärkt. Die Weltbank erkennt in ihrer Analyse an, dass nachhaltiges Wachstum und ausgeglichene Staatshaushalte theoretisch möglich wären, wenn dieses Potenzial besser genutzt würde. Doch diese Länder sind international nicht wettbewerbsfähig – eine Folge von mehr als 150 Jahren Kolonialismus, Kapitalismus und Imperialismus, die viele von ihnen in eine Abhängigkeit von den Industriestaaten getrieben haben.
Quelle: junge Welt