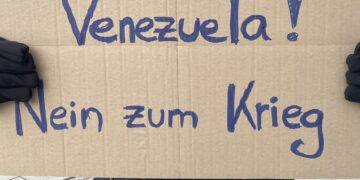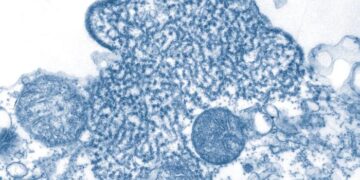Gastautor: Gerhard Oberkofler, geb. 1941, Dr. phil., Universitätsprofessor i.R. für Geschichte an der Universität Innsbruck
Der Wiener jüdische Kommunist Bruno Frei beschäftigt sich nach seinem Besuch in Auschwitz mit der Frage nach der „Überlebendenschuld“
Das Jüdische Museum in der Wiener Inneren Stadt am Judenplatz[1] hat in seinen Räumen für Wechselausstellungen das komplexe Thema „Schuld“ aufgegriffen.[2] Die von Sabine Apostolo, Gabriele Kohlbauer-Fritz, Marcus G. Patka, Hannes Sulzenbacher und Andrea Winklbauer nach einer Idee von Hannes Sulzenbacher kuratierte Ausstellung (28. März bis 29. Oktober) zeigt in zwanzig Stationen historische und künstlerische und von Texten begleitete Exponate. Dass gerade in der Stadt eines Sigmund Freud (1856–1939) in dieser Ausstellung die „Überlebendenschuld“ mit einer eigenen Station angesprochen wird, macht Sinn. Diese „Überlebendenschuld“ ist mit „Tausend Schatten rufen: Ich“ dokumentiert durch das Zeugnis der von dem aus einer polnisch-russischen jüdischen Familie stammenden Adolfo Kaminsky (1925–2023) aufgenommenen Fotografie von Piotr Raviatz, der das größte deutsche Vernichtungslager Auschwitz überlebt und 1961 Suizid begangen hat.
Traumatisierende Schuldgefühle werden sich nicht allein bei jüdischen KZ-Überlebenden finden lassen. Eine Mutter aus Afrika, deren Kinder von den Schutzstaffeln des europäischen Wertesystems im Mittelmeer ertränkt werden, eine Mutter in versklavten und ausgebeuteten Ländern, die zuschauen muss, wie ihr Kind verhungert, eine palästinensische Mutter, die ihr Kind für die Befreiung ihres Volkes erzogen hat und das dann im Einsatz für die Befreiung umkommt, alle diese Mütter werden „Überlebensschuld“ empfinden. Wenn von den mehr als 1 Million Opfern in Auschwitz die Rede ist, darf nicht das „Auschwitz“ der jüngeren Vergangenheit vergessen werden. Für den Völkermord mit Napalmbomben durch den US-Imperialismus in Vietnam und Kambodscha oder die Ausgrenzung und Versklavung von Millionen von hungernden Menschen in Afrika ist denselben dem Profit nachjagenden kleinen Gruppen von Unterdrückern und ihren Judassen geschuldet. Der Jude Jesus hat gesagt: „Man kann nicht Gott und dem Geld dienen“ (Lk 16,13).
Der Wiener Bruno Frei (1897–1988) hat seit seinen kleinbürgerlichen zionistischen und sozialdemokratischen Anfängen die Klasse gewechselt, er wurde Kommunist und hat seine ganze Lebensbahn mutig in der kommunistischen Weltbewegung eingesetzt. Tradierte Geschichtlichkeit und Metageschichtlichkeit seiner jüdischen Herkunft haben seine Biografie konstituiert.[3] Das jüdische Museum hat 2017 ihn in seiner Ausstellung „Genosse. Jude. Wir wollten nur das Paradies auf Erden“ genannt.[4] In seiner Selbstbiografie erinnert sich Bruno Frei, dass der erste Autor, den er mit Verstand aufgenommen habe, nicht Karl Marx (1818–1883) war, „sondern ein jüdischer Publizist aus der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. u. Z. namens Jeremias“.[5] Mit Heinrich Heine (1797–1856), dem er in seiner Emigration in Mexiko-Stadt mit anderen deutschsprachigen Emigranten ein lebendes Denkmal gesetzt hat, stellt Bruno Frei fest: „Dem Bösen gegenüber gibt es keine Neutralität“.[6] Damit wird ausgedrückt, dass „Schuld“ keine philosophische Spekulation ist, sondern praktisches Handeln jedes Einzelnen für eine andere, für eine bessere Welt erfordert. Die religionsphilosophischen Ansichten von Mose ben Maimon (Maimonides, 1135–1204) war die Richtschnur von Bruno Frei: „Nicht zwingt der Schöpfer den Menschen, nicht beschließt er über sie, dass sie Gutes oder Böses tun, sondern alles ist ihnen überlassen“.[7]
„Ich wurde nicht vernichtet. Mit welchem Recht?“
Bruno Frei hat sich in Auschwitz-Birkenau die Frage gestellt: „Ich wurde nicht vernichtet. Mit welchem Recht?“. Er schreibt nach einem Besuch in Israel, wohin er im Sommer 1964 zur „Selbstverständigung“ gereist ist, einen emotionalen, an seine jüdisch religiöse Jugend anknüpfenden Text mit dem Titel „Die Haarflechte. Judenverfolgung von den Römern bis Auschwitz“. Der deutsch jüdische Schriftsteller Stephan Hermlin (1915–1997) hat 1949 Auschwitz besucht und wie Bruno Frei notierte er voll Entsetzen den „unaustilgbaren Makel einer Menschengruppe, die der Bestialität verfiel“. Und, so Stephan Hermlin: „Man denkt plötzlich, wie man so oft schon daran gedacht hat, was noch geschehen wäre ohne die Rote Armee“.[8] In dem hier wiedergegebenen, mit Schreibmaschine konzipierten Text sind die vielen eigenhändigen handschriftlichen Durchstreichungen, Verbesserungen oder Einschübe von Bruno Frei berücksichtigt, aber nicht separat gekennzeichnet. Für Bruno Frei ist die vom deutschen Faschismus betriebene Vernichtung des jüdischen Volkes mit der biblischen Geschichte zu interpretieren.[9]
»Der Autobus brauchte kaum eine Stunde. Das Gezwitscher und Gekicher der Schülerinnen, die den unterrichtsfreien Tag genossen, als wär‘s ein Ausflug ins Grüne, verleidete mir die Fahrt. In Krakau hatte man mir geraten, mich einer Reisegesellschaft anzuschließen, aber ich glaubte, im Linienbus, ohne Touristengeplapper, würde ich mich eher sammeln können. Zugleich war mir bewusst, wie gekünstelt, geradezu lächerlich, meine Befangenheit war. Konnte man Auschwitz nicht besichtigen wie andere Gedenkstätten? Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen – für seelische Erschütterungen gab es ein professionelles Training. Warum dieses dumme Herzklopfen im Anblick des Straßenschildes OSWIECIM?
Ich passierte das Tor mit der bekannten Aufschrift „Arbeit macht frei“. Der Ansichtskartenkiosk im Vorhof des Museums versetzte mich in Wut. Auf den Bänken der Grünanlagen verschnauften fußmüde Besucher. Den Bruchteil einer Sekunde regte sich der Wunsch umzukehren.
Die Birke. Ich hatte alles gelesen, ich wusste alles. Dennoch war es nicht möglich, die Bilder zu verscheuchen, die aus gedruckten Zeugnissen und Gerichtsprotokollen zwanghaft ins Bewusstsein drängten. Also hier. Genau hier wickelte sich Tag für Tag jene teuflisch Routine ab, die lebende Menschen in Objekte der Vernichtung verwandelte. Hier wurden sie zum letztenmal mit ihren Namen aufgerufen. Von da an waren sie Nummern oder Leichen.
Waren es nicht vier Millionen? Einige standen mir nahe. Tante Rosa aus Preßburg – als Einzelne verschwindet sie unter den vier Millionen, aber seltsamerweise steht sie jetzt lebensnah vor mir und die Millionen verblassen.
„Museum Oswiecim-Auschwitz“. Ohne mich aufzuhalten, eile ich durch den Block 15. „Geschichtliche Einführung“ habe ich nicht nötig. Soll die Lehrerin die Kinder geschichtlich einführen, falls ihr gelingt, deren Aufmerksamkeit zu fesseln. Unmittelbar dahinter geht es zum Block 4: „Vernichtung“. Noch einmal muss ich die Schaubilder vom „Verlauf der Vernichtung“ sehen, die Geschichte des „Kombinats der Vernichtung“ über mich ergehen lassen. Ein elendes Gefühl steigt auf. Ich wurde nicht vernichtet. Mit welchem Recht?
Und dann stehe ich vor den Schaufenstern der Vernichtung. Das freilich gibt es nur in Auschwitz. Bin ich deshalb gekommen? Berge von Koffern mit handgeschriebenen Namensschildern, Magazine von Brillen, Krücken, Prothesen. Warenlager von Damen- und Herrenschuhen. Regale mit Zahnbürsten, Rasierpinsel. Mäntel, Hüte, Kleider.
Vor der Glaswand, hinter der Frauenhaar, zu Ballen gestapelt und in Strähnen aufgelöst, die Vitrine in Saaleslänge füllt, bleibe ich stehen. „Als die Sowjetarmee das Lager befreite, fand man in den Lagerräumen 7000 kg in Papiersäcke verpacktes Frauenhaar“ leiert der Führer seinen Text herunter. „Dies war nur ein kleiner Rest der Haare, die von der Lagerverwaltung nicht mehr zur Verarbeitung in die in Bayern gelegenen Werke der Firma Alex Zink geschickt werden konnten. Das Werk zahlte 50 Pfennig pro Kilo. Aus den Haaren der getöteten Frauen machte man Rosshaargewebe. Auch als Feindichtung fanden sie Verwendung“.
Im Vordergrund des Haargebirges bleibt mein Blick an einem streng geflochtenen, dunkelbraunen Zopf haften. Noch einer und dann noch einer. Wieder löste sich mir die Unzahl von vier Millionen auf; deutlich konnte ich eine junge Frau wahrnehmen. Eine Jüdin. Die Haarflechte, dunkelbraun, gab ihr ein freundliches Aussehen. Lebensnah sah ich sie vor mir, wie Tante Rosa. Natürlich begleitete das Bild mein Wissen, dass die Frau, die ihr Haar allmorgendlich zu flechten pflegte, im „Kombinat der Vernichtung“ verröchelt ist. Wie sonst wäre ihr Haar in die Vitrine gekommen?
Genug. Ich gehe dem Ausgang zu. „Das habe ich bereits einmal gesehen“ – sage ich, an den Führer gewandt, der Anstalten machte mich zurückzuhalten. „Waren Sie schon früher in Auschwitz?“. – „Nein“ erwidere ich. „In Auschwitz bin ich zum erstenmal“.
Jerusalem war gefallen
Drei Männer, von speerbewaffneten Soldaten begleitet, keuchten den Schlangenpfad hinauf, der zur Festung führte. Die Sonne stand bereits tief am wolkenlosen Firmament, ihr Widerschein rötete die moabitischen Berge am jenseitigen Ufer des Toten Meeres. In der trocken-heissen Luft fiel den Wanderern das Atmen schwer, das Wasser perlte von ihrer Stirn. Unsicheren Schrittes stapften sie aufwärts, in Sandalen, die auf dem Geröll keinen Halt boten. Der Aufstieg auf dem jäh abfallenden Felshang schien kein Ende zu nehmen. Auf den verschmutzten und verschwitzten Oberhemden hingen die Fransen aus hellblauer Wolle, die das Gesetz vorschreibt. Der Mann an der Spitze unterschied sich von seinen Gefährten durch einen Überwurf, der einmal weiss gewesen sein mag, aber eingerissen war nach dem Brauch der Totenklage. Während die Fremden nur mühsam vorankamen, marschierten die Speerträger, berggewohnt, vor und hinter ihnen. Ehrengeleit oder Bewachung? Kein Wort wurde gesprochen.
Jerusalem war gefallen, der Tempel eingeäschert, die Kämpfer erschlagen. Belagerung und Mauerbrecher haben die Heilige Stadt zu Fall gebracht. Nachdem auch die stark befestigte Oberstadt von den römischen Soldaten erstürmt worden war, kämpften die letzten Eiferer in den unterirdischen Gängen ohne Hoffnung weiter, bis alles Leben in dem brennenden Palast des Herodes[10] erloschen war. Die Menschen, vom Hunger entkräftet, von der Soldateska gejagt, von den Flammen eingekreist, versuchten dem Gemetzel zu entgehen, den rauchenden Trümmern ihrer Stadt zu entfliehen. Wenigen gelang es.
Die Männer und Frauen, auch Kinder gab es, die sich in mühevollem Zug durch die Wüste Judäa schleppten, hatten ein Ziel vor Augen: die uneinnehmbare Festung Masada. Dort, das wussten sie, haben die Eiferer sich zu einem letzten Widerstand gesammelt, dort, wenn überhaupt, gab es noch Hoffnung.
Als der Zug sich dem Toten Meer näherte, wunderten sich die Wanderer über das Grüne der Pflanzungen; vom Krieg scheinbar unberührt bestellten die Bauern das Land; Dattelpalmen, Olivenhaine, Feigenbäume spiegelten den gehetzten Städtern ein Bild des Friedens vor.
Sie wussten: das Bild täuschte. Nicht Frieden, sondern Krieg und Knechtschaft waren im Lande Judäas.
In der Gegend von Engedi, am Ufer des Meeres, stellten Wachposten die Marschierenden. Beschlossen und vereinbart wurde, dass eine Abordnung von drei Vertrauensmännern dem Kommandanten der Festung die Bitte vortragen sollten, er möge die Flüchtlinge in den Schutz seiner Wälle nehmen, im Namen des Allmächtigen, der sie aus dem Verderben der Hauptstadt gerettet hat.
Eleasar ben Jaïr war ein schriftkundiger, ein politischer Soldat.[11] Sein Großvater, als „Juda der Galiläer“ bei Freund und Feind hochberühmt, hatte das Volk gegen die römische Großmacht in den Aufstand geführt. Darüber waren nun schon mehr als sechzig Jahre vergangen. Von den blühenden Ländereien im Norden hatte sich die Revolte über das ganze Land ausgedehnt, bis sie nach wechselvollen Kämpfen, in den großen Befreiungskrieg einmündete. Jahr und Tag lieferten die Freischärler, Väter und Söhne, den Kohorten der Gouverneure in Caesarea[12] zahllose Gefechte, überfielen Truppenlager, befreiten Sklaven, verbrannten Archive, wo die Schuldverschreibungen aufbewahrt waren. Landlose Bauern, entlaufene Leibeigene, städtische Arme, jugendliche Patrioten, auch mancher Abenteurer, stießen zu den Aufständischen, vergrößerten ihre Reihen, so dass sie schließlich das flache Land beherrschten und die römische Besatzungsmacht auf die Städte und befestigte Plätze zurückdrängten.
Juda der Galiläer, Eleasars Großvater, hatte, ehe er im Kampf fiel, die Freiheitskämpfer beschworen, gestützt auf das von den Fremden unterdrückte, von den Kollaborateuren verratene Volk, in fester Ordnung einig zu bleiben; nur so würden sie der Macht Roms widerstehen können. Krieg führen freilich müssten sie anders als die Römer: der Feldschlacht ausweichen, in kleinen Gruppen auf den überraschten Gegner ausschwärmen und ebenso schnell den Rückzug antreten.
Diese Kampfregel folgten auch die Söhne des Juda von Galiläa, Jakob und Shimon, ehe sie im Jahre der Hungersnot in die Hände der Römer fielen und am Kreuze starben. Die Besatzer, und wer zu ihnen hielt, hatten für die Kämpfer in den Bergen nur Schmähungen bereit: Räuber schimpfte man sie, Zeloten, das heißt Fanatiker, Sicarier, das heißt Dolchmänner; gemeinen Wegelageren gleich wurden sie, einmal gefangen, ans Kreuz geschlagen. Sie selbst aber nannten sich die „Eiferer“, denn sie eiferten im Namen des Herrn, der ein eifervoller Gott ist, für Heimat und Gerechtigkeit, für den endlichen Triumph der reinen Lehre. „Der Tag wird kommen“ hatte Juda der Galiläer, ihr Meister, gelehrt, „doch man muss seinem Kommen nachhelfen“.
Das großväterliche Erbe war schwer, drückender aber war die Erinnerung an das Selbsterlebte. In jungen Jahren schon hatte er höchste Erhebung und tiefste Erniedrigung erfahren und zwischen einem und dem andern, finstersten Verrat.
Als Jakob und Shimon, Brüder seiner Mutter, hingerichtet wurden – auch damals munkelte man von Verrat – war er noch ein Kind, glühend in Liebe und Hass, wohlverteilt beides. Herangewachsen hatte er sich selbstverständlich dem Mann angeschlossen, der das Werk des Großvaters fortsetzte: Menahem, Sohn des Juda von Galiläa.
Welch ein Soldat! Welch ein Staatsmann! Dürstend nach Hoffnung und Erlösung nannte ihn die Menge „den Tröster“, wie es seinem Namen entsprach. Der Erfolg schien zum Greifen nahe. Doch der Abfall des Tempelhauptmannes Eleasar Sohn des Chananja in der Stunde der Entscheidung vereitelte den Sieg der Unbedingten und Menahem musste im Tempelbereich sein Leben lassen. In jener schweren Stunde, die über alles entschied, was weiter geschehen sollte, hat Eleasar ben Jaïr den Entschluss gefasst, die Treuesten der Treuen zu sammeln und an ihrer Spitze nach Masada zu marschieren. Von dort war Menahem ausgezogen, die Entscheidung sei nahe, um in Jerusalem die Führung des Aufstandes an sich zu reißen. Die Festung hatte er durch Handstreich genommen und sie, nachdem er die erbeuteten Waffen der Römer und seinen Anhängern verteilt, zum Stützpunkt der Unentwegten gemacht. Als diese jedoch, festgefahren im Straßenkampf um die Macht in der Hauptstadt, von den Gemäßigten unter Führung des abtrünnigen Hohepriestersohnes Eleasar überfallen und ihres Führers beraubt wurden, blieb den Gefolgsleuten Menahems nur der Rückzug nach Masada.
[…]
Dies alles, wie Eleasar erzählte, war wohlbekannt, war doch das ganze Land Kriegsschauplatz geworden. Das aber sei nicht alles, setzte der Sprecher fort. Was Jotapata[13] zum Merkzeichen des Krieges gemacht hat, war des Josefs Abfall und Verrat. Dieser Josef hatte sich während der Belagerung in der Stadt aufgehalten und nachdem die Festung gefallen war in einer Zisterne versteckt, die mit einer Höhle in Verbindung stand. Darin hatten vierzig Patrioten vor dem Massaker Zuflucht gefunden. Als die Römer das Versteck ausfindig machten, forderten sie Josef auf, sich zu ergeben, denn sie kannten ihn bereits. Er war bereit, die andern nicht. Die Unentwegten bedrohten den Willfährigen am Leben, so dass dieser schließlich dem Schwur zustimmte, dass sie allesamt freiwillig sterben wollten. So geschah es. Sie fielen je einer durch die Hand des andern. Nur Josef brach den Eid, den er den andern geleitet. Mit einem Gefährten war er zuletzt geblieben, diesen entwaffnete er und ergab sich Vespasian[14]. Er wurde dessen Schreibsklave.
Eleasar brachte seiner Geschichte mit großer Not zu Ende, oft von wilden Rufen unterbrochen, selber ließ er seiner Erregung freien Lauf. Als er geendet hatte, schickte er sich an, die Versammlung in der Synagoge mit dem Festgebet der Anrufung unseres Vaters, unseres Königs zu beenden, als plötzlich vom Vorplatz der Schrei einer Frau die eingetretene Stille zerriss. „Nein, nein, nein!“ Verzweiflung und Entschlossenheit waren in diesem Schrei. „Ich will nicht sterben. Mit meinen Kindern werde ich ein Schiff besteigen. Auch in Alexandrien gibt es Juden, sogar Eiferer. Meine Kinder sollen leben und sei es in der Fremde. Sie werden in unbekannten Zungen sprechen, die Botschaft weitergeben von dem einen, einzigen Gott“.
Die Rede der Frau brachte Unruhe in die Gemeinde, fast wäre es zu einem Handgemenge gekommen, da richtete Eleasar noch einmal mit Macht das Wort an die Versammelten. „Was du sagst, ist recht und Gott zum Gefallen, Frau! Niemand soll dich gering ansehen, weil du leben willst mit deinen Kindern. Gott hat ihnen das Leben gegeben und wer kann es ihnen nehmen, wenn nicht Gott? Aber auch die Männer und Frauen, die den Tod der Unterwerfung vorzogen, handelten in ihrem Herzen gottgefällig. Wie sie Gottes Absicht in der Welt deuteten, stand ihnen das Leben des Volkes höher als das eigene Leben. Danach ist nicht dein Sinn, Frau, so ziehe dahin. Aber nicht blind sollst du zu den Fremden gehen, wissen sollst, was das Gesetz der Fremde ist“.
Mittlerweile hatte sich die Säulenhalle geleert. Auf dem freien Platz zwischen Synagoge und der Kasematten Mauer sammelten sich die alten und die neuen Inwohner von Masada, um des Kommandanten Antwort an die Zwischenruferin anzuhören.[15] Wieder erging sich Eleasar in Geschichten, die allen wohlbekannt waren, denn sie hatten sich vor nicht langer Zeit, ja manche zu ihren Lebzeitenereignet. Im Munde Eleasars in dem Zusammenhang, in dem er sie darbot, schienen die furchtbaren Geschehnisse eine neue Wahrheit zu enthalten. Diese Frau, wandte sich Eleasar an die Menge, sei von edler Absicht erfüllt, ihre Kinder, so habe sie es in ihrem Herzen beschlossen, sollen die Botschaft vom einigen, einzigen Gott zu den Völkern tragen. Wie aber, wenn die Völker die Boten mit Steinen empfangen? Juden nichts weiter sein sollen als Juden, deren Anspruch auf Botendienst würden in allen Ländern der Zerstreuung beleidigt, gemartert, erschlagen. Daran müsse man denken, nicht auf Verteidigung bis zum letzten Atemzug. Eleasar weckte die Erinnerung an die Zerstörung der mächtigen Gemeinde von Alexandrien zur Zeit des Kaisers Caligula[16], kaum dreißig Jahre sei es her. Bilder des Grauens ließ der Redner entstehen. Wie sie jüdische Häuser in Brand steckten, die Schiffe der jüdischen Kaufleute zerstörten, die Juden bei lebendigem Leibe in die Flammen ihrer Häuser warfen. Sei solches geschehen, ehe Judäa sich gegen die Romherrschaft erhoben hatte, wie erst wüteten die Judenfeinde in den Städten Syriens, nachdem der Aufstand in Judäa begonnen hatte! In Antiochia und in Damaskus hätten die Heiden die Synagogen angezündet, die Juden zu Paaren getrieben und auf Scheiterhaufen verbrannt. Und was das Blut noch heftiger zum Kochen bringen müsse: es sei ein jüdischer Renegat gewesen, der das Vernichtungswerk auslöste. Die den Krieg mitgemacht, wissen aus Eigenem, was in Caesarea, der Residenz des Statthalters Florus geschehen ist. Die ganze jüdische Gemeinde sei vernichtet worden, tausende seien erschlagen, zehntausende als Sklaven auf die Galeeren gebracht worden. Caesarea sei judenrein gemacht worden – im jüdischen Land. Wohin es führe, setzte Eleasar seinen Bericht fort, wenn Juden glauben, Unterwerfung, Verrat, Kollaborieren, mache sich bezahlt, so müsse an das Schicksal von Bet Schean erinnert werden, das Griechen und Römer Skythopolis nennen.[17] Dort hätte die nichtjüdische Mehrheit den Juden versprochen von der fälligen Verfolgung abzusehen, wenn sie mithelfen, die Stadt gegen die Eiferer zu verteidigen, die sich anschickten Bet Schean zu nehmen. Die verblendeten Juden seien in die Falle gegangen, sobald die Eiferer verscheucht waren, hätten die Heiden ihre jüdischen Mitbürger in einen außerhalb der Stadt gelegenen Hain gelockt und alle niedergemacht. Damals sei es geschehen, dass Simon der Sohn des Paul, von Reue über den von ihm mitverschuldeten Untergang seiner Gemeinde sich selbst in das Schwert stürzt, nachdem er seine ganze Familie getötet hatte.
Aber in Rom, der Hauptstadt der Welt, da gingen die Juden doch ihren Geschäften nach, unbehelligt, auch der Gottesdienst sei ihnen erlaubt, denn Rom hat keine Zeit, sich um die Götter der Untertanen zu kümmern.
„Ist es nicht so? So ist es; nur wie lange die kaiserliche Gnade erhalten werde, wann wieder ein Caligula im Palatin sitzen wird, das weiß niemand“.
Auf Scherze verstand sich Eleasar nicht sehr, auch war die Stunde zum Scherzen nicht angelegt; sein zerfurchtes Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. Ob der Herr der Welt eine angenehme Nacht verbracht habe, sei für Wohl und Wehe der Juden von Rom wichtiger als die Beschlüsse des Synhedrions. Im Zeichen der Judensteuer sei selbst ein römischer Bürger nur ein Geduldeter, sofern er Jude ist. „Das sollst du wissen, Frau, wenn du deine Kinder zu den Völkern bringst“.
Es war ein brütendes Schweigen auf dem Felsdach zwischen Himmel und Erde. Unbarmherzig glühte die Wüstensonne und färbte Berge und Bauten gelb. Der Wind brachte feinen, heißen Sand, der in die Kleider eindrang und das Atmen erschwerte.
In das Schweigen warf die Stimme des Leviten die Klage des Psalmisten: „Denn wir werden ja um deinetwillen täglich erwürget und sind geachtet wie Schlachtschafe“. Flehend kam die Antwort aus der Mitte der Menge, der Weißgekleidete die Arme zum Himmel erhob: „Erwecke dich Herr, warum schläfst du? Wache auf und verstoße uns nicht so ganz. Warum verbirgst du dein Antlitz, vergisst unseres Elends und unsere Bedrängnis“.
Ob es Hoffnung gebe, sei er gefragt worden, schloss Eleasar an diesem denkwürdigen Tag seine Ansprache an alle, für die Masada letzte Zuflucht geworden war. Die goldene Zeit sei gewiss, da „kein Volk wider das andere sein Schwert aufheben wird“ und alle Völker eine Familie sein werde und Israel mit ihnen. Aber wann werden wir diese Gewissheit mit unseren Augen sehen? Dass die Verteidiger der letzten Festung Israels sich nicht ergeben werden, diese Gewissheit werde in unseren Tagen sichtbar werden. Lieber sterben von eigener Hand, als den wilden Tieren im Amphitheater vorgeworfen werden, dem Pöbel zur Belustigung. So über alles Maß die Vernichtungswut gegen uns sich steigern mag, unzerstörbar ist der Wille des Volkes zu überleben. Dafür soll dieser Felsen zeugen“.
Die Sonne hatte den Zenith längst überschritten. Erde, Meer und Himmel waren in Feuer getaucht. An der Mauer der Kasematten zeigten sich die ersten Abendschatten.
„Lieber Masada als Auschwitz“
„Lieber Masada als Auschwitz“. Mit diesen Worten beschloss der Professor die Führung. Im Archäologischem Institut der Universität Jerusalem war ich angemeldet, um über die Ergebnisse der Ausgrabungen im Bereich der Höhlen und Felsen am Toten Meer Einzelheiten zu erfahren. Der Leiter des Instituts, Professor Yigael Yadin[18], hatte in zwei Grabungscampagnen zwischen 1963 und 1965, mit Unterstützung der israelischen Streitkräfte und Freiwilliger aus vielen Ländern, die seit 1900 Jahren verschütteten Geheimnisse von Masada bloßgelegt. Der Professor mit schwarzem Spitzbart, Yadins rechte Hand, zeigte sich aufgeschlossen.
Die Forscher hätten ihren Augen nicht getraut, als sie unter Schutt und Staub von Jahrhunderten den entsetzenerregenden Bericht des Flavius Josephus[19] über den Massenselbstmord der letzten Verteidiger von Masada bestätigt fanden. Was jener jüdisch-römische Zeitgenosse in seiner Geschichte des Jüdischen Krieges für die Nachwelt aufgezeichnet hatte, war also keine Legende; der Spaten brachte es an den Tag.
Da lagen unter dem Schutt die Skelette eines jungen Mannes, einer jungen Frau und eines Kindes. Daneben hunderte von Silberplättchen, offensichtlich Bestandteile einer Rüstung, ferner Pfeilspitzen, Fragmente eines Gebetstuches, eine Tonscherbe mit Aufschrift. Neben dem Skelett der Frau lagen ihre Sandalen. Auch Nahrungsreste, wie Dattel- und Olivenkerne, Münzen, geprägt zur Zeit des Aufstandes, Küchengeräte, Stoffreste, Schriftrollen und schließlich einen Haufen von menschlichen Knochenresten fanden die Wissenschaftler.
Der erregendste Fund, berichtet der Expeditionsleiter, seien merkwürdig beschriebene Gefäßscherben gewesen, die zum Auslosen der Reihenfolge der Selbstmörder gedient haben. Die Scherben trugen Namen. Einer davon war „ben Jaïr“.
Als die Römer nach einer ungemein aufwendigen Belagerung die Festung stürmten, verhallte ihr Kriegsgeschrei, unnatürliche Stille erwartete sie. Zwei Frauen, berichtet der antike Geschichtsschreiber, die sich mit ihren Kindern versteckt hatten, kamen hervor und erzählten, was geschehen war. 960 Männer und Frauen, die Besatzung der letzten Festung Judäas, hatten sich in der Stunde, da kein Widerstand mehr möglich war, selbst getötet und ihr Lager in Brand gesteckt.
Sechzig Jahre später, erzählt der Professor, haben die letzten Kämpfer des letzten Rebellen Bar Kochba[20] dasselbe getan. „In den wilden Klippen des Nahal Hever unweit der Oase Engedi haben wir in einer rauchgeschwärzten Höhle ihre Spuren gefunden. Wie die Verteidiger vor ihnen von Masada ergaben sie sich, hoffnungslos eingeschlossen von den Belagerern, nicht. Sie töteten sich“.
Unter den Fundstücken aus Masada berührte mich mehr als alles die dunkle, volle Haarflechte einer jungen Frau, die aussah, als sei sie eben frisiert worden. Die Haarflechte ist neben dem Skelett gefunden worden. In der außerordentlich trockenen Luft war sogar ein Stück Kopfhaut erhalten geblieben. «
Weil Bruno Frei sich mit der biblischen Geschichte des jüdischen Volkes identifizierte, war für ihn die von der Sowjetunion in der Vollversammlung der UNO vom 26. November 1947 angesichts des Leids der Juden in Europa begrüßte Gründung des Staates Israel (14. Mai 1948) die Möglichkeit, die „jüdische Mission“, von der Lion Feuchtwanger (1884–1958) gesprochen hat, zu verwirklichen, „ein Staat zu sein, nicht wie alle Staaten, gezeichnet vom moralischen Nihilismus, ein Staat vielmehr, wo der Mensch dem Menschen Bruder ist und nicht Wolf“.[21] Mit Israel hätte die Juden das Vermächtnis von Bar Kochba gewählt.[22] Noch 1967 hat sich Bruno Frei als einer der wenigen Kommunisten in Wien mit Israel aufgrund des Sechstagekrieges solidarisiert.[23] Das unterscheidet ihn vom antikommunistischen jüdischen Wiener Schriftsteller Hans Weigel (1908–1991), der sich von Israel öffentlich distanzierte als es, so Bruno Kreisky (1911–1990) zitierend, „faschistoid“ geworden ist.[24]
Hat sich der Judenstaat Israel jemals an die jüdisch biblische Tradition erinnert? Nach Auffassung von Papst Franziskus (*1936) lebt die Menschheit die biblische Geschichte von Kain und Abel fort. Am 18. Mai 2023 drohte ein Flaggenmarsch von ca. 20.000 jüdischer Rechtsradikaler mit messianischem Sendungsbewusstsein durch die Altstadt von Jerusalem, es werde eine zweite Nakba kommen. Heute wird gegen die palästinensische Bevölkerung ein „Nervenkrieg“ mit gezielten Tötungen geführt, wie sie die jüdischen Verbände Anfang März 1948 erstmals eingesetzt haben.[25] Zu diesem „Nervenkrieg“ gehört, dass im Frühjahr 2002 die auf Befehl von Kaiser Constantinus (272? – 337) in Bethlehem zur Erinnerung an die Geburt von Jesus errichtete Basilika vierzig Tage lang Schauplatz eines israelischen Gefechts gegen zweihundertvierzig, in die Kirche geflüchteten Palästinenser war?[26]
Die 1843 niedergeschriebene Auseinandersetzung von Karl Marx mit Bruno Bauer (1809–1882) über das Verhältnis von Christentum und Judentum ist der Beginn seiner fundamentalen und ohne erkennbare jüdische Wurzeln entwickelten Gedanken über den dialektischen und historischen Materialismus. Der moderne Mensch müsse über die Toleranz der Religionen einschließlich der Privatreligionen hinauskommen. „Das Judentum“, so Marx, „hat sich nicht trotz der Geschichte, sondern durch die Geschichte erhalten“.[27] Auch wenn Marx die Frage, was denn der weltliche Kultus und der weltliche Gott des Judentums ist, mit „Der Schacher“ und „Das Geld“ beantwortet und in seinem Text nach der Juniniederlage 1848 beispielsweise vom „Frankreich der Börsenjuden“, welche mit der „Dynastie Rothschild“ tatsächlich existierte, verwendet, ist es der Zeit nach Auschwitz geschuldet, ihm „Judenfeindliches“ vorzuwerfen.[28] Die Grundaussage von Marx über die Juniniederlage 1848 ist „Die Revolution ist tot! – Es lebe die Revolution!“.[29]
Bruno Frei hat gehofft, dass die Juden einst mit ihrem verheißenen Land Israel die Welt des Sozialismus bereichern werden.[30] Bruno Frei war ein utopischer Kommunist, der von der Armut und Ungerechtigkeit ausging, in der die Mehrheit der Menschen von den Reichen gefesselt wird. Als Marxist wird er nicht übersehen haben können, dass neben Bank und Börse eine „sozialistische Synagoge“ mit ihren Hohenpriestern nur die Aufgabe hat, „das gelobte Land zu entdecken“ und „das neue Evangelium zu verkünden“, um das Proletariat zu beschäftigen.[31] Von jüdischen Marxisten war da und dort bekannt, dass für sie gelegentlich Marx, der jüdischer Herkunft ist, eine Art Talmud war, wenn auch nützlicher. Im zaristischen Russland hat der von Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924) als Intellektueller zur Kenntnis genommene Jewgeni Tschirikow (1864–1932) 1904 das auch in deutscher Sprache veröffentlichte Stück „Die Juden“ geschrieben, in dem der junge und fromme jüdische Lehrer Nachmann einem gealterten, wie ein biblischer Patriarch ausschauenden Leiser Frenkel sagt: „Wartet nur ab, bis euer Marx kommt und alle Menschen in das verheißene Land führt! Wartet immer weiter auf euren Marx! Aber seht zu, dass er nicht etwa vergisst, die Juden mitzunehmen, wenn er alle Menschen in das verheißene Land führt! – Er wird’s vergessen! Er wird’s vergessen – die Juden wird er vergessen!“.[32]
Die Ausstellung am Judenplatz kann dazu mahnen, hinter die praktizierte Heuchelei der Gegenwart zu schauen. Mit dem unbeugsamen, aufrichtigen Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), dessen Bronzestatue wenige Schritte vor dem Eingang ins Jüdische Museum auf dem Judenplatz aufgestellt ist, lässt sich hoffen: „Sie wird kommen die Zeit, da der Mensch das Gute tun wird, weil es das Gute ist, nicht weil willkürlich Lohn und Strafe darauf gesetzt sind“.[33]
[1] Zu den Örtlichkeiten vgl. Oskar Kostelnik: Jüdische Spuren in Wien. echomedia media buchverlag Wien 2018.
[2] Schuld. Guilt. Herausgegeben durch das Jüdische Museum Wien. Jüdisches Museum Wien. Judenplatz. Wien 2023.
[3] Gerhard Oberkofler: Mit der Ethik der Väter (Pirkey Aboth) zum Denken und Handeln für eine geschwisterliche Welt – Teil 1 – Zeitung der Arbeit; Mit der Ethik der Väter (Pirkey Aboth) zum Denken und Handeln für eine geschwisterliche Welt – Teil 2 – Zeitung der Arbeit
[4] Hg. von Gabriele Kohlbauer-Fritz und Sabine Bergler im Auftrage des Jüdischen Museums Wien. Amalthea Verlag ein 2017, S. 30 f.
[5] Bruno Frei: Der Papiersäbel. Autobiographie. S. Fischer Verlag Frankfurt a. M. 1972, S. 117
[6] Bruno Frei: Sachwert und Flamme. In: Ich hab ein neues Schiff bestiegen. Heine im Spiegel neuer Poesie und Prosa. Eine Anthologie. Hg. von Uwe Berger und Dr. Werner Neubert. Aufbau Verlag Berlin und Weimar o. J., S. 186–189.
[7] Moses ben Maimon (12. Jh.): Über die Freiheit des Willens. In: Sendung und Schicksal. Aus dem Schrifttum des nachbiblischen Judentums. Mitgeteilt von Nahum Norbert Glatzer und Ludwig Straube. Schocken Verlag Berlin 1931, S. 36–40, S. 38; zum Text vgl. Geschichte des jüdischen Volkes. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger, Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menachem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben von Haim Hillel Ben-Sasson. Mit einem Nachwort von Michael Brenner. Verlag C. H. Beck München 6. A. 2016; dazu Lexikon des Judentums. Chefredakteur John F. Oppenheimer, New York. Mitherausgeber Emanuel Bin Gorion, Tel Aviv, E. G. Lowenthal, London/Frankfurt a M., Hanns G. Reissner, New York. C. Bertelmann Verlag Gütersloh 1967.
[8] Stephan Hermlin: Die Sache des Friedens. Aufsätze und Berichte. Verlag Volk und Welt. Berlin 1953, S.176–183 (Auschwitz ist unvergessen); wiederabgedruckt in: Äußerungen 1944–1982. Aufbau Verlag Berlin und Weimar, 1983, S.85–89.
[9] Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands. Nachlass Frei. 20126 / Q 4.
[10] Jüd. König 37–4 v. u. Z.
[11] Ben-Sasson, S. 339 und öfters.
[12] Caesarea, Kessarija, Hafenstadt zwischen Natania und Haifa, von Herodes gegründet und zur Römerzeit Hauptstadt der Provinz Judäa, Sitz des römischen Statthalters. Lexikon des Judentums, Sp. 138.
[13] Festung in Galiläa, von Josephus verteidigt, von Vespasian erobert.
[14] Vespasian, röm. Kaiser 69–79 n. u. Z.
[15] Be-Sasson, Geschichte des jüdischen Volkes, S. 339 spricht von der“ berühmten Masada-Rede“ des Eleasar ben Jaïr, S. 339.
[16] Caligula, röm. Kaiser 37–41 n. u. Z.
[17] Lexikon des Judentums, Sp. 90.
[18] Yigael Yadin—Wikipédia (wikipedia.org)
[19] Josephus Flavius 37- ca 105 n. u. Z., lebte nach Jerusalems Zerstörung (70 n. u. Z.) in Rom
[20] Bar Kochba [„Sternensohn“], messianischer Beiname des Simon bar Koseba aus der Stadt Koseba in Juda, Führer des letzten großen Aufstandes der palästinensischen Juden gegen die Römer (132–135) und Rückeroberer Jerusalems. In Bethar eingeschlossen, fiel er mit der Besatzung. Lexikon des Judentums, Sp. 74.
[21] Bruno Frei: Israel zwischen den Fronten. Utopie und Wirklichkeit. Europa Verlag Wien / Frankfurt / Zürich 1955; derselbe: Die Heilige Utopie. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte des jüdischen Volkes. Gival-Haviva. Kibbutz-Artzi. Israel [ca 1981]; Zitat Die Heilige Utopie, A. S. 50.
[22] Frei, Der Papiersäbel, S. 378.
[23] Evelyn Adunka: Die vierte Gemeinde. Die Geschichte der Wiener Juden von 1945 bis heute. Philo Verlagsgesellschaft Berlin / Wien 2000, S. 261.
[24] Hans Weigel: Man kann nicht ruhig darüber reden. Umkreisung eines fatalen Themas. Verlag Styria, Graz / Wien / Köln 2. 1986, S. 12.
[25] Younes R. Altamemi: Die Palästinaflüchtlinge und die Vereinten Nationen. Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlingsproblem (WAR). Band VII. Wilhelm Braumüller Verlag Stuttgart 1974.
[26] Bethlehem Reborn. UNO 2023 (Ausstellung); P. Martin Ramm FSSP: Heiliges Land. Pilgern auf den Souren Jesu. Thalwil 3. A. 2018.
[27] MEW 1 (1972), S. 347–377, hier S. 374.
[28] Artikel Judenfrage in: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Band 3. Im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig hg. von Dan Diener. J. Metzler Verlagsbuchhandlung Stuttgart 2012, S. 228–233 (Thomas Haury).
[29] MEW 7 (1973), S. 12–34 (Die Juniniederlage 1848).
[30] Frei, Israel, S. 10.
[31] MEW 7 (1973), S. 19.
[32] Eugen Tschirikow: Die Juden. Schauspiel in 4 Aufzügen. Deutsch von Georg Polonskij. München Verlag Dr. J. Marchlewski & Co 1904, hier S. 95; Lenin Werke 30 (1974), S. 413.
[33] Zitiert nach Wolfgang Beutin / Hermann Klenner / Eckart Spoo (Hg.): Lob des Kommunismus. Alte und neue Weckrufe für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen. Titelbild, Vorsatzblatt, Zeichnungen von Thomas J. Richter. Ossietzky Verlag Hannover 2013, S. 35. Das 1931/1932 von Siegfried Charoux (1896–1967) geschaffene Denkmal wurde 1939 von den Nationalsozialisten eingeschmolzen. Charoux hat zwischen 1962 bis 1965 nochmals ein Lessing-Denkmal geschaffen, das 1968 enthüllt wurde. Kostelnik, Jüdisches Wien, S. 23 f.
„Ich wurde nicht vernichtet. Mit welchem Recht?“
Der Wiener jüdische Kommunist Bruno Frei beschäftigt sich nach seinem Besuch in Auschwitz mit der Frage nach der „Überlebendenschuld“
Das Jüdische Museum in der Wiener Inneren Stadt am Judenplatz[1] hat in seinen Räumen für Wechselausstellungen das komplexe Thema „Schuld“ aufgegriffen.[2] Die von Sabine Apostolo, Gabriele Kohlbauer-Fritz, Marcus G. Patka, Hannes Sulzenbacher und Andrea Winklbauer nach einer Idee von Hannes Sulzenbacher kuratierte Ausstellung (28. März bis 29. Oktober) zeigt in zwanzig Stationen historische und künstlerische und von Texten begleitete Exponate. Dass gerade in der Stadt eines Sigmund Freud (1856–1939) in dieser Ausstellung die „Überlebendenschuld“ mit einer eigenen Station angesprochen wird, macht Sinn. Diese „Überlebendenschuld“ ist mit „Tausend Schatten rufen: Ich“ dokumentiert durch das Zeugnis der von dem aus einer polnisch-russischen jüdischen Familie stammenden Adolfo Kaminsky (1925–2023) aufgenommenen Fotografie von Piotr Raviatz, der das größte deutsche Vernichtungslager Auschwitz überlebt und 1961 Suizid begangen hat.
Traumatisierende Schuldgefühle werden sich nicht allein bei jüdischen KZ-Überlebenden finden lassen. Eine Mutter aus Afrika, deren Kinder von den Schutzstaffeln des europäischen Wertesystems im Mittelmeer ertränkt werden, eine Mutter in versklavten und ausgebeuteten Ländern, die zuschauen muss, wie ihr Kind verhungert, eine palästinensische Mutter, die ihr Kind für die Befreiung ihres Volkes erzogen hat und das dann im Einsatz für die Befreiung umkommt, alle diese Mütter werden „Überlebensschuld“ empfinden. Wenn von den mehr als 1 Million Opfern in Auschwitz die Rede ist, darf nicht das „Auschwitz“ der jüngeren Vergangenheit vergessen werden. Für den Völkermord mit Napalmbomben durch den US-Imperialismus in Vietnam und Kambodscha oder die Ausgrenzung und Versklavung von Millionen von hungernden Menschen in Afrika ist denselben dem Profit nachjagenden kleinen Gruppen von Unterdrückern und ihren Judassen geschuldet. Der Jude Jesus hat gesagt: „Man kann nicht Gott und dem Geld dienen“ (Lk 16,13).
Der Wiener Bruno Frei (1897–1988) hat seit seinen kleinbürgerlichen zionistischen und sozialdemokratischen Anfängen die Klasse gewechselt, er wurde Kommunist und hat seine ganze Lebensbahn mutig in der kommunistischen Weltbewegung eingesetzt. Tradierte Geschichtlichkeit und Metageschichtlichkeit seiner jüdischen Herkunft haben seine Biografie konstituiert.[3] Das jüdische Museum hat 2017 ihn in seiner Ausstellung „Genosse. Jude. Wir wollten nur das Paradies auf Erden“ genannt.[4] In seiner Selbstbiografie erinnert sich Bruno Frei, dass der erste Autor, den er mit Verstand aufgenommen habe, nicht Karl Marx (1818–1883) war, „sondern ein jüdischer Publizist aus der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. u. Z. namens Jeremias“.[5] Mit Heinrich Heine (1797–1856), dem er in seiner Emigration in Mexiko-Stadt mit anderen deutschsprachigen Emigranten ein lebendes Denkmal gesetzt hat, stellt Bruno Frei fest: „Dem Bösen gegenüber gibt es keine Neutralität“.[6] Damit wird ausgedrückt, dass „Schuld“ keine philosophische Spekulation ist, sondern praktisches Handeln jedes Einzelnen für eine andere, für eine bessere Welt erfordert. Die religionsphilosophischen Ansichten von Mose ben Maimon (Maimonides, 1135–1204) war die Richtschnur von Bruno Frei: „Nicht zwingt der Schöpfer den Menschen, nicht beschließt er über sie, dass sie Gutes oder Böses tun, sondern alles ist ihnen überlassen“.[7]
Bruno Frei hat sich in Auschwitz-Birkenau die Frage gestellt: „Ich wurde nicht vernichtet. Mit welchem Recht?“. Er schreibt nach einem Besuch in Israel, wohin er im Sommer 1964 zur „Selbstverständigung“ gereist ist, einen emotionalen, an seine jüdisch religiöse Jugend anknüpfenden Text mit dem Titel „Die Haarflechte. Judenverfolgung von den Römern bis Auschwitz“. Der deutsch jüdische Schriftsteller Stephan Hermlin (1915–1997) hat 1949 Auschwitz besucht und wie Bruno Frei notierte er voll Entsetzen den „unaustilgbaren Makel einer Menschengruppe, die der Bestialität verfiel“. Und, so Stephan Hermlin: „Man denkt plötzlich, wie man so oft schon daran gedacht hat, was noch geschehen wäre ohne die Rote Armee“.[8] In dem hier wiedergegebenen, mit Schreibmaschine konzipierten Text sind die vielen eigenhändigen handschriftlichen Durchstreichungen, Verbesserungen oder Einschübe von Bruno Frei berücksichtigt, aber nicht separat gekennzeichnet. Für Bruno Frei ist die vom deutschen Faschismus betriebene Vernichtung des jüdischen Volkes mit der biblischen Geschichte zu interpretieren.[9]
»Der Autobus brauchte kaum eine Stunde. Das Gezwitscher und Gekicher der Schülerinnen, die den unterrichtsfreien Tag genossen, als wär‘s ein Ausflug ins Grüne, verleidete mir die Fahrt. In Krakau hatte man mir geraten, mich einer Reisegesellschaft anzuschließen, aber ich glaubte, im Linienbus, ohne Touristengeplapper, würde ich mich eher sammeln können. Zugleich war mir bewusst, wie gekünstelt, geradezu lächerlich, meine Befangenheit war. Konnte man Auschwitz nicht besichtigen wie andere Gedenkstätten? Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen – für seelische Erschütterungen gab es ein professionelles Training. Warum dieses dumme Herzklopfen im Anblick des Straßenschildes OSWIECIM?
Ich passierte das Tor mit der bekannten Aufschrift „Arbeit macht frei“. Der Ansichtskartenkiosk im Vorhof des Museums versetzte mich in Wut. Auf den Bänken der Grünanlagen verschnauften fußmüde Besucher. Den Bruchteil einer Sekunde regte sich der Wunsch umzukehren.
Die Birke. Ich hatte alles gelesen, ich wusste alles. Dennoch war es nicht möglich, die Bilder zu verscheuchen, die aus gedruckten Zeugnissen und Gerichtsprotokollen zwanghaft ins Bewusstsein drängten. Also hier. Genau hier wickelte sich Tag für Tag jene teuflisch Routine ab, die lebende Menschen in Objekte der Vernichtung verwandelte. Hier wurden sie zum letztenmal mit ihren Namen aufgerufen. Von da an waren sie Nummern oder Leichen.
Waren es nicht vier Millionen? Einige standen mir nahe. Tante Rosa aus Preßburg – als Einzelne verschwindet sie unter den vier Millionen, aber seltsamerweise steht sie jetzt lebensnah vor mir und die Millionen verblassen.
„Museum Oswiecim-Auschwitz“. Ohne mich aufzuhalten, eile ich durch den Block 15. „Geschichtliche Einführung“ habe ich nicht nötig. Soll die Lehrerin die Kinder geschichtlich einführen, falls ihr gelingt, deren Aufmerksamkeit zu fesseln. Unmittelbar dahinter geht es zum Block 4: „Vernichtung“. Noch einmal muss ich die Schaubilder vom „Verlauf der Vernichtung“ sehen, die Geschichte des „Kombinats der Vernichtung“ über mich ergehen lassen. Ein elendes Gefühl steigt auf. Ich wurde nicht vernichtet. Mit welchem Recht?
Und dann stehe ich vor den Schaufenstern der Vernichtung. Das freilich gibt es nur in Auschwitz. Bin ich deshalb gekommen? Berge von Koffern mit handgeschriebenen Namensschildern, Magazine von Brillen, Krücken, Prothesen. Warenlager von Damen- und Herrenschuhen. Regale mit Zahnbürsten, Rasierpinsel. Mäntel, Hüte, Kleider.
Vor der Glaswand, hinter der Frauenhaar, zu Ballen gestapelt und in Strähnen aufgelöst, die Vitrine in Saaleslänge füllt, bleibe ich stehen. „Als die Sowjetarmee das Lager befreite, fand man in den Lagerräumen 7000 kg in Papiersäcke verpacktes Frauenhaar“ leiert der Führer seinen Text herunter. „Dies war nur ein kleiner Rest der Haare, die von der Lagerverwaltung nicht mehr zur Verarbeitung in die in Bayern gelegenen Werke der Firma Alex Zink geschickt werden konnten. Das Werk zahlte 50 Pfennig pro Kilo. Aus den Haaren der getöteten Frauen machte man Rosshaargewebe. Auch als Feindichtung fanden sie Verwendung“.
Im Vordergrund des Haargebirges bleibt mein Blick an einem streng geflochtenen, dunkelbraunen Zopf haften. Noch einer und dann noch einer. Wieder löste sich mir die Unzahl von vier Millionen auf; deutlich konnte ich eine junge Frau wahrnehmen. Eine Jüdin. Die Haarflechte, dunkelbraun, gab ihr ein freundliches Aussehen. Lebensnah sah ich sie vor mir, wie Tante Rosa. Natürlich begleitete das Bild mein Wissen, dass die Frau, die ihr Haar allmorgendlich zu flechten pflegte, im „Kombinat der Vernichtung“ verröchelt ist. Wie sonst wäre ihr Haar in die Vitrine gekommen?
Genug. Ich gehe dem Ausgang zu. „Das habe ich bereits einmal gesehen“ – sage ich, an den Führer gewandt, der Anstalten machte mich zurückzuhalten. „Waren Sie schon früher in Auschwitz?“. – „Nein“ erwidere ich. „In Auschwitz bin ich zum erstenmal“.
Drei Männer, von speerbewaffneten Soldaten begleitet, keuchten den Schlangenpfad hinauf, der zur Festung führte. Die Sonne stand bereits tief am wolkenlosen Firmament, ihr Widerschein rötete die moabitischen Berge am jenseitigen Ufer des Toten Meeres. In der trocken-heissen Luft fiel den Wanderern das Atmen schwer, das Wasser perlte von ihrer Stirn. Unsicheren Schrittes stapften sie aufwärts, in Sandalen, die auf dem Geröll keinen Halt boten. Der Aufstieg auf dem jäh abfallenden Felshang schien kein Ende zu nehmen. Auf den verschmutzten und verschwitzten Oberhemden hingen die Fransen aus hellblauer Wolle, die das Gesetz vorschreibt. Der Mann an der Spitze unterschied sich von seinen Gefährten durch einen Überwurf, der einmal weiss gewesen sein mag, aber eingerissen war nach dem Brauch der Totenklage. Während die Fremden nur mühsam vorankamen, marschierten die Speerträger, berggewohnt, vor und hinter ihnen. Ehrengeleit oder Bewachung? Kein Wort wurde gesprochen.
Jerusalem war gefallen, der Tempel eingeäschert, die Kämpfer erschlagen. Belagerung und Mauerbrecher haben die Heilige Stadt zu Fall gebracht. Nachdem auch die stark befestigte Oberstadt von den römischen Soldaten erstürmt worden war, kämpften die letzten Eiferer in den unterirdischen Gängen ohne Hoffnung weiter, bis alles Leben in dem brennenden Palast des Herodes[10] erloschen war. Die Menschen, vom Hunger entkräftet, von der Soldateska gejagt, von den Flammen eingekreist, versuchten dem Gemetzel zu entgehen, den rauchenden Trümmern ihrer Stadt zu entfliehen. Wenigen gelang es.
Die Männer und Frauen, auch Kinder gab es, die sich in mühevollem Zug durch die Wüste Judäa schleppten, hatten ein Ziel vor Augen: die uneinnehmbare Festung Masada. Dort, das wussten sie, haben die Eiferer sich zu einem letzten Widerstand gesammelt, dort, wenn überhaupt, gab es noch Hoffnung.
Als der Zug sich dem Toten Meer näherte, wunderten sich die Wanderer über das Grüne der Pflanzungen; vom Krieg scheinbar unberührt bestellten die Bauern das Land; Dattelpalmen, Olivenhaine, Feigenbäume spiegelten den gehetzten Städtern ein Bild des Friedens vor.
Sie wussten: das Bild täuschte. Nicht Frieden, sondern Krieg und Knechtschaft waren im Lande Judäas.
In der Gegend von Engedi, am Ufer des Meeres, stellten Wachposten die Marschierenden. Beschlossen und vereinbart wurde, dass eine Abordnung von drei Vertrauensmännern dem Kommandanten der Festung die Bitte vortragen sollten, er möge die Flüchtlinge in den Schutz seiner Wälle nehmen, im Namen des Allmächtigen, der sie aus dem Verderben der Hauptstadt gerettet hat.
Eleasar ben Jaïr war ein schriftkundiger, ein politischer Soldat.[11] Sein Großvater, als „Juda der Galiläer“ bei Freund und Feind hochberühmt, hatte das Volk gegen die römische Großmacht in den Aufstand geführt. Darüber waren nun schon mehr als sechzig Jahre vergangen. Von den blühenden Ländereien im Norden hatte sich die Revolte über das ganze Land ausgedehnt, bis sie nach wechselvollen Kämpfen, in den großen Befreiungskrieg einmündete. Jahr und Tag lieferten die Freischärler, Väter und Söhne, den Kohorten der Gouverneure in Caesarea[12] zahllose Gefechte, überfielen Truppenlager, befreiten Sklaven, verbrannten Archive, wo die Schuldverschreibungen aufbewahrt waren. Landlose Bauern, entlaufene Leibeigene, städtische Arme, jugendliche Patrioten, auch mancher Abenteurer, stießen zu den Aufständischen, vergrößerten ihre Reihen, so dass sie schließlich das flache Land beherrschten und die römische Besatzungsmacht auf die Städte und befestigte Plätze zurückdrängten.
Juda der Galiläer, Eleasars Großvater, hatte, ehe er im Kampf fiel, die Freiheitskämpfer beschworen, gestützt auf das von den Fremden unterdrückte, von den Kollaborateuren verratene Volk, in fester Ordnung einig zu bleiben; nur so würden sie der Macht Roms widerstehen können. Krieg führen freilich müssten sie anders als die Römer: der Feldschlacht ausweichen, in kleinen Gruppen auf den überraschten Gegner ausschwärmen und ebenso schnell den Rückzug antreten.
Diese Kampfregel folgten auch die Söhne des Juda von Galiläa, Jakob und Shimon, ehe sie im Jahre der Hungersnot in die Hände der Römer fielen und am Kreuze starben. Die Besatzer, und wer zu ihnen hielt, hatten für die Kämpfer in den Bergen nur Schmähungen bereit: Räuber schimpfte man sie, Zeloten, das heißt Fanatiker, Sicarier, das heißt Dolchmänner; gemeinen Wegelageren gleich wurden sie, einmal gefangen, ans Kreuz geschlagen. Sie selbst aber nannten sich die „Eiferer“, denn sie eiferten im Namen des Herrn, der ein eifervoller Gott ist, für Heimat und Gerechtigkeit, für den endlichen Triumph der reinen Lehre. „Der Tag wird kommen“ hatte Juda der Galiläer, ihr Meister, gelehrt, „doch man muss seinem Kommen nachhelfen“.
Das großväterliche Erbe war schwer, drückender aber war die Erinnerung an das Selbsterlebte. In jungen Jahren schon hatte er höchste Erhebung und tiefste Erniedrigung erfahren und zwischen einem und dem andern, finstersten Verrat.
Als Jakob und Shimon, Brüder seiner Mutter, hingerichtet wurden – auch damals munkelte man von Verrat – war er noch ein Kind, glühend in Liebe und Hass, wohlverteilt beides. Herangewachsen hatte er sich selbstverständlich dem Mann angeschlossen, der das Werk des Großvaters fortsetzte: Menahem, Sohn des Juda von Galiläa.
Welch ein Soldat! Welch ein Staatsmann! Dürstend nach Hoffnung und Erlösung nannte ihn die Menge „den Tröster“, wie es seinem Namen entsprach. Der Erfolg schien zum Greifen nahe. Doch der Abfall des Tempelhauptmannes Eleasar Sohn des Chananja in der Stunde der Entscheidung vereitelte den Sieg der Unbedingten und Menahem musste im Tempelbereich sein Leben lassen. In jener schweren Stunde, die über alles entschied, was weiter geschehen sollte, hat Eleasar ben Jaïr den Entschluss gefasst, die Treuesten der Treuen zu sammeln und an ihrer Spitze nach Masada zu marschieren. Von dort war Menahem ausgezogen, die Entscheidung sei nahe, um in Jerusalem die Führung des Aufstandes an sich zu reißen. Die Festung hatte er durch Handstreich genommen und sie, nachdem er die erbeuteten Waffen der Römer und seinen Anhängern verteilt, zum Stützpunkt der Unentwegten gemacht. Als diese jedoch, festgefahren im Straßenkampf um die Macht in der Hauptstadt, von den Gemäßigten unter Führung des abtrünnigen Hohepriestersohnes Eleasar überfallen und ihres Führers beraubt wurden, blieb den Gefolgsleuten Menahems nur der Rückzug nach Masada.
[…]
Dies alles, wie Eleasar erzählte, war wohlbekannt, war doch das ganze Land Kriegsschauplatz geworden. Das aber sei nicht alles, setzte der Sprecher fort. Was Jotapata[13] zum Merkzeichen des Krieges gemacht hat, war des Josefs Abfall und Verrat. Dieser Josef hatte sich während der Belagerung in der Stadt aufgehalten und nachdem die Festung gefallen war in einer Zisterne versteckt, die mit einer Höhle in Verbindung stand. Darin hatten vierzig Patrioten vor dem Massaker Zuflucht gefunden. Als die Römer das Versteck ausfindig machten, forderten sie Josef auf, sich zu ergeben, denn sie kannten ihn bereits. Er war bereit, die andern nicht. Die Unentwegten bedrohten den Willfährigen am Leben, so dass dieser schließlich dem Schwur zustimmte, dass sie allesamt freiwillig sterben wollten. So geschah es. Sie fielen je einer durch die Hand des andern. Nur Josef brach den Eid, den er den andern geleitet. Mit einem Gefährten war er zuletzt geblieben, diesen entwaffnete er und ergab sich Vespasian[14]. Er wurde dessen Schreibsklave.
Eleasar brachte seiner Geschichte mit großer Not zu Ende, oft von wilden Rufen unterbrochen, selber ließ er seiner Erregung freien Lauf. Als er geendet hatte, schickte er sich an, die Versammlung in der Synagoge mit dem Festgebet der Anrufung unseres Vaters, unseres Königs zu beenden, als plötzlich vom Vorplatz der Schrei einer Frau die eingetretene Stille zerriss. „Nein, nein, nein!“ Verzweiflung und Entschlossenheit waren in diesem Schrei. „Ich will nicht sterben. Mit meinen Kindern werde ich ein Schiff besteigen. Auch in Alexandrien gibt es Juden, sogar Eiferer. Meine Kinder sollen leben und sei es in der Fremde. Sie werden in unbekannten Zungen sprechen, die Botschaft weitergeben von dem einen, einzigen Gott“.
Die Rede der Frau brachte Unruhe in die Gemeinde, fast wäre es zu einem Handgemenge gekommen, da richtete Eleasar noch einmal mit Macht das Wort an die Versammelten. „Was du sagst, ist recht und Gott zum Gefallen, Frau! Niemand soll dich gering ansehen, weil du leben willst mit deinen Kindern. Gott hat ihnen das Leben gegeben und wer kann es ihnen nehmen, wenn nicht Gott? Aber auch die Männer und Frauen, die den Tod der Unterwerfung vorzogen, handelten in ihrem Herzen gottgefällig. Wie sie Gottes Absicht in der Welt deuteten, stand ihnen das Leben des Volkes höher als das eigene Leben. Danach ist nicht dein Sinn, Frau, so ziehe dahin. Aber nicht blind sollst du zu den Fremden gehen, wissen sollst, was das Gesetz der Fremde ist“.
Mittlerweile hatte sich die Säulenhalle geleert. Auf dem freien Platz zwischen Synagoge und der Kasematten Mauer sammelten sich die alten und die neuen Inwohner von Masada, um des Kommandanten Antwort an die Zwischenruferin anzuhören.[15] Wieder erging sich Eleasar in Geschichten, die allen wohlbekannt waren, denn sie hatten sich vor nicht langer Zeit, ja manche zu ihren Lebzeitenereignet. Im Munde Eleasars in dem Zusammenhang, in dem er sie darbot, schienen die furchtbaren Geschehnisse eine neue Wahrheit zu enthalten. Diese Frau, wandte sich Eleasar an die Menge, sei von edler Absicht erfüllt, ihre Kinder, so habe sie es in ihrem Herzen beschlossen, sollen die Botschaft vom einigen, einzigen Gott zu den Völkern tragen. Wie aber, wenn die Völker die Boten mit Steinen empfangen? Juden nichts weiter sein sollen als Juden, deren Anspruch auf Botendienst würden in allen Ländern der Zerstreuung beleidigt, gemartert, erschlagen. Daran müsse man denken, nicht auf Verteidigung bis zum letzten Atemzug. Eleasar weckte die Erinnerung an die Zerstörung der mächtigen Gemeinde von Alexandrien zur Zeit des Kaisers Caligula[16], kaum dreißig Jahre sei es her. Bilder des Grauens ließ der Redner entstehen. Wie sie jüdische Häuser in Brand steckten, die Schiffe der jüdischen Kaufleute zerstörten, die Juden bei lebendigem Leibe in die Flammen ihrer Häuser warfen. Sei solches geschehen, ehe Judäa sich gegen die Romherrschaft erhoben hatte, wie erst wüteten die Judenfeinde in den Städten Syriens, nachdem der Aufstand in Judäa begonnen hatte! In Antiochia und in Damaskus hätten die Heiden die Synagogen angezündet, die Juden zu Paaren getrieben und auf Scheiterhaufen verbrannt. Und was das Blut noch heftiger zum Kochen bringen müsse: es sei ein jüdischer Renegat gewesen, der das Vernichtungswerk auslöste. Die den Krieg mitgemacht, wissen aus Eigenem, was in Caesarea, der Residenz des Statthalters Florus geschehen ist. Die ganze jüdische Gemeinde sei vernichtet worden, tausende seien erschlagen, zehntausende als Sklaven auf die Galeeren gebracht worden. Caesarea sei judenrein gemacht worden – im jüdischen Land. Wohin es führe, setzte Eleasar seinen Bericht fort, wenn Juden glauben, Unterwerfung, Verrat, Kollaborieren, mache sich bezahlt, so müsse an das Schicksal von Bet Schean erinnert werden, das Griechen und Römer Skythopolis nennen.[17] Dort hätte die nichtjüdische Mehrheit den Juden versprochen von der fälligen Verfolgung abzusehen, wenn sie mithelfen, die Stadt gegen die Eiferer zu verteidigen, die sich anschickten Bet Schean zu nehmen. Die verblendeten Juden seien in die Falle gegangen, sobald die Eiferer verscheucht waren, hätten die Heiden ihre jüdischen Mitbürger in einen außerhalb der Stadt gelegenen Hain gelockt und alle niedergemacht. Damals sei es geschehen, dass Simon der Sohn des Paul, von Reue über den von ihm mitverschuldeten Untergang seiner Gemeinde sich selbst in das Schwert stürzt, nachdem er seine ganze Familie getötet hatte.
Aber in Rom, der Hauptstadt der Welt, da gingen die Juden doch ihren Geschäften nach, unbehelligt, auch der Gottesdienst sei ihnen erlaubt, denn Rom hat keine Zeit, sich um die Götter der Untertanen zu kümmern.
„Ist es nicht so? So ist es; nur wie lange die kaiserliche Gnade erhalten werde, wann wieder ein Caligula im Palatin sitzen wird, das weiß niemand“.
Auf Scherze verstand sich Eleasar nicht sehr, auch war die Stunde zum Scherzen nicht angelegt; sein zerfurchtes Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. Ob der Herr der Welt eine angenehme Nacht verbracht habe, sei für Wohl und Wehe der Juden von Rom wichtiger als die Beschlüsse des Synhedrions. Im Zeichen der Judensteuer sei selbst ein römischer Bürger nur ein Geduldeter, sofern er Jude ist. „Das sollst du wissen, Frau, wenn du deine Kinder zu den Völkern bringst“.
Es war ein brütendes Schweigen auf dem Felsdach zwischen Himmel und Erde. Unbarmherzig glühte die Wüstensonne und färbte Berge und Bauten gelb. Der Wind brachte feinen, heißen Sand, der in die Kleider eindrang und das Atmen erschwerte.
In das Schweigen warf die Stimme des Leviten die Klage des Psalmisten: „Denn wir werden ja um deinetwillen täglich erwürget und sind geachtet wie Schlachtschafe“. Flehend kam die Antwort aus der Mitte der Menge, der Weißgekleidete die Arme zum Himmel erhob: „Erwecke dich Herr, warum schläfst du? Wache auf und verstoße uns nicht so ganz. Warum verbirgst du dein Antlitz, vergisst unseres Elends und unsere Bedrängnis“.
Ob es Hoffnung gebe, sei er gefragt worden, schloss Eleasar an diesem denkwürdigen Tag seine Ansprache an alle, für die Masada letzte Zuflucht geworden war. Die goldene Zeit sei gewiss, da „kein Volk wider das andere sein Schwert aufheben wird“ und alle Völker eine Familie sein werde und Israel mit ihnen. Aber wann werden wir diese Gewissheit mit unseren Augen sehen? Dass die Verteidiger der letzten Festung Israels sich nicht ergeben werden, diese Gewissheit werde in unseren Tagen sichtbar werden. Lieber sterben von eigener Hand, als den wilden Tieren im Amphitheater vorgeworfen werden, dem Pöbel zur Belustigung. So über alles Maß die Vernichtungswut gegen uns sich steigern mag, unzerstörbar ist der Wille des Volkes zu überleben. Dafür soll dieser Felsen zeugen“.
Die Sonne hatte den Zenith längst überschritten. Erde, Meer und Himmel waren in Feuer getaucht. An der Mauer der Kasematten zeigten sich die ersten Abendschatten.
„Lieber Masada als Auschwitz“. Mit diesen Worten beschloss der Professor die Führung. Im Archäologischem Institut der Universität Jerusalem war ich angemeldet, um über die Ergebnisse der Ausgrabungen im Bereich der Höhlen und Felsen am Toten Meer Einzelheiten zu erfahren. Der Leiter des Instituts, Professor Yigael Yadin[18], hatte in zwei Grabungscampagnen zwischen 1963 und 1965, mit Unterstützung der israelischen Streitkräfte und Freiwilliger aus vielen Ländern, die seit 1900 Jahren verschütteten Geheimnisse von Masada bloßgelegt. Der Professor mit schwarzem Spitzbart, Yadins rechte Hand, zeigte sich aufgeschlossen.
Die Forscher hätten ihren Augen nicht getraut als sie unter Schutt und Staub von Jahrhunderten den entsetzenerregenden Bericht des Flavius Josephus[19] über den Massenselbstmord der letzten Verteidiger von Masada bestätigt fanden. Was jener jüdisch-römische Zeitgenosse in seiner Geschichte des Jüdischen Krieges für die Nachwelt aufgezeichnet hatte, war also keine Legende; der Spaten brachte es an den Tag.
Da lagen unter dem Schutt die Skelette eines jungen Mannes, einer jungen Frau und eines Kindes. Daneben hunderte von Silberplättchen, offensichtlich Bestandteile einer Rüstung, ferner Pfeilspitzen, Fragmente eines Gebetstuches, eine Tonscherbe mit Aufschrift. Neben dem Skelett der Frau lagen ihre Sandalen. Auch Nahrungsreste, wie Dattel- und Olivenkerne, Münzen, geprägt zur Zeit des Aufstandes, Küchengeräte, Stoffreste, Schriftrollen und schließlich einen Haufen von menschlichen Knochenresten fanden die Wissenschaftler.
Der erregendste Fund, berichtet der Expeditionsleiter, seien merkwürdig beschriebene Gefäßscherben gewesen, die zum Auslosen der Reihenfolge der Selbstmörder gedient haben. Die Scherben trugen Namen. Einer davon war „ben Jaïr“.
Als die Römer nach einer ungemein aufwendigen Belagerung die Festung stürmten, verhallte ihr Kriegsgeschrei, unnatürliche Stille erwartete sie. Zwei Frauen, berichtet der antike Geschichtsschreiber, die sich mit ihren Kindern versteckt hatten, kamen hervor und erzählten, was geschehen war. 960 Männer und Frauen, die Besatzung der letzten Festung Judäas, hatten sich in der Stunde, da kein Widerstand mehr möglich war, selbst getötet und ihr Lager in Brand gesteckt.
Sechzig Jahre später, erzählt der Professor, haben die letzten Kämpfer des letzten Rebellen Bar Kochba[20] dasselbe getan. „In den wilden Klippen des Nahal Hever unweit der Oase Engedi haben wir in einer rauchgeschwärzten Höhle ihre Spuren gefunden. Wie die Verteidiger vor ihnen von Masada ergaben sie sich, hoffnungslos eingeschlossen von den Belagerern, nicht. Sie töteten sich“.
Unter den Fundstücken aus Masada berührte mich mehr als alles die dunkle, volle Haarflechte einer jungen Frau, die aussah, als sei sie eben frisiert worden. Die Haarflechte ist neben dem Skelett gefunden worden. In der außerordentlich trockenen Luft war sogar ein Stück Kopfhaut erhalten geblieben. «
Weil Bruno Frei sich mit der biblischen Geschichte des jüdischen Volkes identifizierte, war für ihn die von der Sowjetunion in der Vollversammlung der UNO vom 26. November 1947 angesichts des Leids der Juden in Europa begrüßte Gründung des Staates Israel (14. Mai 1948) die Möglichkeit, die „jüdische Mission“, von der Lion Feuchtwanger (1884–1958) gesprochen hat, zu verwirklichen, „ein Staat zu sein, nicht wie alle Staaten, gezeichnet vom moralischen Nihilismus, ein Staat vielmehr, wo der Mensch dem Menschen Bruder ist und nicht Wolf“.[21] Mit Israel hätte die Juden das Vermächtnis von Bar Kochba gewählt.[22] Noch 1967 hat sich Bruno Frei als einer der wenigen Kommunisten in Wien mit Israel aufgrund des Sechstagekrieges solidarisiert.[23] Das unterscheidet ihn vom antikommunistischen jüdischen Wiener Schriftsteller Hans Weigel (1908–1991), der sich von Israel öffentlich distanzierte als es, so Bruno Kreisky (1911–1990) zitierend, „faschistoid“ geworden ist.[24]
Hat sich der Judenstaat Israel jemals an die jüdisch biblische Tradition erinnert? Nach Auffassung von Papst Franziskus (*1936) lebt die Menschheit die biblische Geschichte von Kain und Abel fort. Am 18. Mai 2023 drohte ein Flaggenmarsch von ca. 20.000 jüdischer Rechtsradikaler mit messianischem Sendungsbewusstsein durch die Altstadt von Jerusalem, es werde eine zweite Nakba kommen. Heute wird gegen die palästinensische Bevölkerung ein „Nervenkrieg“ mit gezielten Tötungen geführt, wie sie die jüdischen Verbände Anfang März 1948 erstmals eingesetzt haben.[25] Zu diesem „Nervenkrieg“ gehört, dass im Frühjahr 2002 die auf Befehl von Kaiser Constantinus (272? – 337) in Bethlehem zur Erinnerung an die Geburt von Jesus errichtete Basilika vierzig Tage lang Schauplatz eines israelischen Gefechts gegen zweihundertvierzig, in die Kirche geflüchteten Palästinenser war?[26]
Die 1843 niedergeschriebene Auseinandersetzung von Karl Marx mit Bruno Bauer (1809–1882) über das Verhältnis von Christentum und Judentum ist der Beginn seiner fundamentalen und ohne erkennbare jüdische Wurzeln entwickelten Gedanken über den dialektischen und historischen Materialismus. Der moderne Mensch müsse über die Toleranz der Religionen einschließlich der Privatreligionen hinauskommen. „Das Judentum“, so Marx, „hat sich nicht trotz der Geschichte, sondern durch die Geschichte erhalten“.[27] Auch wenn Marx die Frage, was denn der weltliche Kultus und der weltliche Gott des Judentums ist, mit „Der Schacher“ und „Das Geld“ beantwortet und in seinem Text nach der Juniniederlage 1848 beispielsweise vom „Frankreich der Börsenjuden“, welche mit der „Dynastie Rothschild“ tatsächlich existierte, verwendet, ist es der Zeit nach Auschwitz geschuldet, ihm „Judenfeindliches“ vorzuwerfen.[28] Die Grundaussage von Marx über die Juniniederlage 1848 ist „Die Revolution ist tot! – Es lebe die Revolution!“.[29]
Bruno Frei hat gehofft, dass die Juden einst mit ihrem verheißenen Land Israel die Welt des Sozialismus bereichern werden.[30] Bruno Frei war ein utopischer Kommunist, der von der Armut und Ungerechtigkeit ausging, in der die Mehrheit der Menschen von den Reichen gefesselt wird. Als Marxist wird er nicht übersehen haben können, dass neben Bank und Börse eine „sozialistische Synagoge“ mit ihren Hohenpriestern nur die Aufgabe hat, „das gelobte Land zu entdecken“ und „das neue Evangelium zu verkünden“, um das Proletariat zu beschäftigen.[31] Von jüdischen Marxisten war da und dort bekannt, dass für sie gelegentlich Marx, der jüdischer Herkunft ist, eine Art Talmud war, wenn auch nützlicher. Im zaristischen Russland hat der von Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924) als Intellektueller zur Kenntnis genommene Jewgeni Tschirikow (1864–1932) 1904 das auch in deutscher Sprache veröffentlichte Stück „Die Juden“ geschrieben, in dem der junge und fromme jüdische Lehrer Nachmann einem gealterten, wie ein biblischer Patriarch ausschauenden Leiser Frenkel sagt: „Wartet nur ab, bis euer Marx kommt und alle Menschen in das verheißene Land führt! Wartet immer weiter auf euren Marx! Aber seht zu, dass er nicht etwa vergisst, die Juden mitzunehmen, wenn er alle Menschen in das verheißene Land führt! – Er wird’s vergessen! Er wird’s vergessen – die Juden wird er vergessen!“.[32]
Die Ausstellung am Judenplatz kann dazu mahnen, hinter die praktizierte Heuchelei der Gegenwart zu schauen. Mit dem unbeugsamen, aufrichtigen Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), dessen Bronzestatue wenige Schritte vor dem Eingang ins Jüdische Museum auf dem Judenplatz aufgestellt ist, lässt sich hoffen: „Sie wird kommen die Zeit, da der Mensch das Gute tun wird, weil es das Gute ist, nicht weil willkürlich Lohn und Strafe darauf gesetzt sind“.[33]
[1] Zu den Örtlichkeiten vgl. Oskar Kostelnik: Jüdische Spuren in Wien. echomedia media buchverlag Wien 2018.
[2] Schuld. Guilt. Herausgegeben durch das Jüdische Museum Wien. Jüdisches Museum Wien. Judenplatz. Wien 2023.
[3] Gerhard Oberkofler: Mit der Ethik der Väter (Pirkey Aboth) zum Denken und Handeln für eine geschwisterliche Welt – Teil 1 – Zeitung der Arbeit; Mit der Ethik der Väter (Pirkey Aboth) zum Denken und Handeln für eine geschwisterliche Welt – Teil 2 – Zeitung der Arbeit
[4] Hg. von Gabriele Kohlbauer-Fritz und Sabine Bergler im Auftrage des Jüdischen Museums Wien. Amalthea Verlag ein 2017, S. 30 f.
[5] Bruno Frei: Der Papiersäbel. Autobiographie. S. Fischer Verlag Frankfurt a. M. 1972, S. 117
[6] Bruno Frei: Sachwert und Flamme. In: Ich hab ein neues Schiff bestiegen. Heine im Spiegel neuer Poesie und Prosa. Eine Anthologie. Hg. von Uwe Berger und Dr. Werner Neubert. Aufbau Verlag Berlin und Weimar o. J., S. 186–189.
[7] Moses ben Maimon (12. Jh.): Über die Freiheit des Willens. In: Sendung und Schicksal. Aus dem Schrifttum des nachbiblischen Judentums. Mitgeteilt von Nahum Norbert Glatzer und Ludwig Straube. Schocken Verlag Berlin 1931, S. 36–40, S. 38; zum Text vgl. Geschichte des jüdischen Volkes. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger, Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menachem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben von Haim Hillel Ben-Sasson. Mit einem Nachwort von Michael Brenner. Verlag C. H. Beck München 6. A. 2016; dazu Lexikon des Judentums. Chefredakteur John F. Oppenheimer, New York. Mitherausgeber Emanuel Bin Gorion, Tel Aviv, E. G. Lowenthal, London/Frankfurt a M., Hanns G. Reissner, New York. C. Bertelmann Verlag Gütersloh 1967.
[8] Stephan Hermlin: Die Sache des Friedens. Aufsätze und Berichte. Verlag Volk und Welt. Berlin 1953, S.176–183 (Auschwitz ist unvergessen); wiederabgedruckt in: Äußerungen 1944–1982. Aufbau Verlag Berlin und Weimar, 1983, S.85–89.
[9] Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands. Nachlass Frei. 20126 / Q 4.
[10] Jüd. König 37–4 v. u. Z.
[11] Ben-Sasson, S. 339 und öfters.
[12] Caesarea, Kessarija, Hafenstadt zwischen Natania und Haifa, von Herodes gegründet und zur Römerzeit Hauptstadt der Provinz Judäa, Sitz des römischen Statthalters. Lexikon des Judentums, Sp. 138.
[13] Festung in Galiläa, von Josephus verteidigt, von Vespasian erobert.
[14] Vespasian, röm. Kaiser 69–79 n. u. Z.
[15] Be-Sasson, Geschichte des jüdischen Volkes, S. 339 spricht von der“ berühmten Masada-Rede“ des Eleasar ben Jaïr, S. 339.
[16] Caligula, röm. Kaiser 37–41 n. u. Z.
[17] Lexikon des Judentums, Sp. 90.
[18] Yigael Yadin—Wikipédia (wikipedia.org)
[19] Josephus Flavius 37- ca 105 n. u. Z., lebte nach Jerusalems Zerstörung (70 n. u. Z.) in Rom
[20] Bar Kochba [„Sternensohn“], messianischer Beiname des Simon bar Koseba aus der Stadt Koseba in Juda, Führer des letzten großen Aufstandes der palästinensischen Juden gegen die Römer (132–135) und Rückeroberer Jerusalems. In Bethar eingeschlossen, fiel er mit der Besatzung. Lexikon des Judentums, Sp. 74.
[21] Bruno Frei: Israel zwischen den Fronten. Utopie und Wirklichkeit. Europa Verlag Wien / Frankfurt / Zürich 1955; derselbe: Die Heilige Utopie. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte des jüdischen Volkes. Gival-Haviva. Kibbutz-Artzi. Israel [ca 1981]; Zitat Die Heilige Utopie, A. S. 50.
[22] Frei, Der Papiersäbel, S. 378.
[23] Evelyn Adunka: Die vierte Gemeinde. Die Geschichte der Wiener Juden von 1945 bis heute. Philo Verlagsgesellschaft Berlin / Wien 2000, S. 261.
[24] Hans Weigel: Man kann nicht ruhig darüber reden. Umkreisung eines fatalen Themas. Verlag Styria, Graz / Wien / Köln 2. 1986, S. 12.
[25] Younes R. Altamemi: Die Palästinaflüchtlinge und die Vereinten Nationen. Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlingsproblem (WAR). Band VII. Wilhelm Braumüller Verlag Stuttgart 1974.
[26] Bethlehem Reborn. UNO 2023 (Ausstellung); P. Martin Ramm FSSP: Heiliges Land. Pilgern auf den Souren Jesu. Thalwil 3. A. 2018.
[27] MEW 1 (1972), S. 347–377, hier S. 374.
[28] Artikel Judenfrage in: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Band 3. Im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig hg. von Dan Diener. J. Metzler Verlagsbuchhandlung Stuttgart 2012, S. 228–233 (Thomas Haury).
[29] MEW 7 (1973), S. 12–34 (Die Juniniederlage 1848).
[30] Frei, Israel, S. 10.
[31] MEW 7 (1973), S. 19.
[32] Eugen Tschirikow: Die Juden. Schauspiel in 4 Aufzügen. Deutsch von Georg Polonskij. München Verlag Dr. J. Marchlewski & Co 1904, hier S. 95; Lenin Werke 30 (1974), S. 413.
[33] Zitiert nach Wolfgang Beutin / Hermann Klenner / Eckart Spoo (Hg.): Lob des Kommunismus. Alte und neue Weckrufe für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen. Titelbild, Vorsatzblatt, Zeichnungen von Thomas J. Richter. Ossietzky Verlag Hannover 2013, S. 35. Das 1931/1932 von Siegfried Charoux (1896–1967) geschaffene Denkmal wurde 1939 von den Nationalsozialisten eingeschmolzen. Charoux hat zwischen 1962 bis 1965 nochmals ein Lessing-Denkmal geschaffen, das 1968 enthüllt wurde. Kostelnik, Jüdisches Wien, S. 23 f.