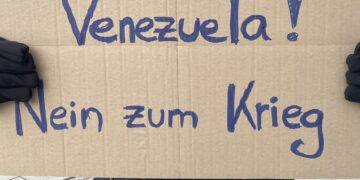Am 4. Dezember jährt sich der Geburtstag Rainer Maria Rilkes zum 150. Mal – ein Anlass, den vielleicht bedeutendsten Lyriker des deutschen Sprachraums neu zu betrachten. Während seine Gedichte generationenübergreifend faszinieren, bleibt sein Leben ein Geflecht aus Widersprüchen: zwischen künstlerischem Höhenflug, persönlicher Verletzlichkeit und politischen Ansichten, die bis heute irritieren.
Ein Dichter mit Sehnsucht nach dem „Höheren“
Geboren 1875 in Prag, wuchs Rilke in bescheidenen Verhältnissen auf. Vom Mythos adeliger Abstammung, den ein Lexikograph Ende des 19. Jahrhunderts zu einem festen Fakt erhob, kann tatsächlich keine Rede sein. Die väterliche Linie bestand aus böhmischen Bauern, mütterlicherseits stammte die Familie von elsässischen Einwanderern ab. Dennoch hielt sich Rilke lebenslang an einer Idee von Vornehmtun und geistigem Adel fest – eine Art innere Kompensation für seine konfliktreiche Kindheit.
Die frühen Jahre waren geprägt von familiären Spannungen und von einem Rollenzwang, der ihm erst spät bewusst wurde: Rilke musste als Bub zunächst die verstorbene ältere Schwester „ersetzen“ und wurde bis zur Schuleinführung wie ein Mädchen gekleidet. Später scheiterte der Versuch der Eltern, ihn in eine Offizierslaufbahn zu drängen. Nach vier Jahren Militärerziehung „erzwang“ der körperlich wie seelisch erschöpfte Jugendliche 1891 seinen Austritt. Er wollte Dichter werden – und zwar ein Dichter „von Rang“.
Künstlerische Entwicklung: Von Prag über München nach Paris
Nach ersten Veröffentlichungen in Prag floh Rilke 1896 vor familiären Erwartungen nach München, wo er in der Literaturszene Anschluss fand – und im Mai 1897 Lou Andreas-Salomé begegnete. Sie wurde zentrale Mentorin und Geliebte, die ihn zur Abkehr vom neoromantischen Überschwang drängte und ihn zu klareren Bildern und Formen führte.
Der weitere Weg führte ihn nach Worpswede, wo er 1901 die Bildhauerin Clara Westhoff heiratete. Die Ehe hielt nur kurz – Rilke fühlte sich der unbedingten künstlerischen Freiheit verpflichtet und pendelte bald nach Paris. Dort verdichteten sich existenzielle Erfahrungen mit der Moderne, die in seinem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und in den Neuen Gedichten kulminierten.
Ab 1905 stützten Aristokratinnen und Mäzene sein prekäres Einkommen. Ob auf Schloss Duino bei der Fürstin Marie von Thurn und Taxis oder später in der Schweiz bei Nanny Wunderly-Volkart – Rilkes Werk wäre ohne diese Netzwerke kaum denkbar gewesen.
Zwischen Revolution und Reaktion
Unpolitisch sei Rilke gewesen, heißt es oft. Doch die Briefe des Dichters, in manchen Wintern über 400 an der Zahl, zeigen ein komplizierteres Bild. Während der Münchner Räterepublik 1919, die anfangs pazifistisch, demokratisch geprägt war, sympathisierte er zunächst. Mit dem zunehmenden Einfluss der KPD auf die Räterepublik, distanzierte er sich jedoch. Von zaristisch Russland begeistert, hatte er zuvor schon die sozialistische Revolution von 1917 abgelehnt.
Seine Politik war keine linke, sondern eine zutiefst ambivalente. Rilke misstraute demokratischen Entwicklungen, fürchtete die „grenzenlose Freiheit“ und schwärmte in den 1920er Jahren von autoritären Ordnungsmodellen – insbesondere dem italienischen Faschismus. In einem Briefwechsel mit der Mailänder Fürstin Aurelia Gallarati-Scotti lobte er Italien als einzig „glückliches“, im Aufstieg begriffenes Land. Die Adressatin widersprach ihm deutlich humanistischer als der Dichter argumentierte.
Diese späten politischen Äußerungen irritieren nicht nur moderne Leserinnen und Leser. Bereits Zeitgenossen stellten fest, dass hinter Rilkes verfeinerter Sensibilität eine erstaunliche Distanz zum realen Leid der Gegenwart steckte. Seine begeisterten Zuschreibungen an Mussolini erfolgten zu einem Zeitpunkt, als dessen Regime längst durch Gewalt, Wahlfälschung und politische Morde geprägt war.
Die dunklen Untertöne: Autoritätssehnsucht und „heilsame Gewalt“
Literaturwissenschaftler sehen in Rilkes Denken eine Tendenz zur sakral aufgeladenen Unterwerfung: Ordnung, Härte, Schicksalsakzeptanz – oft in metaphysische Sprache gekleidet, aber politisch anschlussfähig an autoritäre Ideologien.
In Briefen sprach er sich offen für eine „zeitlich begrenzte Gewalt“ als ordnendes Prinzip aus. Die Idee des „Führers“ – nicht im nationalistischen, sondern im quasi-spirituellen Sinn – faszinierte ihn. Manche Deuter sehen darin eine poetische Überhöhung des starken Einzelnen, andere eine gefährliche Blindheit gegenüber politischer Realität.
Hans-Peter Kunisch, der jüngst Rilkes politische Ansichten untersucht hat, nennt ihn pointiert einen „Salonfaschisten“ –, einen Ästheten, der aus dem Unpolitischen heraus politische Härte romantisierte.
Das Werk bleibt – und bleibt umstritten
Trotz allem: Rilkes Gedichte haben ihren Rang behalten. Der Panther, Herbsttag, Archaischer Torso Apollos, Das Karussell – sie bilden bis heute den Kern eines lyrischen Kanons, der in der Schule ebenso präsent ist wie in Anthologien. Seine Sprache, seine Bildkraft, der innere Klang seiner Verse: all das prägt die deutschsprachige Lyrik bis heute.
Dass dieser Dichter, dessen Worte Millionen berührt haben, zugleich Ansichten vertrat, die mit Humanität wenig gemein hatten, ist Teil seines Widerspruchs. Rilke, der sich selbst Lebens-Anfänger nannte, war vielleicht nie der souveräne Geist, als den ihn das 20. Jahrhundert stilisiert hat – sondern ein Suchender, Getriebener, manchmal auch Verblendeter.
Ein Jubiläum, das zur Diskussion einlädt
Zum 150. Geburtstag lohnt ein unvoreingenommener Blick auf diese widersprüchliche Figur. Rilke bleibt eine Ausnahmeerscheinung – literarisch einzigartig, menschlich schwer zu fassen. Sein Werk fordert uns heraus, und sein Leben konfrontiert uns mit der Frage, wie wir Kunst und Person miteinander ins Verhältnis setzen wollen.